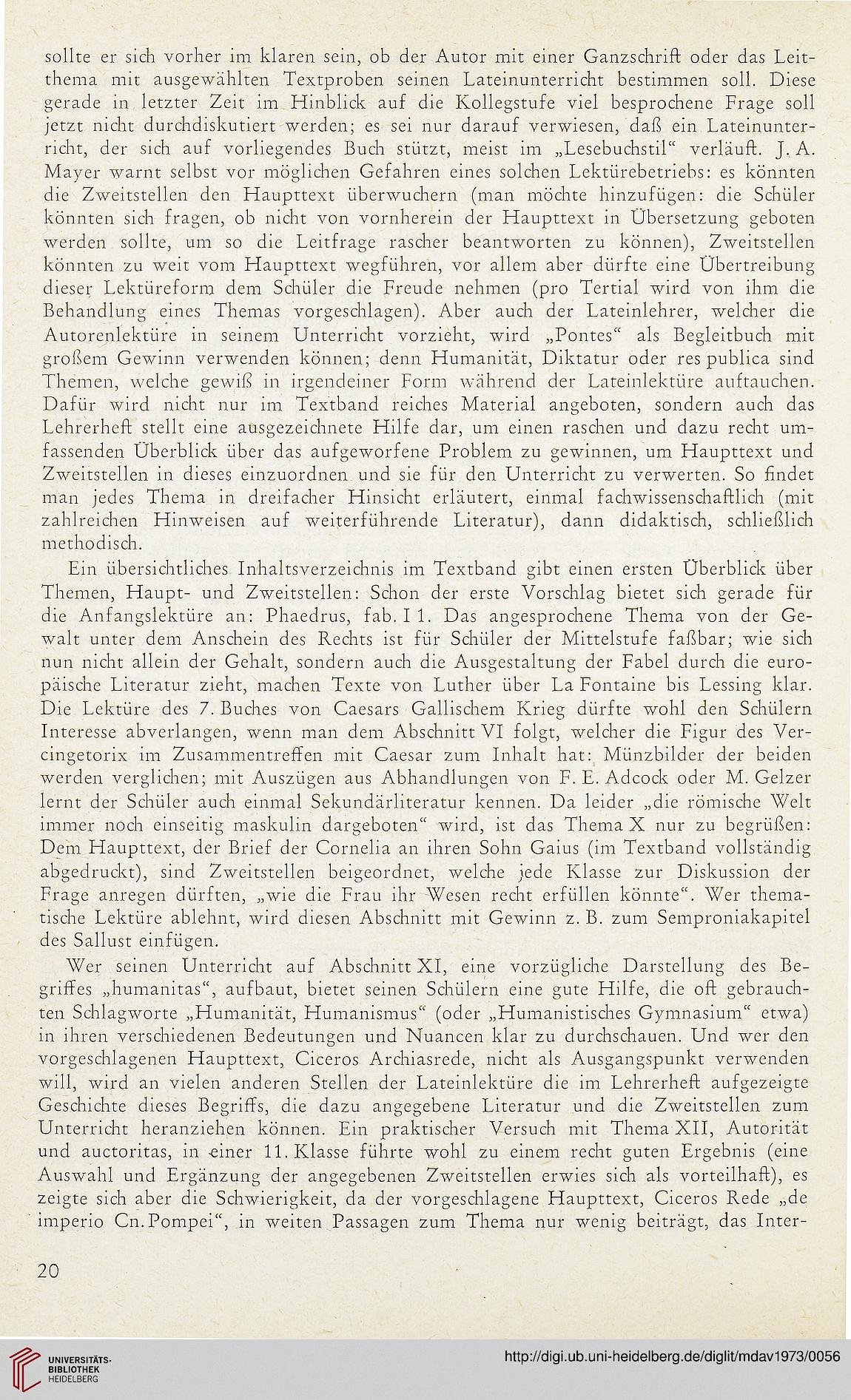sollte er sich vorher im klaren sein, ob der Autor mit einer Ganzschrift oder das Leit-
thema mit ausgewählten Textproben seinen Lateinunterricht bestimmen soll. Diese
gerade in letzter Zeit im Hinblick auf die Kollegstufe viel besprochene Frage soll
jetzt nicht durchdiskutiert werden; es sei nur darauf verwiesen, daß ein Lateinunter-
richt, der sich auf vorliegendes Buch stützt, meist im „Lesebuchstil“ verläuft. J. A.
Mayer warnt selbst vor möglichen Gefahren eines solchen Lektürebetriebs: es könnten
die Zweitstellen den Haupttext überwuchern (man möchte hinzufügen: die Schüler
könnten sich fragen, ob nicht von vornherein der Haupttext in Übersetzung geboten
werden sollte, um so die Leitfrage rascher beantworten zu können), Zweitstellen
könnten zu weit vom Haupttext wegführen, vor allem aber dürfte eine Übertreibung
dieser Lektüreform dem Schüler die Freude nehmen (pro Tertial wird von ihm die
Behandlung eines Themas vorgeschlagen). Aber auch der Lateinlehrer, welcher die
Autorenlektüre in seinem Unterricht vorzieht, wird „Pontes“ als Begleitbuch mit
großem Gewinn verwenden können; denn Humanität, Diktatur oder res publica sind
Themen, welche gewiß in irgendeiner Form während der Lateinlektüre auftauchen.
Dafür wird nicht nur im Textband reiches Material angeboten, sondern auch das
Lehrerheft stellt eine ausgezeichnete Hilfe dar, um einen raschen und dazu recht um-
fassenden Überblick über das aufgeworfene Problem zu gewinnen, um Haupttext und
Zweitstellen in dieses einzuordnen und sie für den Unterricht zu verwerten. So findet
man jedes Thema in dreifacher Hinsicht erläutert, einmal fachwissenschaftlich (mit
zahlreichen Hinweisen auf weiterführende Literatur), dann didaktisch, schließlich
methodisch.
Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis im Textband gibt einen ersten Überblick über
Themen, Haupt- und Zweitstellen: Schon der erste Vorschlag bietet sich gerade für
die Anfangslektüre an: Phaedrus, fab. I 1. Das angesprochene Thema von der Ge-
walt unter dem Anschein des Rechts ist für Schüler der Mittelstufe faßbar; wie sich
nun nicht allein der Gehalt, sondern auch die Ausgestaltung der Fabel durch die euro-
päische Literatur zieht, machen Texte von Luther über La Fontaine bis Lessing klar.
Die Lektüre des 7. Buches von Caesars Gallischem Krieg dürfte wohl den Schülern
Interesse abverlangen, wenn man dem Abschnitt VI folgt, welcher die Figur des Ver-
cingetorix im Zusammentreffen mit Caesar zum Inhalt hat: Münzbilder der beiden
werden verglichen; mit Auszügen aus Abhandlungen von F. E. Adcock oder M. Geizer
lernt der Schüler auch einmal Sekundärliteratur kennen. Da leider „die römische Welt
immer noch einseitig maskulin dargeboten“ wird, ist das Thema X nur zu begrüßen:
Dem Haupttext, der Brief der Cornelia an ihren Sohn Gaius (im Textband vollständig
abgedruckt), sind Zweitstellen beigeordnet, welche jede Klasse zur Diskussion der
Frage anregen dürften, „wie die Frau ihr Wesen recht erfüllen könnte“. Wer thema-
tische Lektüre ablehnt, wird diesen Abschnitt mit Gewinn z. B. zum Semproniakapitel
des Sallust einfügen.
Wer seinen Unterricht auf Abschnitt XI,. eine vorzügliche Darstellung des Be-
griffes „humanitas“, aufbaut, bietet seinen Schülern eine gute Hilfe, die oft gebrauch-
ten Schlagworte „Humanität, Humanismus“ (oder „Humanistisches Gymnasium“ etwa)
in ihren verschiedenen Bedeutungen und Nuancen klar zu durchschauen. Und wer den
vorgeschlagenen Haupttext, Ciceros Archiasrede, nicht als Ausgangspunkt verwenden
will, wird an vielen anderen Stellen der Lateinlektüre die im Lehrerheft aufgezeigte
Geschichte dieses Begriffs, die dazu angegebene Literatur und die Zweitstellen zum
Unterricht heranziehen können. Ein praktischer Versuch mit Thema XII, Autorität
und auctoritas, in -einer 11. Klasse führte wohl zu einem recht guten Ergebnis (eine
Auswahl und Ergänzung der angegebenen Zweitstellen erwies sich als vorteilhaft), es
zeigte sich aber die Schwierigkeit, da der vorgeschlagene Haupttext, Ciceros Rede „de
imperio Cn. Pompei“, in weiten Passagen zum Thema nur wenig beiträgt, das Inter-
20
thema mit ausgewählten Textproben seinen Lateinunterricht bestimmen soll. Diese
gerade in letzter Zeit im Hinblick auf die Kollegstufe viel besprochene Frage soll
jetzt nicht durchdiskutiert werden; es sei nur darauf verwiesen, daß ein Lateinunter-
richt, der sich auf vorliegendes Buch stützt, meist im „Lesebuchstil“ verläuft. J. A.
Mayer warnt selbst vor möglichen Gefahren eines solchen Lektürebetriebs: es könnten
die Zweitstellen den Haupttext überwuchern (man möchte hinzufügen: die Schüler
könnten sich fragen, ob nicht von vornherein der Haupttext in Übersetzung geboten
werden sollte, um so die Leitfrage rascher beantworten zu können), Zweitstellen
könnten zu weit vom Haupttext wegführen, vor allem aber dürfte eine Übertreibung
dieser Lektüreform dem Schüler die Freude nehmen (pro Tertial wird von ihm die
Behandlung eines Themas vorgeschlagen). Aber auch der Lateinlehrer, welcher die
Autorenlektüre in seinem Unterricht vorzieht, wird „Pontes“ als Begleitbuch mit
großem Gewinn verwenden können; denn Humanität, Diktatur oder res publica sind
Themen, welche gewiß in irgendeiner Form während der Lateinlektüre auftauchen.
Dafür wird nicht nur im Textband reiches Material angeboten, sondern auch das
Lehrerheft stellt eine ausgezeichnete Hilfe dar, um einen raschen und dazu recht um-
fassenden Überblick über das aufgeworfene Problem zu gewinnen, um Haupttext und
Zweitstellen in dieses einzuordnen und sie für den Unterricht zu verwerten. So findet
man jedes Thema in dreifacher Hinsicht erläutert, einmal fachwissenschaftlich (mit
zahlreichen Hinweisen auf weiterführende Literatur), dann didaktisch, schließlich
methodisch.
Ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis im Textband gibt einen ersten Überblick über
Themen, Haupt- und Zweitstellen: Schon der erste Vorschlag bietet sich gerade für
die Anfangslektüre an: Phaedrus, fab. I 1. Das angesprochene Thema von der Ge-
walt unter dem Anschein des Rechts ist für Schüler der Mittelstufe faßbar; wie sich
nun nicht allein der Gehalt, sondern auch die Ausgestaltung der Fabel durch die euro-
päische Literatur zieht, machen Texte von Luther über La Fontaine bis Lessing klar.
Die Lektüre des 7. Buches von Caesars Gallischem Krieg dürfte wohl den Schülern
Interesse abverlangen, wenn man dem Abschnitt VI folgt, welcher die Figur des Ver-
cingetorix im Zusammentreffen mit Caesar zum Inhalt hat: Münzbilder der beiden
werden verglichen; mit Auszügen aus Abhandlungen von F. E. Adcock oder M. Geizer
lernt der Schüler auch einmal Sekundärliteratur kennen. Da leider „die römische Welt
immer noch einseitig maskulin dargeboten“ wird, ist das Thema X nur zu begrüßen:
Dem Haupttext, der Brief der Cornelia an ihren Sohn Gaius (im Textband vollständig
abgedruckt), sind Zweitstellen beigeordnet, welche jede Klasse zur Diskussion der
Frage anregen dürften, „wie die Frau ihr Wesen recht erfüllen könnte“. Wer thema-
tische Lektüre ablehnt, wird diesen Abschnitt mit Gewinn z. B. zum Semproniakapitel
des Sallust einfügen.
Wer seinen Unterricht auf Abschnitt XI,. eine vorzügliche Darstellung des Be-
griffes „humanitas“, aufbaut, bietet seinen Schülern eine gute Hilfe, die oft gebrauch-
ten Schlagworte „Humanität, Humanismus“ (oder „Humanistisches Gymnasium“ etwa)
in ihren verschiedenen Bedeutungen und Nuancen klar zu durchschauen. Und wer den
vorgeschlagenen Haupttext, Ciceros Archiasrede, nicht als Ausgangspunkt verwenden
will, wird an vielen anderen Stellen der Lateinlektüre die im Lehrerheft aufgezeigte
Geschichte dieses Begriffs, die dazu angegebene Literatur und die Zweitstellen zum
Unterricht heranziehen können. Ein praktischer Versuch mit Thema XII, Autorität
und auctoritas, in -einer 11. Klasse führte wohl zu einem recht guten Ergebnis (eine
Auswahl und Ergänzung der angegebenen Zweitstellen erwies sich als vorteilhaft), es
zeigte sich aber die Schwierigkeit, da der vorgeschlagene Haupttext, Ciceros Rede „de
imperio Cn. Pompei“, in weiten Passagen zum Thema nur wenig beiträgt, das Inter-
20