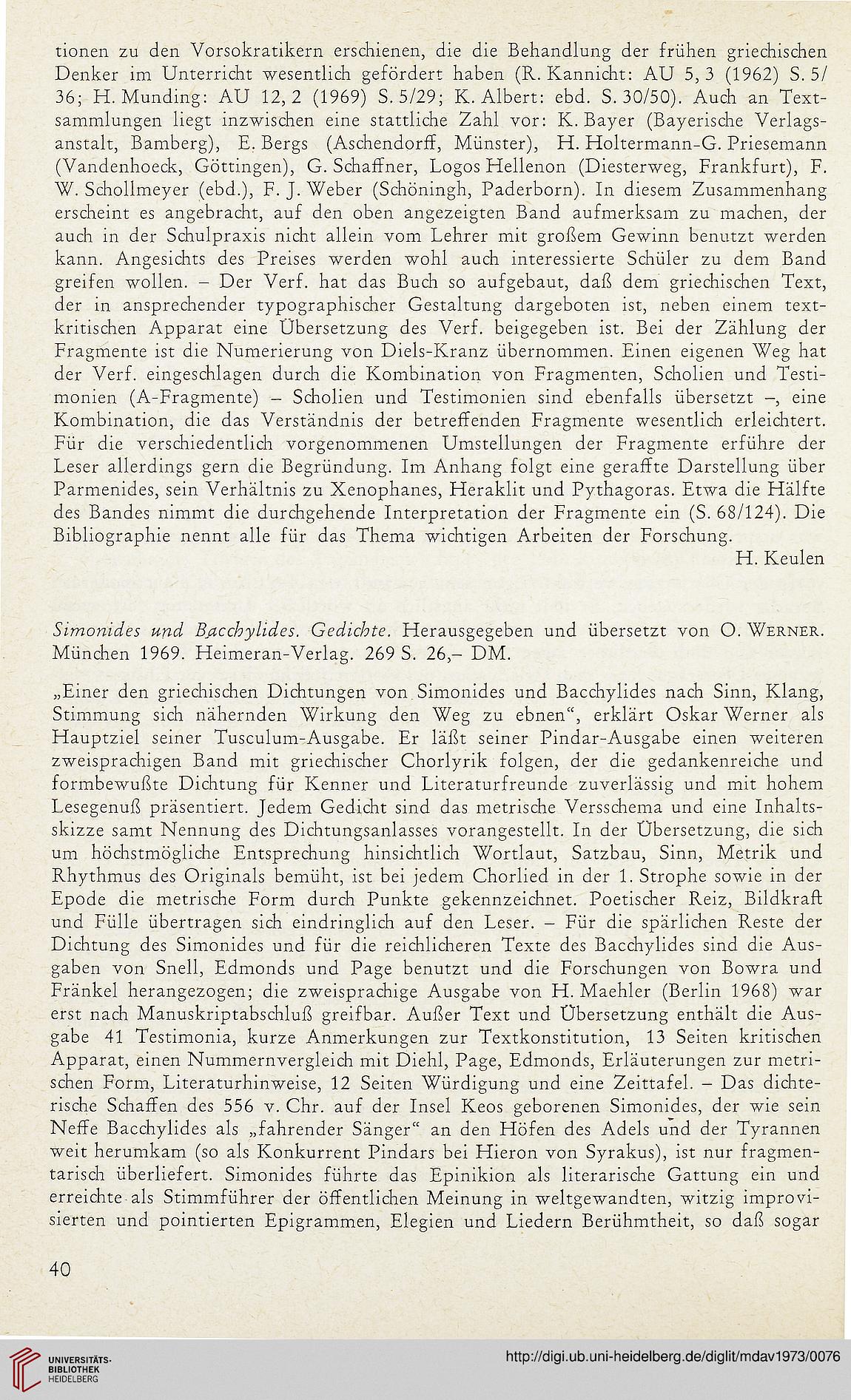tionen zu den Vorsokratikern erschienen, die die Behandlung der frühen griechischen
Denker im Unterricht wesentlich gefördert haben (R. Kannicht: AU 5, 3 (1962) S. 5/
36; H. Munding: AU 12,2 (1969) S. 5/29; K. Albert: ebd. S. 30/50). Auch an Text-
sammlungen liegt inzwischen eine stattliche Zahl vor: K. Bayer (Bayerische Verlags-
anstalt, Bamberg), E. Bergs (Aschendorff, Münster), H. Holtermann-G. Priesemann
(Vandenhoeck, Göttingen), G. Schaffner, Logos Hellenon (Diesterweg, Frankfurt), F.
W. Schollmeyer (ebd.), F. J. Weber (Schöningh, Paderborn). In diesem Zusammenhang
erscheint es angebracht, auf den oben angezeigten Band aufmerksam zu machen, der
auch in der Schulpraxis nicht allein vom Lehrer mit großem Gewinn benutzt werden
kann. Angesichts des Preises werden wohl auch interessierte Schüler zu dem Band
greifen wollen. - Der Verf. hat das Buch so aufgebaut, daß dem griechischen Text,
der in ansprechender typographischer Gestaltung dargeboten ist, neben einem text-
kritischen Apparat eine Übersetzung des Verf. beigegeben ist. Bei der Zählung der
Fragmente ist die Numerierung von Diels-Kranz übernommen. Einen eigenen Weg hat
der Verf. eingeschlagen durch die Kombination von Fragmenten, Scholien und Testi-
monien (A-Fragmente) — Scholien und Testimonien sind ebenfalls übersetzt —, eine
Kombination, die das Verständnis der betreffenden Fragmente wesentlich erleichtert.
Für die verschiedentlich vorgenommenen Umstellungen der Fragmente erführe der
Leser allerdings gern die Begründung. Im Anhang folgt eine geraffte Darstellung über
Parmenides, sein Verhältnis zu Xenophanes, Heraklit und Pythagoras. Etwa die Hälfte
des Bandes nimmt die durchgehende Interpretation der Fragmente ein (S. 68/124). Die
Bibliographie nennt alle für das Thema wichtigen Arbeiten der Forschung.
H. Keulen
Simonides und B_acchylides. Gedichte. Herausgegeben und übersetzt von O. Werner.
München 1969. Heimeran-Verlag. 269 S. 26,- DM.
„Einer den griechischen Dichtungen von Simonides und Bacchylides nach Sinn, Klang,
Stimmung sich nähernden Wirkung den Weg zu ebnen“, erklärt Oskar Werner als
Hauptziel seiner Tusculum-Ausgabe. Er läßt seiner Pindar-Ausgabe einen weiteren
zweisprachigen Band mit griechischer Chorlyrik folgen, der die gedankenreiche und
formbewußte Dichtung für Kenner und Literaturfreunde zuverlässig und mit hohem
Lesegenuß präsentiert. Jedem Gedicht sind das metrische Versschema und eine Inhalts-
skizze samt Nennung des Dichtungsanlasses vorangestellt. In der Übersetzung, die sich
um höchstmögliche Entsprechung hinsichtlich Wortlaut, Satzbau, Sinn, Metrik und
Rhythmus des Originals bemüht, ist bei jedem Chorlied in der 1. Strophe sowie in der
Epode die metrische Form durch Punkte gekennzeichnet. Poetischer Reiz, Bildkraft
und Fülle übertragen sich eindringlich auf den Leser. - Für die spärlichen Reste der
Dichtung des Simonides und für die reichlicheren Texte des Bacchylides sind die Aus-
gaben von Snell, Edmonds und Page benutzt und die Forschungen von Bowra und
Fränkel herangezogen; die zweisprachige Ausgabe von H. Maehler (Berlin 1968) war
erst nach Manuskriptabschluß greifbar. Außer Text und Übersetzung enthält die Aus-
gabe 41 Testimonia, kurze Anmerkungen zur Textkonstitution, 13 Seiten kritischen
Apparat, einen Nummernvergleich mit Diehl, Page, Edmonds, Erläuterungen zur metri-
schen Form, Literaturhinweise, 12 Seiten Würdigung und eine Zeittafel. - Das dichte-
rische Schaffen des 556 v. Chr. auf der Insel Keos geborenen Simonides, der wie sein
Neffe Bacchylides als „fahrender Sänger“ an den Höfen des Adels und der Tyrannen
weit herumkam (so als Konkurrent Pindars bei Hieron von Syrakus), ist nur fragmen-
tarisch überliefert. Simonides führte das Epinikion als literarische Gattung ein und
erreichte als Stimmführer der öffentlichen Meinung in weltgewandten, witzig improvi-
sierten und pointierten Epigrammen, Elegien und Liedern Berühmtheit, so daß sogar
40
Denker im Unterricht wesentlich gefördert haben (R. Kannicht: AU 5, 3 (1962) S. 5/
36; H. Munding: AU 12,2 (1969) S. 5/29; K. Albert: ebd. S. 30/50). Auch an Text-
sammlungen liegt inzwischen eine stattliche Zahl vor: K. Bayer (Bayerische Verlags-
anstalt, Bamberg), E. Bergs (Aschendorff, Münster), H. Holtermann-G. Priesemann
(Vandenhoeck, Göttingen), G. Schaffner, Logos Hellenon (Diesterweg, Frankfurt), F.
W. Schollmeyer (ebd.), F. J. Weber (Schöningh, Paderborn). In diesem Zusammenhang
erscheint es angebracht, auf den oben angezeigten Band aufmerksam zu machen, der
auch in der Schulpraxis nicht allein vom Lehrer mit großem Gewinn benutzt werden
kann. Angesichts des Preises werden wohl auch interessierte Schüler zu dem Band
greifen wollen. - Der Verf. hat das Buch so aufgebaut, daß dem griechischen Text,
der in ansprechender typographischer Gestaltung dargeboten ist, neben einem text-
kritischen Apparat eine Übersetzung des Verf. beigegeben ist. Bei der Zählung der
Fragmente ist die Numerierung von Diels-Kranz übernommen. Einen eigenen Weg hat
der Verf. eingeschlagen durch die Kombination von Fragmenten, Scholien und Testi-
monien (A-Fragmente) — Scholien und Testimonien sind ebenfalls übersetzt —, eine
Kombination, die das Verständnis der betreffenden Fragmente wesentlich erleichtert.
Für die verschiedentlich vorgenommenen Umstellungen der Fragmente erführe der
Leser allerdings gern die Begründung. Im Anhang folgt eine geraffte Darstellung über
Parmenides, sein Verhältnis zu Xenophanes, Heraklit und Pythagoras. Etwa die Hälfte
des Bandes nimmt die durchgehende Interpretation der Fragmente ein (S. 68/124). Die
Bibliographie nennt alle für das Thema wichtigen Arbeiten der Forschung.
H. Keulen
Simonides und B_acchylides. Gedichte. Herausgegeben und übersetzt von O. Werner.
München 1969. Heimeran-Verlag. 269 S. 26,- DM.
„Einer den griechischen Dichtungen von Simonides und Bacchylides nach Sinn, Klang,
Stimmung sich nähernden Wirkung den Weg zu ebnen“, erklärt Oskar Werner als
Hauptziel seiner Tusculum-Ausgabe. Er läßt seiner Pindar-Ausgabe einen weiteren
zweisprachigen Band mit griechischer Chorlyrik folgen, der die gedankenreiche und
formbewußte Dichtung für Kenner und Literaturfreunde zuverlässig und mit hohem
Lesegenuß präsentiert. Jedem Gedicht sind das metrische Versschema und eine Inhalts-
skizze samt Nennung des Dichtungsanlasses vorangestellt. In der Übersetzung, die sich
um höchstmögliche Entsprechung hinsichtlich Wortlaut, Satzbau, Sinn, Metrik und
Rhythmus des Originals bemüht, ist bei jedem Chorlied in der 1. Strophe sowie in der
Epode die metrische Form durch Punkte gekennzeichnet. Poetischer Reiz, Bildkraft
und Fülle übertragen sich eindringlich auf den Leser. - Für die spärlichen Reste der
Dichtung des Simonides und für die reichlicheren Texte des Bacchylides sind die Aus-
gaben von Snell, Edmonds und Page benutzt und die Forschungen von Bowra und
Fränkel herangezogen; die zweisprachige Ausgabe von H. Maehler (Berlin 1968) war
erst nach Manuskriptabschluß greifbar. Außer Text und Übersetzung enthält die Aus-
gabe 41 Testimonia, kurze Anmerkungen zur Textkonstitution, 13 Seiten kritischen
Apparat, einen Nummernvergleich mit Diehl, Page, Edmonds, Erläuterungen zur metri-
schen Form, Literaturhinweise, 12 Seiten Würdigung und eine Zeittafel. - Das dichte-
rische Schaffen des 556 v. Chr. auf der Insel Keos geborenen Simonides, der wie sein
Neffe Bacchylides als „fahrender Sänger“ an den Höfen des Adels und der Tyrannen
weit herumkam (so als Konkurrent Pindars bei Hieron von Syrakus), ist nur fragmen-
tarisch überliefert. Simonides führte das Epinikion als literarische Gattung ein und
erreichte als Stimmführer der öffentlichen Meinung in weltgewandten, witzig improvi-
sierten und pointierten Epigrammen, Elegien und Liedern Berühmtheit, so daß sogar
40