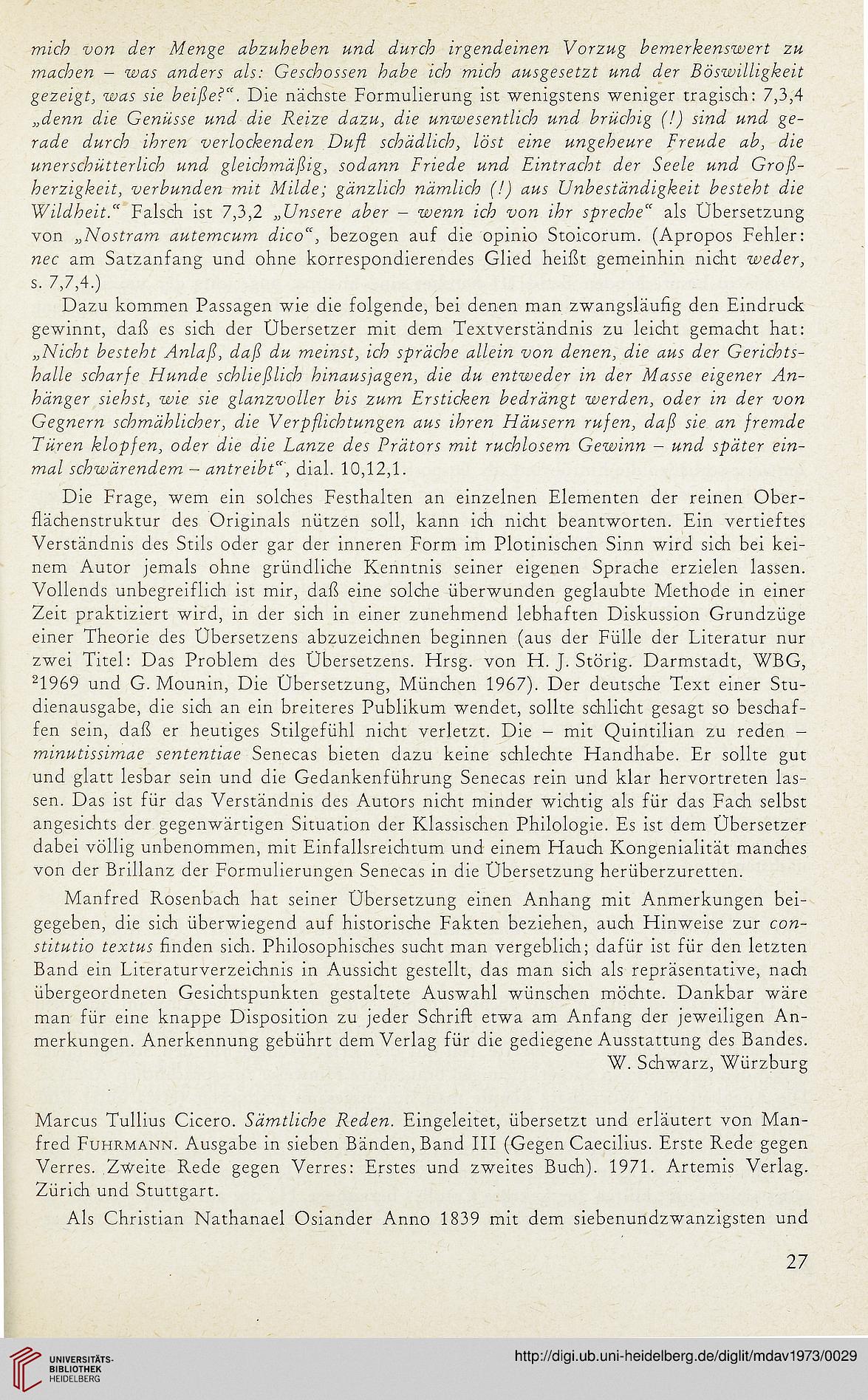mich von der Menge abzuheben und durch irgendeinen Vorzug bemerkenswert zu
machen - was anders als: Geschossen habe ich mich ausgesetzt und der Böswilligkeit
gezeigt, was sie beiße?“. Die nächste Formulierung ist wenigstens weniger tragisch: 7,3,4
„denn die Genüsse und die Reize dazu, die unwesentlich und brüchig (!) sind und ge-
rade durch ihren verlockenden Dufl schädlich, löst eine ungeheure Freude ab, die
unerschütterlich und gleichmäßig, sodann Friede und Eintracht der Seele und Groß-
herzigkeit, verbunden mit Milde; gänzlich nämlich (!) aus Unbeständigkeit besteht die
Wildheit.“ Falsch ist 7,3,2 „Unsere aber - wenn ich von ihr spreche“ als Übersetzung
von „Nostram autemcum dico“, bezogen auf die opinio Stoicorum. (Apropos Fehler:
nec am Satzanfang und ohne korrespondierendes Glied heißt gemeinhin nicht weder,
s. 7,7,4.)
Dazu kommen Passagen wie die folgende, bei denen man zwangsläufig den Eindruck
gewinnt, daß es sich der Übersetzer mit dem Textverständnis zu leicht gemacht hat:
„Nicht besteht Anlaß, daß du meinst, ich spräche allein von denen, die aus der Gerichts-
halle scharfe Hunde schließlich hinausjagen, die du entweder in der Masse eigener An-
hänger siehst, wie sie glanzvoller bis zum Ersticken bedrängt werden, oder in der von
Gegnern schmählicher, die Verpflichtungen aus ihren Häusern rufen, daß sie an fremde
Türen klopfen, oder die die Lanze des Prätors mit ruchlosem Gewinn — und später ein-
mal schwärendem - antreibt“, dial. 10,12,1.
Die Frage, wem ein solches Festhalten an einzelnen Elementen der reinen Ober-
flächenstruktur des Originals nützen soll, kann ich nicht beantworten. Ein vertieftes
Verständnis des Stils oder gar der inneren Form im Plotinischen Sinn wird sich bei kei-
nem Autor jemals ohne gründliche Kenntnis seiner eigenen Sprache erzielen lassen.
Vollends unbegreiflich ist mir, daß eine solche überwunden geglaubte Methode in einer
Zeit praktiziert wird, in der sich in einer zunehmend lebhaften Diskussion Grundzüge
einer Theorie des Ubersetzens abzuzeichnen beginnen (aus der Fülle der Literatur nur
zwei Titel: Das Problem des Übersetzens. Hrsg, von H. J. Störig. Darmstadt, WBG,
21969 und G. Mounin, Die Übersetzung, München 1967). Der deutsche Text einer Stu-
dienausgabe, die sich an ein breiteres Publikum wendet, sollte schlicht gesagt so beschaf-
fen sein, daß er heutiges Stilgefühl nicht verletzt. Die - mit Quintilian zu reden -
minutissimae sententiae Senecas bieten dazu keine schlechte Handhabe. Er sollte gut
und glatt lesbar sein und die Gedankenführung Senecas rein und klar hervortreten las-
sen. Das ist für das Verständnis des Autors nicht minder wichtig als für das Fach selbst
angesichts der gegenwärtigen Situation der Klassischen Philologie. Es ist dem Übersetzer
dabei völlig unbenommen, mit Einfallsreichtum und einem Hauch Kongenialität manches
von der Brillanz der Formulierungen Senecas in die Übersetzung herüberzuretten.
Manfred Rosenbach hat seiner Übersetzung einen Anhang mit Anmerkungen bei-
gegeben, die sich überwiegend auf historische Fakten beziehen, auch Hinweise zur con-
stitutio textus finden sich. Philosophisches sucht man vergeblich; dafür ist für den letzten
Band ein Literaturverzeichnis in Aussicht gestellt, das man sich als repräsentative, nach
übergeordneten Gesichtspunkten gestaltete Auswahl wünschen möchte. Dankbar wäre
man für eine knappe Disposition zu jeder Schrift etwa am Anfang der jeweiligen An-
merkungen. Anerkennung gebührt dem Verlag für die gediegene Ausstattung des Bandes.
W. Schwarz, Würzburg
Marcus Tullius Cicero. Sämtliche Reden. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Man-
fred Fuhrmann. Ausgabe in sieben Bänden, Band III (Gegen Caecilius. Erste Rede gegen
Verres. Zweite Rede gegen Verres: Erstes und zweites Buch). 1971. Artemis Verlag.
Zürich und Stuttgart.
Als Christian Nathanael Osiander Anno 1839 mit dem siebenundzwanzigsten und
27
machen - was anders als: Geschossen habe ich mich ausgesetzt und der Böswilligkeit
gezeigt, was sie beiße?“. Die nächste Formulierung ist wenigstens weniger tragisch: 7,3,4
„denn die Genüsse und die Reize dazu, die unwesentlich und brüchig (!) sind und ge-
rade durch ihren verlockenden Dufl schädlich, löst eine ungeheure Freude ab, die
unerschütterlich und gleichmäßig, sodann Friede und Eintracht der Seele und Groß-
herzigkeit, verbunden mit Milde; gänzlich nämlich (!) aus Unbeständigkeit besteht die
Wildheit.“ Falsch ist 7,3,2 „Unsere aber - wenn ich von ihr spreche“ als Übersetzung
von „Nostram autemcum dico“, bezogen auf die opinio Stoicorum. (Apropos Fehler:
nec am Satzanfang und ohne korrespondierendes Glied heißt gemeinhin nicht weder,
s. 7,7,4.)
Dazu kommen Passagen wie die folgende, bei denen man zwangsläufig den Eindruck
gewinnt, daß es sich der Übersetzer mit dem Textverständnis zu leicht gemacht hat:
„Nicht besteht Anlaß, daß du meinst, ich spräche allein von denen, die aus der Gerichts-
halle scharfe Hunde schließlich hinausjagen, die du entweder in der Masse eigener An-
hänger siehst, wie sie glanzvoller bis zum Ersticken bedrängt werden, oder in der von
Gegnern schmählicher, die Verpflichtungen aus ihren Häusern rufen, daß sie an fremde
Türen klopfen, oder die die Lanze des Prätors mit ruchlosem Gewinn — und später ein-
mal schwärendem - antreibt“, dial. 10,12,1.
Die Frage, wem ein solches Festhalten an einzelnen Elementen der reinen Ober-
flächenstruktur des Originals nützen soll, kann ich nicht beantworten. Ein vertieftes
Verständnis des Stils oder gar der inneren Form im Plotinischen Sinn wird sich bei kei-
nem Autor jemals ohne gründliche Kenntnis seiner eigenen Sprache erzielen lassen.
Vollends unbegreiflich ist mir, daß eine solche überwunden geglaubte Methode in einer
Zeit praktiziert wird, in der sich in einer zunehmend lebhaften Diskussion Grundzüge
einer Theorie des Ubersetzens abzuzeichnen beginnen (aus der Fülle der Literatur nur
zwei Titel: Das Problem des Übersetzens. Hrsg, von H. J. Störig. Darmstadt, WBG,
21969 und G. Mounin, Die Übersetzung, München 1967). Der deutsche Text einer Stu-
dienausgabe, die sich an ein breiteres Publikum wendet, sollte schlicht gesagt so beschaf-
fen sein, daß er heutiges Stilgefühl nicht verletzt. Die - mit Quintilian zu reden -
minutissimae sententiae Senecas bieten dazu keine schlechte Handhabe. Er sollte gut
und glatt lesbar sein und die Gedankenführung Senecas rein und klar hervortreten las-
sen. Das ist für das Verständnis des Autors nicht minder wichtig als für das Fach selbst
angesichts der gegenwärtigen Situation der Klassischen Philologie. Es ist dem Übersetzer
dabei völlig unbenommen, mit Einfallsreichtum und einem Hauch Kongenialität manches
von der Brillanz der Formulierungen Senecas in die Übersetzung herüberzuretten.
Manfred Rosenbach hat seiner Übersetzung einen Anhang mit Anmerkungen bei-
gegeben, die sich überwiegend auf historische Fakten beziehen, auch Hinweise zur con-
stitutio textus finden sich. Philosophisches sucht man vergeblich; dafür ist für den letzten
Band ein Literaturverzeichnis in Aussicht gestellt, das man sich als repräsentative, nach
übergeordneten Gesichtspunkten gestaltete Auswahl wünschen möchte. Dankbar wäre
man für eine knappe Disposition zu jeder Schrift etwa am Anfang der jeweiligen An-
merkungen. Anerkennung gebührt dem Verlag für die gediegene Ausstattung des Bandes.
W. Schwarz, Würzburg
Marcus Tullius Cicero. Sämtliche Reden. Eingeleitet, übersetzt und erläutert von Man-
fred Fuhrmann. Ausgabe in sieben Bänden, Band III (Gegen Caecilius. Erste Rede gegen
Verres. Zweite Rede gegen Verres: Erstes und zweites Buch). 1971. Artemis Verlag.
Zürich und Stuttgart.
Als Christian Nathanael Osiander Anno 1839 mit dem siebenundzwanzigsten und
27