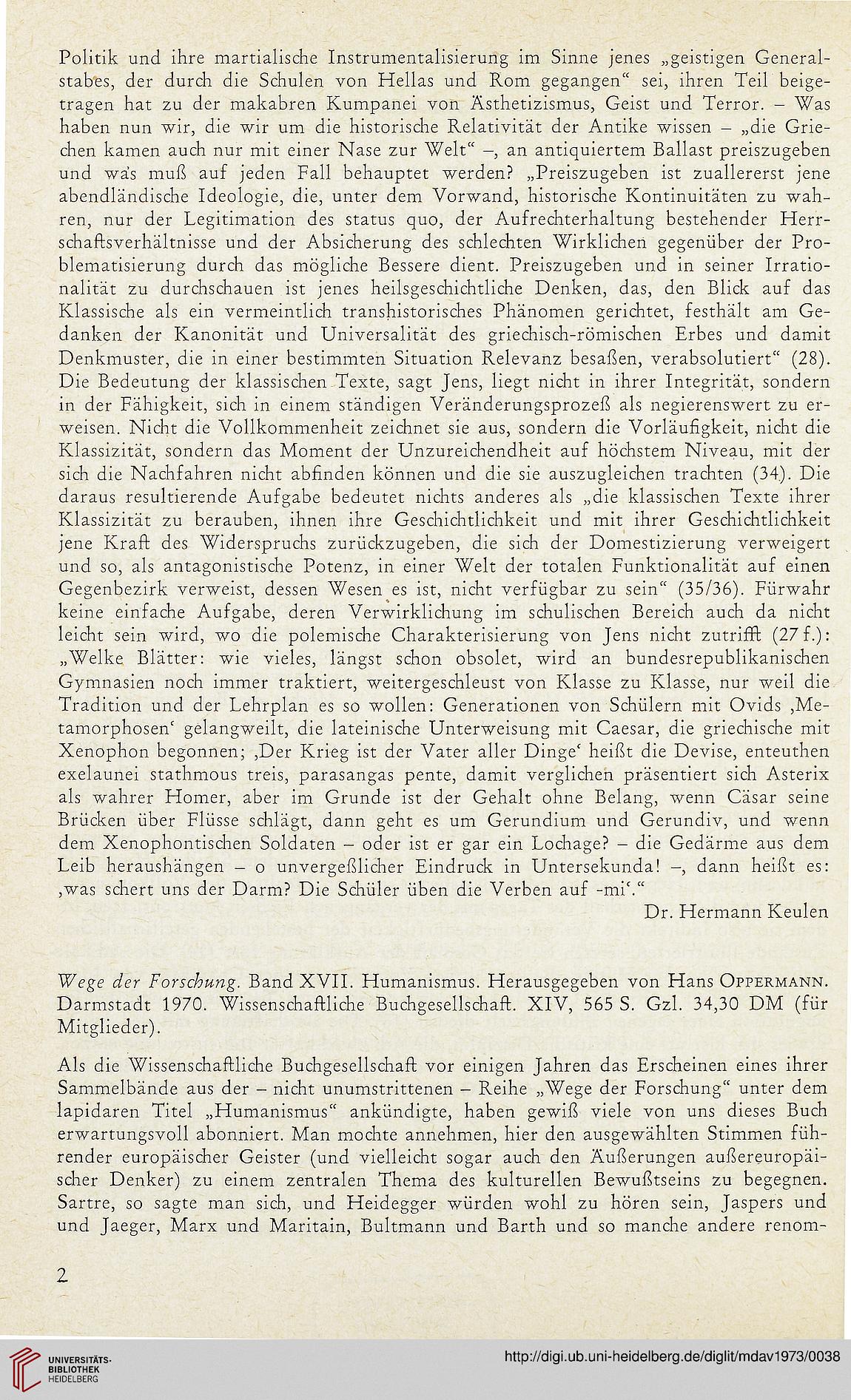Politik und ihre martialische Instrumentalisierung im Sinne jenes „geistigen General-
stabes, der durch die Schulen von Hellas und Rom gegangen“ sei, ihren Teil beige-
tragen hat zu der makabren Kumpanei von Ästhetizismus, Geist und Terror. - Was
haben nun wir, die wir um die historische Relativität der Antike wissen - „die Grie-
chen kamen auch nur mit einer Nase zur Welt" -, an antiquiertem Ballast preiszugeben
und was muß auf jeden Fall behauptet werden? „Preiszugeben ist zuallererst jene
abendländische Ideologie, die, unter dem Vorwand, historische Kontinuitäten zu wah-
ren, nur der Legitimation des Status quo, der Aufrechterhaltung bestehender Herr-
schaftsverhältnisse und der Absicherung des schlechten Wirklichen gegenüber der Pro-
blematisierung durch das mögliche Bessere dient. Preiszugeben und in seiner Irratio-
nalität zu durchschauen ist jenes heilsgeschichtliche Denken, das, den Blick auf das
Klassische als ein vermeintlich transhistorisches Phänomen gerichtet, festhält am Ge-
danken der Kanonität und Universalität des griechisch-römischen Erbes und damit
Denkmuster, die in einer bestimmten Situation Relevanz besaßen, verabsolutiert“ (28).
Die Bedeutung der klassischen Texte, sagt Jens, liegt nicht in ihrer Integrität, sondern
in der Fähigkeit, sich in einem ständigen Veränderungsprozeß als negierenswert zu er-
weisen. Nicht die Vollkommenheit zeichnet sie aus, sondern die Vorläufigkeit, nicht die
Klassizität, sondern das Moment der Unzureichendheit auf höchstem Niveau, mit der
sich die Nachfahren nicht abfinden können und die sie auszugleichen trachten (34.). Die
daraus resultierende Aufgabe bedeutet nichts anderes als „die klassischen Texte ihrer
Klassizität zu berauben, ihnen ihre Geschichtlichkeit und mit ihrer Geschichtlichkeit
jene Kraft des Widerspruchs zurückzugeben, die sich der Domestizierung verweigert
und so, als antagonistische Potenz, in einer Welt der totalen Funktionalität auf einen
Gegenbezirk verweist, dessen Wesen es ist, nicht verfügbar zu sein“ (35/36). Fürwahr
keine einfache Aufgabe, deren Verwirklichung im schulischen Bereich auch da nicht
leicht sein wird, wo die polemische Charakterisierung von Jens nicht zutrifft (27 f.):
„Welke Blätter: wie vieles, längst schon obsolet, wird an bundesrepublikanischen
Gymnasien noch immer traktiert, weitergeschleust von Klasse zu Klasse, nur weil die
Tradition und der Lehrplan es so wollen: Generationen von Schülern mit Ovids ,Me-
tamorphosen' gelangweilt, die lateinische Unterweisung mit Caesar, die griechische mit
Xenophon begonnen; ,Der Krieg ist der Vater aller Dinge' heißt die Devise, enteuthen
exelaunei stathmous treis, parasangas pente, damit verglichen präsentiert sich Asterix
als wahrer Homer, aber im Grunde ist der Gehalt ohne Belang, wenn Cäsar seine
Brücken über Flüsse schlägt, dann geht es um Gerundium und Gerundiv, und wenn
dem Xenophontischen Soldaten - oder ist er gar ein Lochage? - die Gedärme aus dem
Leib heraushängen - o unvergeßlicher Eindruck in Untersekunda! -, dann heißt es:
,was schert uns der Darm? Die Schüler üben die Verben auf -mi‘.“
Dr. Hermann Keulen
Wege der Forschung. Band XVII. Humanismus. Herausgegeben von Hans Oppermann.
Darmstadt 1970. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. XIV, 565 S. Gzl. 34,30 DM (für
Mitglieder).
Als die Wissenschaftliche Buchgesellschaft vor einigen Jahren das Erscheinen eines ihrer
Sammelbände aus der - nicht unumstrittenen - Reihe „Wege der Forschung“ unter dem
lapidaren Titel „Humanismus“ ankündigte, haben gewiß viele von uns dieses Buch
erwartungsvoll abonniert. Man mochte annehmen, hier den ausgewählten Stimmen füh-
render europäischer Geister (und vielleicht sogar auch den Äußerungen außereuropäi-
scher Denker) zu einem zentralen Thema des kulturellen Bewußtseins zu begegnen.
Sartre, so sagte man sich, und Heidegger würden wohl zu hören sein, Jaspers und
und Jaeger, Marx und Maritain, Bultmann und Barth und so manche andere renom-
2
stabes, der durch die Schulen von Hellas und Rom gegangen“ sei, ihren Teil beige-
tragen hat zu der makabren Kumpanei von Ästhetizismus, Geist und Terror. - Was
haben nun wir, die wir um die historische Relativität der Antike wissen - „die Grie-
chen kamen auch nur mit einer Nase zur Welt" -, an antiquiertem Ballast preiszugeben
und was muß auf jeden Fall behauptet werden? „Preiszugeben ist zuallererst jene
abendländische Ideologie, die, unter dem Vorwand, historische Kontinuitäten zu wah-
ren, nur der Legitimation des Status quo, der Aufrechterhaltung bestehender Herr-
schaftsverhältnisse und der Absicherung des schlechten Wirklichen gegenüber der Pro-
blematisierung durch das mögliche Bessere dient. Preiszugeben und in seiner Irratio-
nalität zu durchschauen ist jenes heilsgeschichtliche Denken, das, den Blick auf das
Klassische als ein vermeintlich transhistorisches Phänomen gerichtet, festhält am Ge-
danken der Kanonität und Universalität des griechisch-römischen Erbes und damit
Denkmuster, die in einer bestimmten Situation Relevanz besaßen, verabsolutiert“ (28).
Die Bedeutung der klassischen Texte, sagt Jens, liegt nicht in ihrer Integrität, sondern
in der Fähigkeit, sich in einem ständigen Veränderungsprozeß als negierenswert zu er-
weisen. Nicht die Vollkommenheit zeichnet sie aus, sondern die Vorläufigkeit, nicht die
Klassizität, sondern das Moment der Unzureichendheit auf höchstem Niveau, mit der
sich die Nachfahren nicht abfinden können und die sie auszugleichen trachten (34.). Die
daraus resultierende Aufgabe bedeutet nichts anderes als „die klassischen Texte ihrer
Klassizität zu berauben, ihnen ihre Geschichtlichkeit und mit ihrer Geschichtlichkeit
jene Kraft des Widerspruchs zurückzugeben, die sich der Domestizierung verweigert
und so, als antagonistische Potenz, in einer Welt der totalen Funktionalität auf einen
Gegenbezirk verweist, dessen Wesen es ist, nicht verfügbar zu sein“ (35/36). Fürwahr
keine einfache Aufgabe, deren Verwirklichung im schulischen Bereich auch da nicht
leicht sein wird, wo die polemische Charakterisierung von Jens nicht zutrifft (27 f.):
„Welke Blätter: wie vieles, längst schon obsolet, wird an bundesrepublikanischen
Gymnasien noch immer traktiert, weitergeschleust von Klasse zu Klasse, nur weil die
Tradition und der Lehrplan es so wollen: Generationen von Schülern mit Ovids ,Me-
tamorphosen' gelangweilt, die lateinische Unterweisung mit Caesar, die griechische mit
Xenophon begonnen; ,Der Krieg ist der Vater aller Dinge' heißt die Devise, enteuthen
exelaunei stathmous treis, parasangas pente, damit verglichen präsentiert sich Asterix
als wahrer Homer, aber im Grunde ist der Gehalt ohne Belang, wenn Cäsar seine
Brücken über Flüsse schlägt, dann geht es um Gerundium und Gerundiv, und wenn
dem Xenophontischen Soldaten - oder ist er gar ein Lochage? - die Gedärme aus dem
Leib heraushängen - o unvergeßlicher Eindruck in Untersekunda! -, dann heißt es:
,was schert uns der Darm? Die Schüler üben die Verben auf -mi‘.“
Dr. Hermann Keulen
Wege der Forschung. Band XVII. Humanismus. Herausgegeben von Hans Oppermann.
Darmstadt 1970. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. XIV, 565 S. Gzl. 34,30 DM (für
Mitglieder).
Als die Wissenschaftliche Buchgesellschaft vor einigen Jahren das Erscheinen eines ihrer
Sammelbände aus der - nicht unumstrittenen - Reihe „Wege der Forschung“ unter dem
lapidaren Titel „Humanismus“ ankündigte, haben gewiß viele von uns dieses Buch
erwartungsvoll abonniert. Man mochte annehmen, hier den ausgewählten Stimmen füh-
render europäischer Geister (und vielleicht sogar auch den Äußerungen außereuropäi-
scher Denker) zu einem zentralen Thema des kulturellen Bewußtseins zu begegnen.
Sartre, so sagte man sich, und Heidegger würden wohl zu hören sein, Jaspers und
und Jaeger, Marx und Maritain, Bultmann und Barth und so manche andere renom-
2