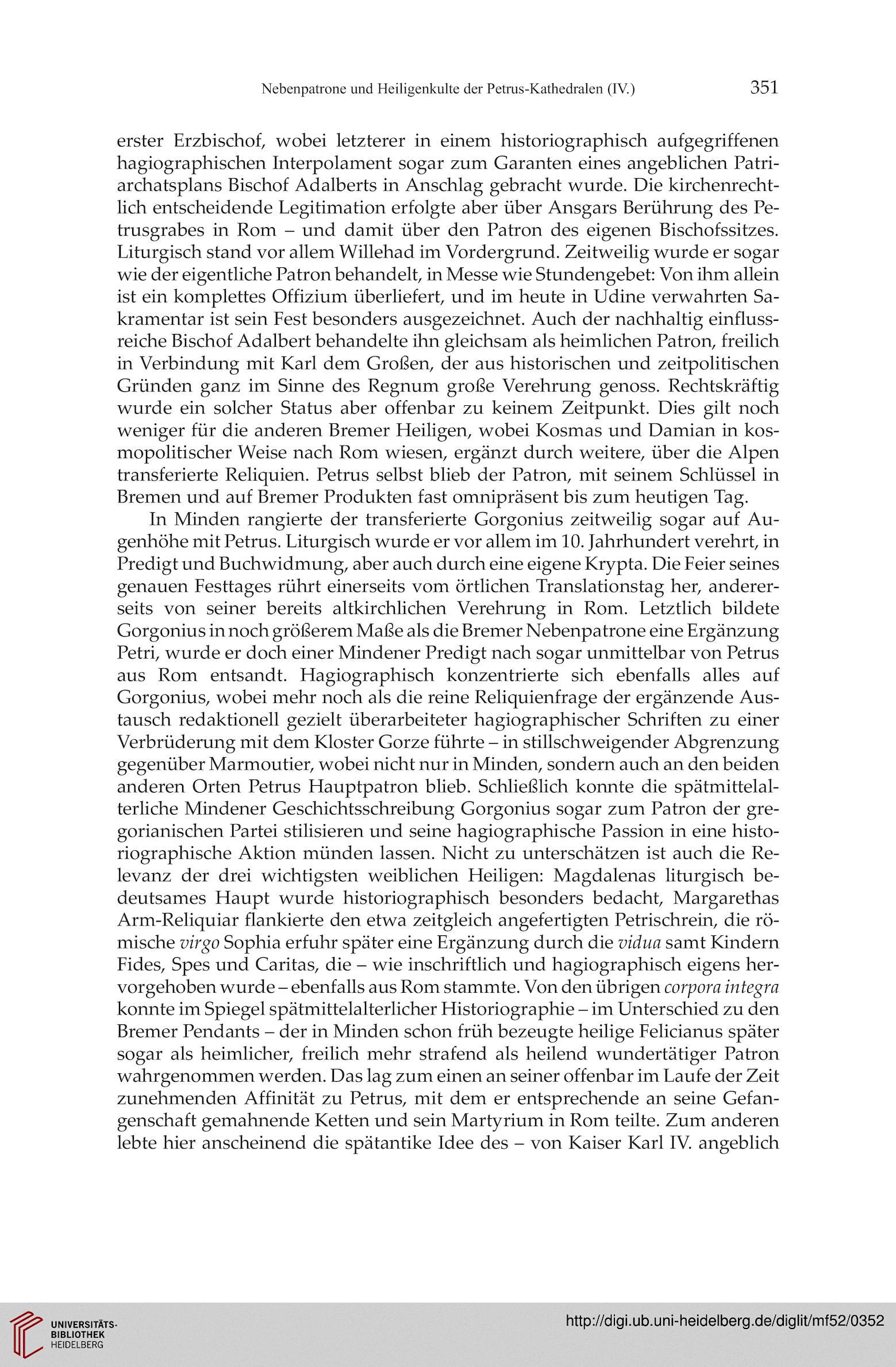Nebenpatrone und Heiligenkulte der Petrus-Kathedralen (IV)
351
erster Erzbischof, wobei letzterer in einem historiographisch aufgegriffenen
hagiographischen Interpolament sogar zum Garanten eines angeblichen Patri-
archatsplans Bischof Adalberts in Anschlag gebracht wurde. Die kirchenrecht-
lich entscheidende Legitimation erfolgte aber über Ansgars Berührung des Pe-
trusgrabes in Rom - und damit über den Patron des eigenen Bischofssitzes.
Liturgisch stand vor allem Willehad im Vordergrund. Zeitweilig wurde er sogar
wie der eigentliche Patron behandelt, in Messe wie Stundengebet: Von ihm allein
ist ein komplettes Offizium überliefert, und im heute in Udine verwahrten Sa-
kramentar ist sein Fest besonders ausgezeichnet. Auch der nachhaltig einfluss-
reiche Bischof Adalbert behandelte ihn gleichsam als heimlichen Patron, freilich
in Verbindung mit Karl dem Großen, der aus historischen und zeitpolitischen
Gründen ganz im Sinne des Regnum große Verehrung genoss. Rechtskräftig
wurde ein solcher Status aber offenbar zu keinem Zeitpunkt. Dies gilt noch
weniger für die anderen Bremer Heiligen, wobei Kosmas und Damian in kos-
mopolitischer Weise nach Rom wiesen, ergänzt durch weitere, über die Alpen
transferierte Reliquien. Petrus selbst blieb der Patron, mit seinem Schlüssel in
Bremen und auf Bremer Produkten fast omnipräsent bis zum heutigen Tag.
In Minden rangierte der transferierte Gorgonius zeitweilig sogar auf Au-
genhöhe mit Petrus. Liturgisch wurde er vor allem im 10. Jahrhundert verehrt, in
Predigt und Buch Widmung, aber auch durch eine eigene Krypta. Die Feier seines
genauen Festtages rührt einerseits vom örtlichen Translationstag her, anderer-
seits von seiner bereits altkirchlichen Verehrung in Rom. Letztlich bildete
Gorgonius in noch größerem Maße als die Bremer Nebenpatrone eine Ergänzung
Petri, wurde er doch einer Mindener Predigt nach sogar unmittelbar von Petrus
aus Rom entsandt. Hagiographisch konzentrierte sich ebenfalls alles auf
Gorgonius, wobei mehr noch als die reine Reliquienfrage der ergänzende Aus-
tausch redaktionell gezielt überarbeiteter hagiographischer Schriften zu einer
Verbrüderung mit dem Kloster Gorze führte - in stillschweigender Abgrenzung
gegenüber Marmoutier, wobei nicht nur in Minden, sondern auch an den beiden
anderen Orten Petrus Hauptpatron blieb. Schließlich konnte die spätmittelal-
terliche Mindener Geschichtsschreibung Gorgonius sogar zum Patron der gre-
gorianischen Partei stilisieren und seine hagiographische Passion in eine histo-
riographische Aktion münden lassen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Re-
levanz der drei wichtigsten weiblichen Heiligen: Magdalenas liturgisch be-
deutsames Haupt wurde historiographisch besonders bedacht, Margarethas
Arm-Reliquiar flankierte den etwa zeitgleich angefertigten Petrischrein, die rö-
mische virgo Sophia erfuhr später eine Ergänzung durch die viduci samt Kindern
Fides, Spes und Caritas, die - wie inschriftlich und hagiographisch eigens her-
vorgehoben wurde - ebenfalls aus Rom stammte. Von den übrigen corpora integra
konnte im Spiegel spätmittelalterlicher Historiographie - im Unterschied zu den
Bremer Pendants - der in Minden schon früh bezeugte heilige Felicianus später
sogar als heimlicher, freilich mehr strafend als heilend wundertätiger Patron
wahrgenommen werden. Das lag zum einen an seiner offenbar im Laufe der Zeit
zunehmenden Affinität zu Petrus, mit dem er entsprechende an seine Gefan-
genschaft gemahnende Ketten und sein Martyrium in Rom teilte. Zum anderen
lebte hier anscheinend die spätantike Idee des - von Kaiser Karl IV. angeblich
351
erster Erzbischof, wobei letzterer in einem historiographisch aufgegriffenen
hagiographischen Interpolament sogar zum Garanten eines angeblichen Patri-
archatsplans Bischof Adalberts in Anschlag gebracht wurde. Die kirchenrecht-
lich entscheidende Legitimation erfolgte aber über Ansgars Berührung des Pe-
trusgrabes in Rom - und damit über den Patron des eigenen Bischofssitzes.
Liturgisch stand vor allem Willehad im Vordergrund. Zeitweilig wurde er sogar
wie der eigentliche Patron behandelt, in Messe wie Stundengebet: Von ihm allein
ist ein komplettes Offizium überliefert, und im heute in Udine verwahrten Sa-
kramentar ist sein Fest besonders ausgezeichnet. Auch der nachhaltig einfluss-
reiche Bischof Adalbert behandelte ihn gleichsam als heimlichen Patron, freilich
in Verbindung mit Karl dem Großen, der aus historischen und zeitpolitischen
Gründen ganz im Sinne des Regnum große Verehrung genoss. Rechtskräftig
wurde ein solcher Status aber offenbar zu keinem Zeitpunkt. Dies gilt noch
weniger für die anderen Bremer Heiligen, wobei Kosmas und Damian in kos-
mopolitischer Weise nach Rom wiesen, ergänzt durch weitere, über die Alpen
transferierte Reliquien. Petrus selbst blieb der Patron, mit seinem Schlüssel in
Bremen und auf Bremer Produkten fast omnipräsent bis zum heutigen Tag.
In Minden rangierte der transferierte Gorgonius zeitweilig sogar auf Au-
genhöhe mit Petrus. Liturgisch wurde er vor allem im 10. Jahrhundert verehrt, in
Predigt und Buch Widmung, aber auch durch eine eigene Krypta. Die Feier seines
genauen Festtages rührt einerseits vom örtlichen Translationstag her, anderer-
seits von seiner bereits altkirchlichen Verehrung in Rom. Letztlich bildete
Gorgonius in noch größerem Maße als die Bremer Nebenpatrone eine Ergänzung
Petri, wurde er doch einer Mindener Predigt nach sogar unmittelbar von Petrus
aus Rom entsandt. Hagiographisch konzentrierte sich ebenfalls alles auf
Gorgonius, wobei mehr noch als die reine Reliquienfrage der ergänzende Aus-
tausch redaktionell gezielt überarbeiteter hagiographischer Schriften zu einer
Verbrüderung mit dem Kloster Gorze führte - in stillschweigender Abgrenzung
gegenüber Marmoutier, wobei nicht nur in Minden, sondern auch an den beiden
anderen Orten Petrus Hauptpatron blieb. Schließlich konnte die spätmittelal-
terliche Mindener Geschichtsschreibung Gorgonius sogar zum Patron der gre-
gorianischen Partei stilisieren und seine hagiographische Passion in eine histo-
riographische Aktion münden lassen. Nicht zu unterschätzen ist auch die Re-
levanz der drei wichtigsten weiblichen Heiligen: Magdalenas liturgisch be-
deutsames Haupt wurde historiographisch besonders bedacht, Margarethas
Arm-Reliquiar flankierte den etwa zeitgleich angefertigten Petrischrein, die rö-
mische virgo Sophia erfuhr später eine Ergänzung durch die viduci samt Kindern
Fides, Spes und Caritas, die - wie inschriftlich und hagiographisch eigens her-
vorgehoben wurde - ebenfalls aus Rom stammte. Von den übrigen corpora integra
konnte im Spiegel spätmittelalterlicher Historiographie - im Unterschied zu den
Bremer Pendants - der in Minden schon früh bezeugte heilige Felicianus später
sogar als heimlicher, freilich mehr strafend als heilend wundertätiger Patron
wahrgenommen werden. Das lag zum einen an seiner offenbar im Laufe der Zeit
zunehmenden Affinität zu Petrus, mit dem er entsprechende an seine Gefan-
genschaft gemahnende Ketten und sein Martyrium in Rom teilte. Zum anderen
lebte hier anscheinend die spätantike Idee des - von Kaiser Karl IV. angeblich