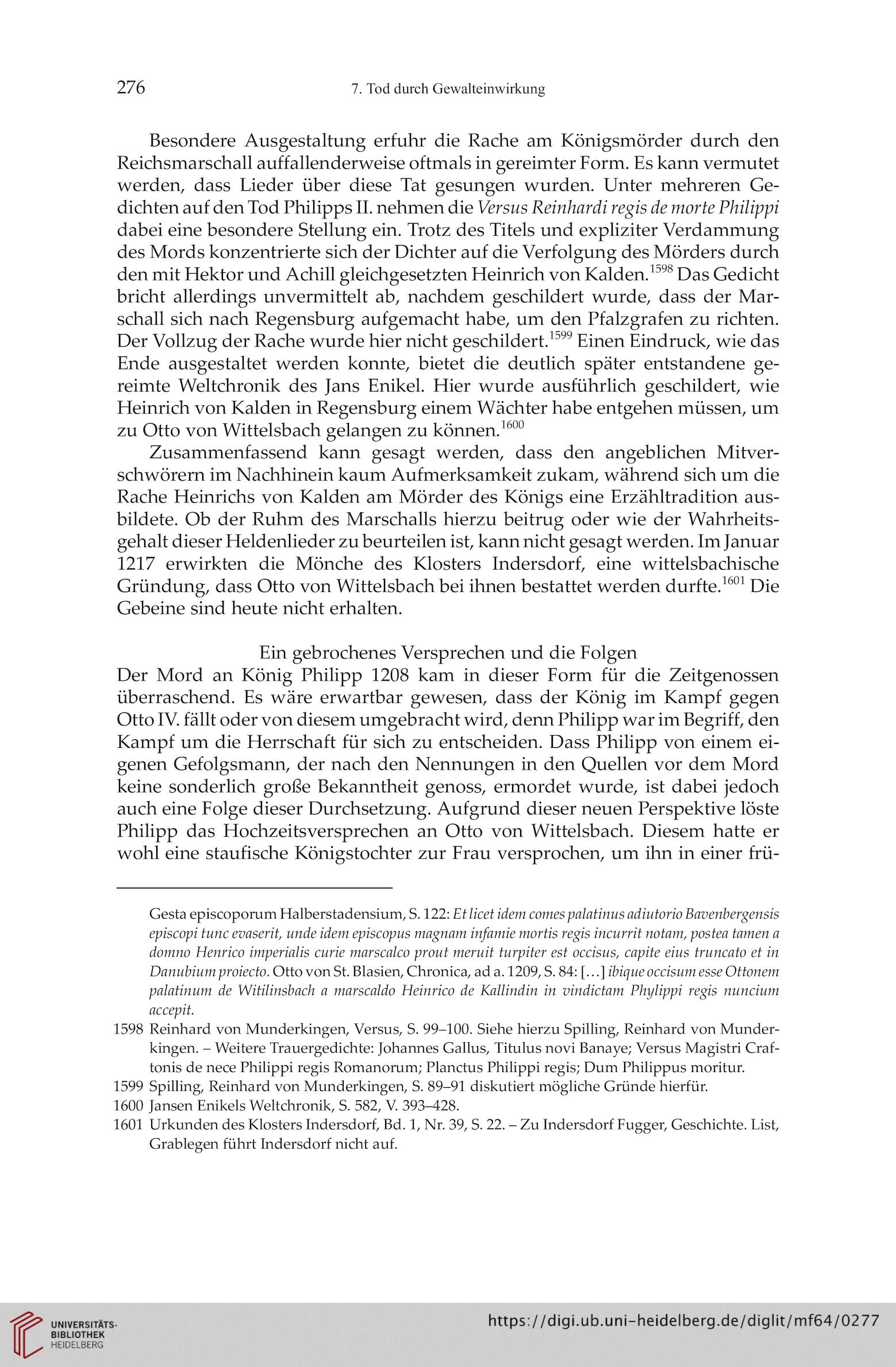276
7. Tod durch Gewalteinwirkung
Besondere Ausgestaltung erfuhr die Rache am Königsmörder durch den
Reichsmarschall auffallenderweise oftmals in gereimter Form. Es kann vermutet
werden, dass Lieder über diese Tat gesungen wurden. Unter mehreren Ge-
dichten auf den Tod Philipps II. nehmen die Versus Reinhardi regis de morte Philippi
dabei eine besondere Stellung ein. Trotz des Titels und expliziter Verdammung
des Mords konzentrierte sich der Dichter auf die Verfolgung des Mörders durch
den mit Hektor und Achill gleichgesetzten Heinrich von Kalden.1598 Das Gedicht
bricht allerdings unvermittelt ab, nachdem geschildert wurde, dass der Mar-
schall sich nach Regensburg aufgemacht habe, um den Pfalzgrafen zu richten.
Der Vollzug der Rache wurde hier nicht geschildert.1599 Einen Eindruck, wie das
Ende ausgestaltet werden konnte, bietet die deutlich später entstandene ge-
reimte Weltchronik des Jans Enikel. Hier wurde ausführlich geschildert, wie
Heinrich von Kalden in Regensburg einem Wächter habe entgehen müssen, um
zu Otto von Wittelsbach gelangen zu können.1600
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den angeblichen Mitver-
schwörern im Nachhinein kaum Aufmerksamkeit zukam, während sich um die
Rache Heinrichs von Kalden am Mörder des Königs eine Erzähltradition aus-
bildete. Ob der Ruhm des Marschalls hierzu beitrug oder wie der Wahrheits-
gehalt dieser Heldenlieder zu beurteilen ist, kann nicht gesagt werden. Im Januar
1217 erwirkten die Mönche des Klosters Indersdorf, eine wittelsbachische
Gründung, dass Otto von Wittelsbach bei ihnen bestattet werden durfte.1601 Die
Gebeine sind heute nicht erhalten.
Ein gebrochenes Versprechen und die Folgen
Der Mord an König Philipp 1208 kam in dieser Form für die Zeitgenossen
überraschend. Es wäre erwartbar gewesen, dass der König im Kampf gegen
Otto IV. fällt oder von diesem umgebracht wird, denn Philipp war im Begriff, den
Kampf um die Herrschaft für sich zu entscheiden. Dass Philipp von einem ei-
genen Gefolgsmann, der nach den Nennungen in den Quellen vor dem Mord
keine sonderlich große Bekanntheit genoss, ermordet wurde, ist dabei jedoch
auch eine Folge dieser Durchsetzung. Aufgrund dieser neuen Perspektive löste
Philipp das Hochzeitsversprechen an Otto von Wittelsbach. Diesem hatte er
wohl eine staufische Königstochter zur Frau versprochen, um ihn in einer frü-
Gesta episcoporum Halberstadensium, S. 122: Et licet idem comes palatinus adiutorio Bavenbergensis
episcopi tune evaserit, unde idem episcopus magnam infamie mortis regis incurrit notam, postea tarnen a
domno Henrico imperialis curie marscalco prout meruit turpiter est occisus, capite eins truncato et in
Danubium proiecto. Otto von St. Blasien, Chronica, ad a. 1209, S. 84: [...] ibique occisum esse Ottonem
palatinum de Witilinsbach a marscaldo Heinrico de Kallindin in vindictam Phylippi regis nuncium
accepit.
1598 Reinhard von Munderkingen, Versus, S. 99-100. Siehe hierzu Spilling, Reinhard von Munder-
kingen. - Weitere Trauergedichte: Johannes Gallus, Titulus novi Banaye; Versus Magistri Craf-
tonis de nece Philippi regis Romanorum; Planctus Philippi regis; Dum Philippus moritur.
1599 Spilling, Reinhard von Munderkingen, S. 89-91 diskutiert mögliche Gründe hierfür.
1600 Jansen Enikels Weltchronik, S. 582, V 393-428.
1601 Urkunden des Klosters Indersdorf, Bd. 1, Nr. 39, S. 22. - Zu Indersdorf Fugger, Geschichte. List,
Grablegen führt Indersdorf nicht auf.
7. Tod durch Gewalteinwirkung
Besondere Ausgestaltung erfuhr die Rache am Königsmörder durch den
Reichsmarschall auffallenderweise oftmals in gereimter Form. Es kann vermutet
werden, dass Lieder über diese Tat gesungen wurden. Unter mehreren Ge-
dichten auf den Tod Philipps II. nehmen die Versus Reinhardi regis de morte Philippi
dabei eine besondere Stellung ein. Trotz des Titels und expliziter Verdammung
des Mords konzentrierte sich der Dichter auf die Verfolgung des Mörders durch
den mit Hektor und Achill gleichgesetzten Heinrich von Kalden.1598 Das Gedicht
bricht allerdings unvermittelt ab, nachdem geschildert wurde, dass der Mar-
schall sich nach Regensburg aufgemacht habe, um den Pfalzgrafen zu richten.
Der Vollzug der Rache wurde hier nicht geschildert.1599 Einen Eindruck, wie das
Ende ausgestaltet werden konnte, bietet die deutlich später entstandene ge-
reimte Weltchronik des Jans Enikel. Hier wurde ausführlich geschildert, wie
Heinrich von Kalden in Regensburg einem Wächter habe entgehen müssen, um
zu Otto von Wittelsbach gelangen zu können.1600
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den angeblichen Mitver-
schwörern im Nachhinein kaum Aufmerksamkeit zukam, während sich um die
Rache Heinrichs von Kalden am Mörder des Königs eine Erzähltradition aus-
bildete. Ob der Ruhm des Marschalls hierzu beitrug oder wie der Wahrheits-
gehalt dieser Heldenlieder zu beurteilen ist, kann nicht gesagt werden. Im Januar
1217 erwirkten die Mönche des Klosters Indersdorf, eine wittelsbachische
Gründung, dass Otto von Wittelsbach bei ihnen bestattet werden durfte.1601 Die
Gebeine sind heute nicht erhalten.
Ein gebrochenes Versprechen und die Folgen
Der Mord an König Philipp 1208 kam in dieser Form für die Zeitgenossen
überraschend. Es wäre erwartbar gewesen, dass der König im Kampf gegen
Otto IV. fällt oder von diesem umgebracht wird, denn Philipp war im Begriff, den
Kampf um die Herrschaft für sich zu entscheiden. Dass Philipp von einem ei-
genen Gefolgsmann, der nach den Nennungen in den Quellen vor dem Mord
keine sonderlich große Bekanntheit genoss, ermordet wurde, ist dabei jedoch
auch eine Folge dieser Durchsetzung. Aufgrund dieser neuen Perspektive löste
Philipp das Hochzeitsversprechen an Otto von Wittelsbach. Diesem hatte er
wohl eine staufische Königstochter zur Frau versprochen, um ihn in einer frü-
Gesta episcoporum Halberstadensium, S. 122: Et licet idem comes palatinus adiutorio Bavenbergensis
episcopi tune evaserit, unde idem episcopus magnam infamie mortis regis incurrit notam, postea tarnen a
domno Henrico imperialis curie marscalco prout meruit turpiter est occisus, capite eins truncato et in
Danubium proiecto. Otto von St. Blasien, Chronica, ad a. 1209, S. 84: [...] ibique occisum esse Ottonem
palatinum de Witilinsbach a marscaldo Heinrico de Kallindin in vindictam Phylippi regis nuncium
accepit.
1598 Reinhard von Munderkingen, Versus, S. 99-100. Siehe hierzu Spilling, Reinhard von Munder-
kingen. - Weitere Trauergedichte: Johannes Gallus, Titulus novi Banaye; Versus Magistri Craf-
tonis de nece Philippi regis Romanorum; Planctus Philippi regis; Dum Philippus moritur.
1599 Spilling, Reinhard von Munderkingen, S. 89-91 diskutiert mögliche Gründe hierfür.
1600 Jansen Enikels Weltchronik, S. 582, V 393-428.
1601 Urkunden des Klosters Indersdorf, Bd. 1, Nr. 39, S. 22. - Zu Indersdorf Fugger, Geschichte. List,
Grablegen führt Indersdorf nicht auf.