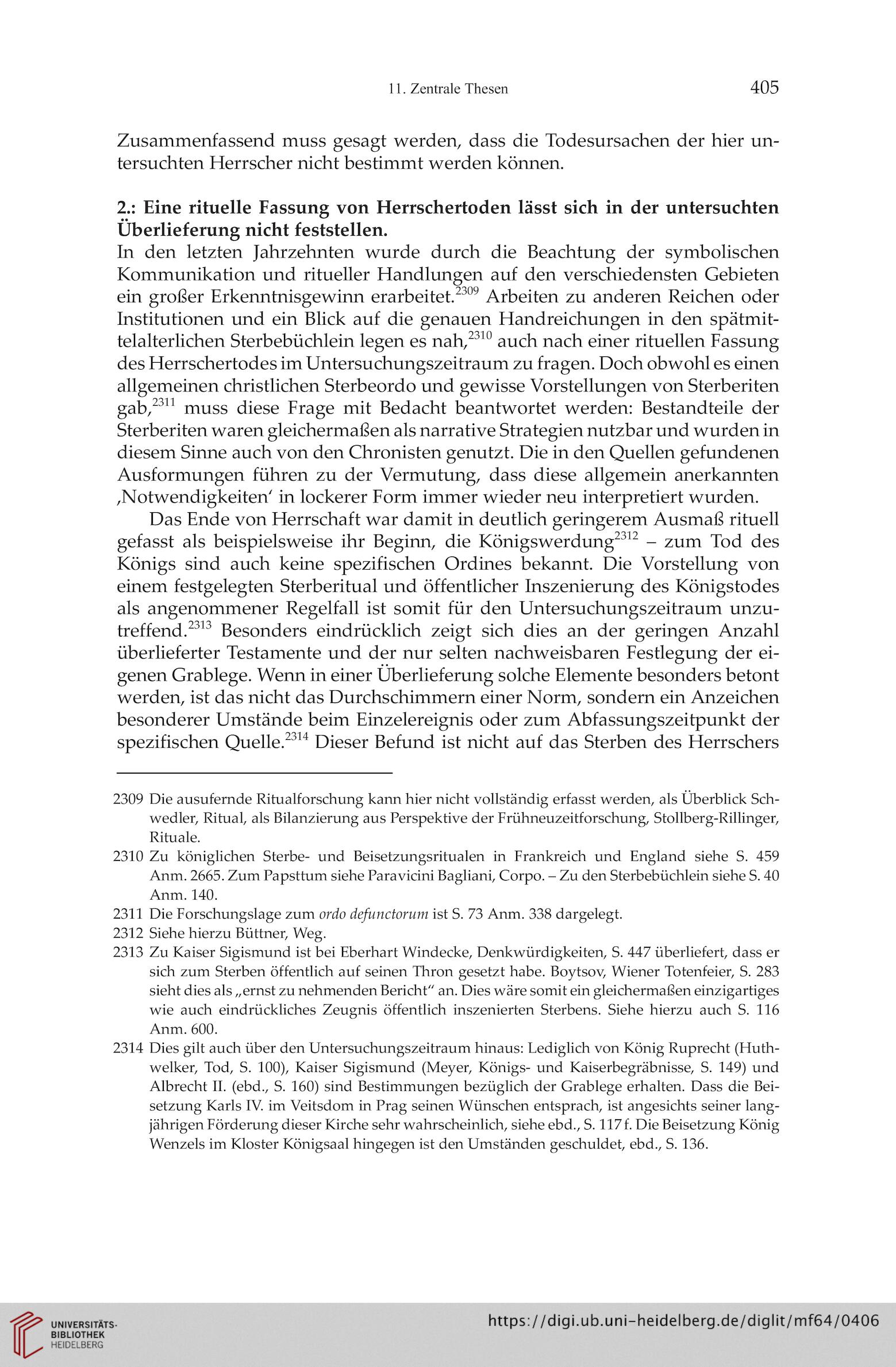11. Zentrale Thesen
405
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Todesursachen der hier un-
tersuchten Herrscher nicht bestimmt werden können.
2.: Eine rituelle Fassung von Herrschertoden lässt sich in der untersuchten
Überlieferung nicht feststellen.
In den letzten Jahrzehnten wurde durch die Beachtung der symbolischen
Kommunikation und ritueller Handlungen auf den verschiedensten Gebieten
ein großer Erkenntnisgewinn erarbeitet.2309 Arbeiten zu anderen Reichen oder
Institutionen und ein Blick auf die genauen Handreichungen in den spätmit-
telalterlichen Sterbebüchlein legen es nah,2310 auch nach einer rituellen Fassung
des Herrschertodes im Untersuchungszeitraum zu fragen. Doch obwohl es einen
allgemeinen christlichen Sterbeordo und gewisse Vorstellungen von Sterberiten
gab,2311 muss diese Frage mit Bedacht beantwortet werden: Bestandteile der
Sterberiten waren gleichermaßen als narrative Strategien nutzbar und wurden in
diesem Sinne auch von den Chronisten genutzt. Die in den Quellen gefundenen
Ausformungen führen zu der Vermutung, dass diese allgemein anerkannten
,Notwendigkeiten' in lockerer Form immer wieder neu interpretiert wurden.
Das Ende von Herrschaft war damit in deutlich geringerem Ausmaß rituell
gefasst als beispielsweise ihr Beginn, die Königswerdung2312 - zum Tod des
Königs sind auch keine spezifischen Ordines bekannt. Die Vorstellung von
einem festgelegten Sterberitual und öffentlicher Inszenierung des Königstodes
als angenommener Regelfall ist somit für den Untersuchungszeitraum unzu-
treffend.2313 Besonders eindrücklich zeigt sich dies an der geringen Anzahl
überlieferter Testamente und der nur selten nachweisbaren Festlegung der ei-
genen Grab lege. Wenn in einer Überlieferung solche Elemente besonders betont
werden, ist das nicht das Durchschimmern einer Norm, sondern ein Anzeichen
besonderer Umstände beim Einzelereignis oder zum Abfassungszeitpunkt der
spezifischen Quelle.2314 Dieser Befund ist nicht auf das Sterben des Herrschers
2309 Die ausufernde Ritualforschung kann hier nicht vollständig erfasst werden, als Überblick Sch-
wedler, Ritual, als Bilanzierung aus Perspektive der Frühneuzeitforschung, Stollberg-Rillinger,
Rituale.
2310 Zu königlichen Sterbe- und Beisetzungsritualen in Frankreich und England siehe S. 459
Anm. 2665. Zum Papsttum siehe Paravicini Bagliani, Corpo. - Zu den Sterbebüchlein siehe S. 40
Anm. 140.
2311 Die Forschungslage zum ordo defunctorum ist S. 73 Anm. 338 dargelegt.
2312 Siehe hierzu Büttner, Weg.
2313 Zu Kaiser Sigismund ist bei Eberhart Windecke, Denkwürdigkeiten, S. 447 überliefert, dass er
sich zum Sterben öffentlich auf seinen Thron gesetzt habe. Boytsov, Wiener Totenfeier, S. 283
sieht dies als „ernst zu nehmenden Bericht" an. Dies wäre somit ein gleichermaßen einzigartiges
wie auch eindrückliches Zeugnis öffentlich inszenierten Sterbens. Siehe hierzu auch S. 116
Anm. 600.
2314 Dies gilt auch über den Untersuchungszeitraum hinaus: Lediglich von König Ruprecht (Huth-
welker, Tod, S. 100), Kaiser Sigismund (Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 149) und
Albrecht II. (ebd., S. 160) sind Bestimmungen bezüglich der Grablege erhalten. Dass die Bei-
setzung Karls IV. im Veitsdom in Prag seinen Wünschen entsprach, ist angesichts seiner lang-
jährigen Förderung dieser Kirche sehr wahrscheinlich, siehe ebd., S. 117 f. Die Beisetzung König
Wenzels im Kloster Königsaal hingegen ist den Umständen geschuldet, ebd., S. 136.
405
Zusammenfassend muss gesagt werden, dass die Todesursachen der hier un-
tersuchten Herrscher nicht bestimmt werden können.
2.: Eine rituelle Fassung von Herrschertoden lässt sich in der untersuchten
Überlieferung nicht feststellen.
In den letzten Jahrzehnten wurde durch die Beachtung der symbolischen
Kommunikation und ritueller Handlungen auf den verschiedensten Gebieten
ein großer Erkenntnisgewinn erarbeitet.2309 Arbeiten zu anderen Reichen oder
Institutionen und ein Blick auf die genauen Handreichungen in den spätmit-
telalterlichen Sterbebüchlein legen es nah,2310 auch nach einer rituellen Fassung
des Herrschertodes im Untersuchungszeitraum zu fragen. Doch obwohl es einen
allgemeinen christlichen Sterbeordo und gewisse Vorstellungen von Sterberiten
gab,2311 muss diese Frage mit Bedacht beantwortet werden: Bestandteile der
Sterberiten waren gleichermaßen als narrative Strategien nutzbar und wurden in
diesem Sinne auch von den Chronisten genutzt. Die in den Quellen gefundenen
Ausformungen führen zu der Vermutung, dass diese allgemein anerkannten
,Notwendigkeiten' in lockerer Form immer wieder neu interpretiert wurden.
Das Ende von Herrschaft war damit in deutlich geringerem Ausmaß rituell
gefasst als beispielsweise ihr Beginn, die Königswerdung2312 - zum Tod des
Königs sind auch keine spezifischen Ordines bekannt. Die Vorstellung von
einem festgelegten Sterberitual und öffentlicher Inszenierung des Königstodes
als angenommener Regelfall ist somit für den Untersuchungszeitraum unzu-
treffend.2313 Besonders eindrücklich zeigt sich dies an der geringen Anzahl
überlieferter Testamente und der nur selten nachweisbaren Festlegung der ei-
genen Grab lege. Wenn in einer Überlieferung solche Elemente besonders betont
werden, ist das nicht das Durchschimmern einer Norm, sondern ein Anzeichen
besonderer Umstände beim Einzelereignis oder zum Abfassungszeitpunkt der
spezifischen Quelle.2314 Dieser Befund ist nicht auf das Sterben des Herrschers
2309 Die ausufernde Ritualforschung kann hier nicht vollständig erfasst werden, als Überblick Sch-
wedler, Ritual, als Bilanzierung aus Perspektive der Frühneuzeitforschung, Stollberg-Rillinger,
Rituale.
2310 Zu königlichen Sterbe- und Beisetzungsritualen in Frankreich und England siehe S. 459
Anm. 2665. Zum Papsttum siehe Paravicini Bagliani, Corpo. - Zu den Sterbebüchlein siehe S. 40
Anm. 140.
2311 Die Forschungslage zum ordo defunctorum ist S. 73 Anm. 338 dargelegt.
2312 Siehe hierzu Büttner, Weg.
2313 Zu Kaiser Sigismund ist bei Eberhart Windecke, Denkwürdigkeiten, S. 447 überliefert, dass er
sich zum Sterben öffentlich auf seinen Thron gesetzt habe. Boytsov, Wiener Totenfeier, S. 283
sieht dies als „ernst zu nehmenden Bericht" an. Dies wäre somit ein gleichermaßen einzigartiges
wie auch eindrückliches Zeugnis öffentlich inszenierten Sterbens. Siehe hierzu auch S. 116
Anm. 600.
2314 Dies gilt auch über den Untersuchungszeitraum hinaus: Lediglich von König Ruprecht (Huth-
welker, Tod, S. 100), Kaiser Sigismund (Meyer, Königs- und Kaiserbegräbnisse, S. 149) und
Albrecht II. (ebd., S. 160) sind Bestimmungen bezüglich der Grablege erhalten. Dass die Bei-
setzung Karls IV. im Veitsdom in Prag seinen Wünschen entsprach, ist angesichts seiner lang-
jährigen Förderung dieser Kirche sehr wahrscheinlich, siehe ebd., S. 117 f. Die Beisetzung König
Wenzels im Kloster Königsaal hingegen ist den Umständen geschuldet, ebd., S. 136.