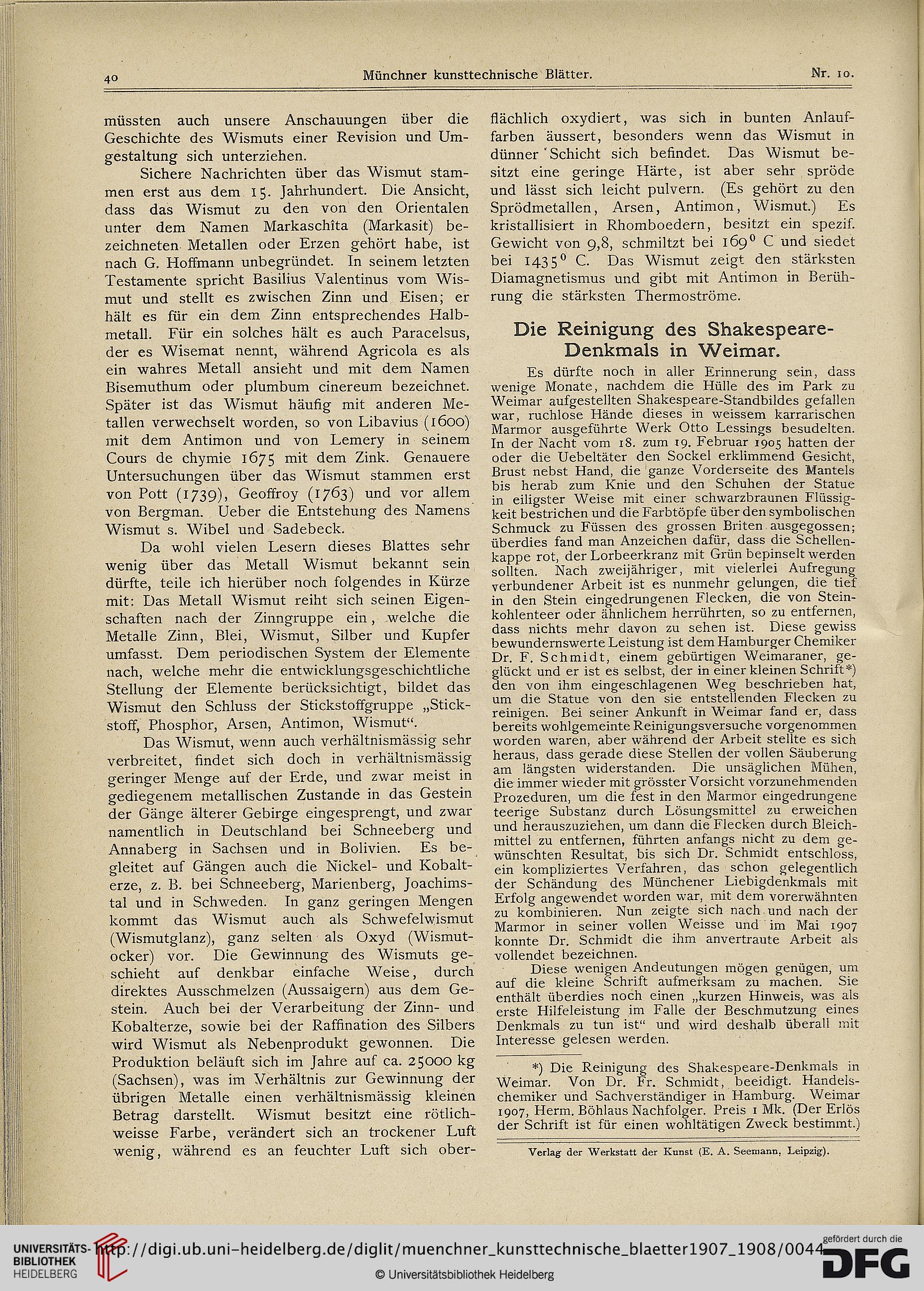40
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. io.
müssten auch unsere Anschauungen über die
Geschichte des Wismuts einer Revision und Um-
gestaltung sich unterziehen.
Sichere Nachrichten über das Wismut stam-
men erst aus dem 15. Jahrhundert. Die Ansicht,
dass das Wismut zu den von den Orientalen
unter dem Namen Markaschita (Markasit) be-
zeichneten Metallen oder Erzen gehört habe, ist
nach G. Hoffmann unbegründet. In seinem letzten
Testamente spricht Basilius Valentinus vom Wis-
mut und stellt es zwischen Zinn und Eisen; er
hält es für ein dem Zinn entsprechendes Halb-
metall. Für ein solches hält es auch Paracelsus,
der es Wisemat nennt, während Agricola es als
ein wahres Metall ansieht und mit dem Namen
Bisemuthum oder plumbum cinereum bezeichnet.
Später ist das Wismut häufig mit anderen Me-
tallen verwechselt worden, so von Libavius (1600)
mit dem Antimon und von Lemery in seinem
Cours de chymie 16)75 mit dem Zink. Genauere
Untersuchungen über das Wismut stammen erst
von Pott (1739), Geoffroy (1763) und vor allem
von Bergman. Ueber die Entstehung des Namens
Wismut s. Wibel und Sadebeck.
Da wohl vielen Lesern dieses Blattes sehr
wenig über das Metall Wismut bekannt sein
dürfte, teile ich hierüber noch folgendes in Kürze
mit: Das Metall Wismut reiht sich seinen Eigen-
schaften nach der Zinngruppe ein, welche die
Metalle Zinn, Blei, Wismut, Silber und Kupfer
umfasst. Dem periodischen System der Elemente
nach, welche mehr die entwicklungsgeschichtliche
Stellung der Elemente berücksichtigt, bildet das
Wismut den Schluss der Stickstoffgruppe „Stick-
stoff, Phosphor, Arsen, Antimon, Wismut".
Das Wismut, wenn auch verhältnismässig sehr
verbreitet, findet sich doch in verhältnismässig
geringer Menge auf der Erde, und zwar meist in
gediegenem metallischen Zustande in das Gestein
der Gänge älterer Gebirge eingesprengt, und zwar
namentlich in Deutschland bei Schneeberg und
Annaberg in Sachsen und in Bolivien. Es be-
gleitet auf Gängen auch die Nickel- und Kobalt-
erze, z. B. bei Schneeberg, Marienberg, Joachims-
tal und in Schweden. In ganz geringen Mengen
kommt das Wismut auch als Schwefelwismut
(Wismutglanz), ganz selten als Oxyd (Wismut-
ocker) vor. Die Gewinnung des Wismuts ge-
schieht auf denkbar einfache Weise, durch
direktes Ausschmelzen (Aussaigern) aus dem Ge-
stein. Auch bei der Verarbeitung der Zinn- und
Kobalterze, sowie bei der Raffination des Silbers
wird Wismut als Nebenprodukt gewonnen. Die
Produktion beläuft sich im Jahre auf ca. 25000 kg
(Sachsen), was im Verhältnis zur Gewinnung der
übrigen Metalle einen verhältnismässig kleinen
Betrag darstellt. Wismut besitzt eine rötlich-
weisse Farbe, verändert sich an trockener Luft
wenig, während es an feuchter Luft sich ober-
flächlich oxydiert, was sich in bunten Anlauf-
farben äussert, besonders wenn das Wismut in
dünner "Schicht sich befindet. Das Wismut be-
sitzt eine geringe Härte, ist aber sehr spröde
und lässt sich leicht pulvern. (Es gehört zu den
Sprödmetallen, Arsen, Antimon, Wismut.) Es
kristallisiert in Rhomboedern, besitzt ein spezif.
Gewicht von 9,8, schmiltzt bei 169" C und siedet
bei 1435° C. Das Wismut zeigt den stärksten
Diamagnetismus und gibt mit Antimon in Berüh-
rung die stärksten Thermoströme.
Die Reinigung des Shakespeare-
Denkmals in Weimar.
Es dürfte noch in affer Erinnerung sein, dass
wenige Monate, nachdem die Hülfe des im Park zu
Weimar aufgestellten Shakespeare-Standbildes gefallen
war, ruchlose Hände dieses in weissem karrarischen
Marmor ausgeführte Werk Otto Lessings besudelten.
In der Nacht vom :8. zum 19. Februar 1905 hatten der
oder die Uebeltäter den Sockel erklimmend Gesicht,
Brust nebst Hand, die ganze Vorderseite des Mantels
bis herab zum Knie und den Schuhen der Statue
in eiligster Weise mit einer schwarzbraunen Flüssig-
keit bestrichen und die Farbtöpfe über den symbolischen
Schmuck zu Füssen des grossen Briten ausgegossen;
überdies fand man Anzeichen dafür, dass die Schellen-
kappe rot, der Lorbeerkranz mit Grün bepinselt werden
sollten. Nach zweijähriger, mit vielerlei Aufregung
verbundener Arbeit ist es nunmehr gelungen, die tief
in den Stein eingedrungenen Flecken, die von Stein-
kohlenteer oder ähnlichem herrührten, so zu entfernen,
dass nichts mehr davon zu sehen ist. Diese gewiss
bewundernswerte Leistung ist dem Hamburger Chemiker
Dr. F. Schmidt, einem gebürtigen Weimaraner, ge-
glückt und er ist es selbst, der in einer kleinen Schrift*)
den von ihm eingeschlagenen Weg beschrieben hat,
um die Statue von den sie entstellenden Flecken zu
reinigen. Bei seiner Ankunft in Weimar fand er, dass
bereits wohlgemeinte Reinigungsversuche vorgenommen
worden waren, aber während der Arbeit stellte es sich
heraus, dass gerade diese Stellen der vollen Säuberung
am längsten widerstanden. Die unsäglichen Mühen,
die immer wieder mit grösster Vorsicht vorzunehmenden
Prozeduren, um die fest in den Marmor eingedrungene
teerige Substanz durch Lösungsmittel zu erweichen
und herauszuziehen, um dann die Flecken durch Bleich-
mittel zu entfernen, führten anfangs nicht zu dem ge-
wünschten Resultat, bis sich Dr. Schmidt entschloss,
ein kompliziertes Verfahren, das schon gelegentlich
der Schändung des Münchener Liebigdenkmals mit
Erfolg angewendet worden war, mit dem vorerwähnten
zu kombinieren. Nun zeigte sich nach und nach der
Marmor in seiner vollen Weisse und im Mai 1907
konnte Dr. Schmidt die ihm anvertraute Arbeit als
vollendet bezeichnen.
Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um
auf die kleine Schrift aufmerksam zu machen. Sie
enthält überdies noch einen „kurzen Hinweis, was als
erste Hilfeleistung im Falle der Beschmutzung eines
Denkmals zu tun ist" und wird deshalb überall mit
Interesse gelesen werden.
*) Die Reinigung des Shakespeare-Denkmals in
Weimar. Von Dr. Fr. Schmidt, beeidigt. Handeis-
chemiker und Sachverständiger in Hamburg. Weimar
1907, Herrn. Böhlaus Nachfolger. Preis rMk. (Der Erlös
der Schrift ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt.)
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. io.
müssten auch unsere Anschauungen über die
Geschichte des Wismuts einer Revision und Um-
gestaltung sich unterziehen.
Sichere Nachrichten über das Wismut stam-
men erst aus dem 15. Jahrhundert. Die Ansicht,
dass das Wismut zu den von den Orientalen
unter dem Namen Markaschita (Markasit) be-
zeichneten Metallen oder Erzen gehört habe, ist
nach G. Hoffmann unbegründet. In seinem letzten
Testamente spricht Basilius Valentinus vom Wis-
mut und stellt es zwischen Zinn und Eisen; er
hält es für ein dem Zinn entsprechendes Halb-
metall. Für ein solches hält es auch Paracelsus,
der es Wisemat nennt, während Agricola es als
ein wahres Metall ansieht und mit dem Namen
Bisemuthum oder plumbum cinereum bezeichnet.
Später ist das Wismut häufig mit anderen Me-
tallen verwechselt worden, so von Libavius (1600)
mit dem Antimon und von Lemery in seinem
Cours de chymie 16)75 mit dem Zink. Genauere
Untersuchungen über das Wismut stammen erst
von Pott (1739), Geoffroy (1763) und vor allem
von Bergman. Ueber die Entstehung des Namens
Wismut s. Wibel und Sadebeck.
Da wohl vielen Lesern dieses Blattes sehr
wenig über das Metall Wismut bekannt sein
dürfte, teile ich hierüber noch folgendes in Kürze
mit: Das Metall Wismut reiht sich seinen Eigen-
schaften nach der Zinngruppe ein, welche die
Metalle Zinn, Blei, Wismut, Silber und Kupfer
umfasst. Dem periodischen System der Elemente
nach, welche mehr die entwicklungsgeschichtliche
Stellung der Elemente berücksichtigt, bildet das
Wismut den Schluss der Stickstoffgruppe „Stick-
stoff, Phosphor, Arsen, Antimon, Wismut".
Das Wismut, wenn auch verhältnismässig sehr
verbreitet, findet sich doch in verhältnismässig
geringer Menge auf der Erde, und zwar meist in
gediegenem metallischen Zustande in das Gestein
der Gänge älterer Gebirge eingesprengt, und zwar
namentlich in Deutschland bei Schneeberg und
Annaberg in Sachsen und in Bolivien. Es be-
gleitet auf Gängen auch die Nickel- und Kobalt-
erze, z. B. bei Schneeberg, Marienberg, Joachims-
tal und in Schweden. In ganz geringen Mengen
kommt das Wismut auch als Schwefelwismut
(Wismutglanz), ganz selten als Oxyd (Wismut-
ocker) vor. Die Gewinnung des Wismuts ge-
schieht auf denkbar einfache Weise, durch
direktes Ausschmelzen (Aussaigern) aus dem Ge-
stein. Auch bei der Verarbeitung der Zinn- und
Kobalterze, sowie bei der Raffination des Silbers
wird Wismut als Nebenprodukt gewonnen. Die
Produktion beläuft sich im Jahre auf ca. 25000 kg
(Sachsen), was im Verhältnis zur Gewinnung der
übrigen Metalle einen verhältnismässig kleinen
Betrag darstellt. Wismut besitzt eine rötlich-
weisse Farbe, verändert sich an trockener Luft
wenig, während es an feuchter Luft sich ober-
flächlich oxydiert, was sich in bunten Anlauf-
farben äussert, besonders wenn das Wismut in
dünner "Schicht sich befindet. Das Wismut be-
sitzt eine geringe Härte, ist aber sehr spröde
und lässt sich leicht pulvern. (Es gehört zu den
Sprödmetallen, Arsen, Antimon, Wismut.) Es
kristallisiert in Rhomboedern, besitzt ein spezif.
Gewicht von 9,8, schmiltzt bei 169" C und siedet
bei 1435° C. Das Wismut zeigt den stärksten
Diamagnetismus und gibt mit Antimon in Berüh-
rung die stärksten Thermoströme.
Die Reinigung des Shakespeare-
Denkmals in Weimar.
Es dürfte noch in affer Erinnerung sein, dass
wenige Monate, nachdem die Hülfe des im Park zu
Weimar aufgestellten Shakespeare-Standbildes gefallen
war, ruchlose Hände dieses in weissem karrarischen
Marmor ausgeführte Werk Otto Lessings besudelten.
In der Nacht vom :8. zum 19. Februar 1905 hatten der
oder die Uebeltäter den Sockel erklimmend Gesicht,
Brust nebst Hand, die ganze Vorderseite des Mantels
bis herab zum Knie und den Schuhen der Statue
in eiligster Weise mit einer schwarzbraunen Flüssig-
keit bestrichen und die Farbtöpfe über den symbolischen
Schmuck zu Füssen des grossen Briten ausgegossen;
überdies fand man Anzeichen dafür, dass die Schellen-
kappe rot, der Lorbeerkranz mit Grün bepinselt werden
sollten. Nach zweijähriger, mit vielerlei Aufregung
verbundener Arbeit ist es nunmehr gelungen, die tief
in den Stein eingedrungenen Flecken, die von Stein-
kohlenteer oder ähnlichem herrührten, so zu entfernen,
dass nichts mehr davon zu sehen ist. Diese gewiss
bewundernswerte Leistung ist dem Hamburger Chemiker
Dr. F. Schmidt, einem gebürtigen Weimaraner, ge-
glückt und er ist es selbst, der in einer kleinen Schrift*)
den von ihm eingeschlagenen Weg beschrieben hat,
um die Statue von den sie entstellenden Flecken zu
reinigen. Bei seiner Ankunft in Weimar fand er, dass
bereits wohlgemeinte Reinigungsversuche vorgenommen
worden waren, aber während der Arbeit stellte es sich
heraus, dass gerade diese Stellen der vollen Säuberung
am längsten widerstanden. Die unsäglichen Mühen,
die immer wieder mit grösster Vorsicht vorzunehmenden
Prozeduren, um die fest in den Marmor eingedrungene
teerige Substanz durch Lösungsmittel zu erweichen
und herauszuziehen, um dann die Flecken durch Bleich-
mittel zu entfernen, führten anfangs nicht zu dem ge-
wünschten Resultat, bis sich Dr. Schmidt entschloss,
ein kompliziertes Verfahren, das schon gelegentlich
der Schändung des Münchener Liebigdenkmals mit
Erfolg angewendet worden war, mit dem vorerwähnten
zu kombinieren. Nun zeigte sich nach und nach der
Marmor in seiner vollen Weisse und im Mai 1907
konnte Dr. Schmidt die ihm anvertraute Arbeit als
vollendet bezeichnen.
Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um
auf die kleine Schrift aufmerksam zu machen. Sie
enthält überdies noch einen „kurzen Hinweis, was als
erste Hilfeleistung im Falle der Beschmutzung eines
Denkmals zu tun ist" und wird deshalb überall mit
Interesse gelesen werden.
*) Die Reinigung des Shakespeare-Denkmals in
Weimar. Von Dr. Fr. Schmidt, beeidigt. Handeis-
chemiker und Sachverständiger in Hamburg. Weimar
1907, Herrn. Böhlaus Nachfolger. Preis rMk. (Der Erlös
der Schrift ist für einen wohltätigen Zweck bestimmt.)