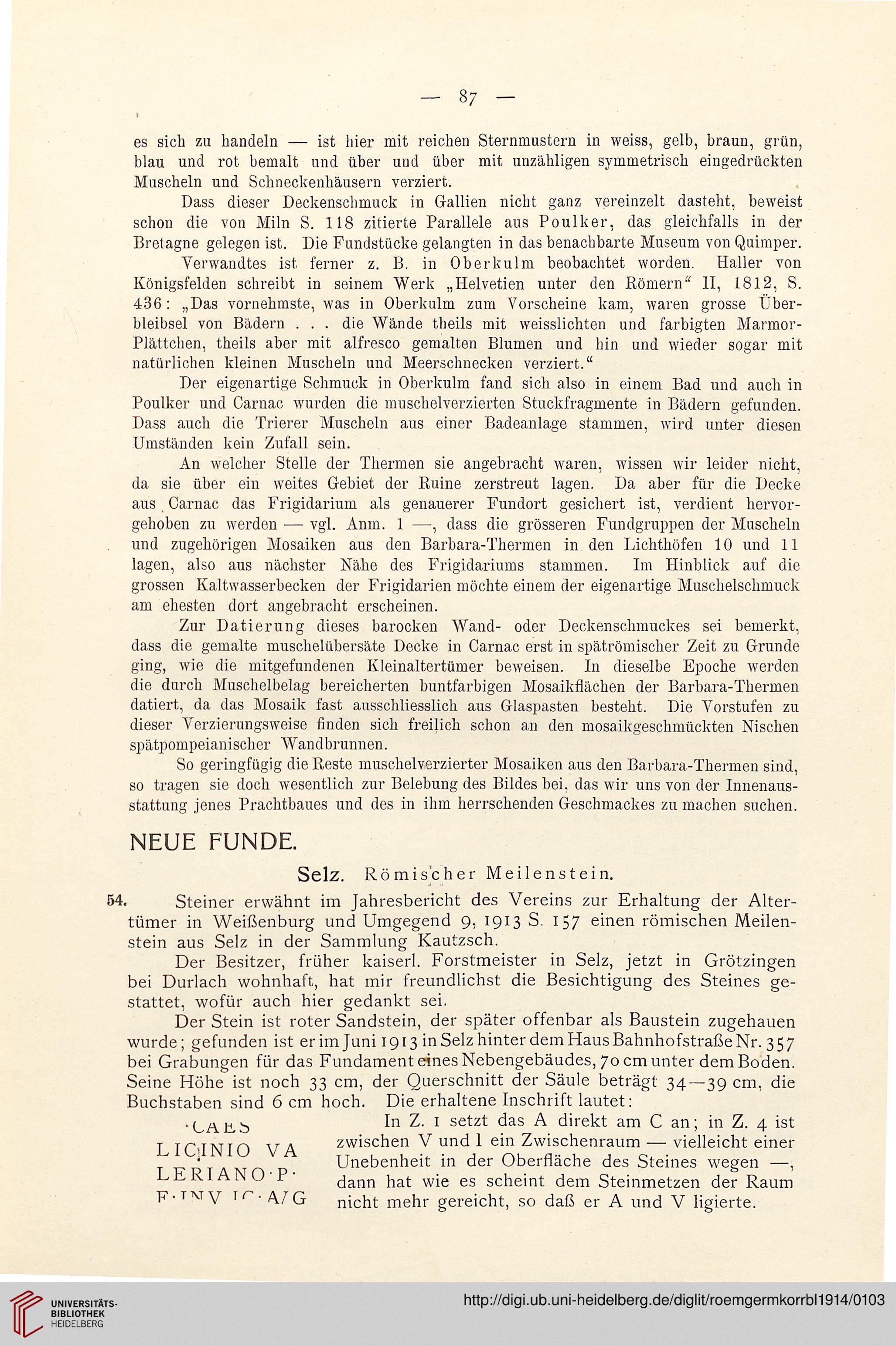§7
es sich zu handeln — ist hier mit reichen Sternmustern in weiss, gelb, braun, grün,
blau und rot bemalt und über und über mit unzähligen symmetrisch eingedrückten
Muscheln und Schneckenhäusern verziert.
Dass dieser Deckenschmuck in Gallien nicht ganz vereinzelt dasteht, beweist
schon die von Miln S. 118 zitierte Parallele aus Poulker, das gleichfalls in der
Bretagne gelegen ist. Die Fundstücke gelangten in das benachbarte Museum von Quimper.
Verwandtes ist ferner z. B. in Oberkulm beobachtet worden. Haller von
Königsfelden schreibt in seinem Werk „Helvetien unter den Römern“ II, 1812, S.
436: „Das vornehmste, was in Oberkulm zum Vorscheine kam, waren grosse Über-
bleibsel von Bädern ... die Wände theils mit weisslichten und farbigten Marmor-
Plättchen, theils aber mit alfresco gemalten Blumen und hin und wieder sogar mit
natürlichen kleinen Muscheln und Meerschnecken verziert.“
Der eigenartige Schmuck in Oberkulm fand sich also in einem Bad und auch in
Poulker und Carnac wurden die muschelverzierten Stuckfragmente in Bädern gefunden.
Dass auch die Trierer Muscheln aus einer Badeanlage stammen, wird unter diesen
Umständen kein Zufall sein.
An welcher Stelle der Thermen sie angebracht waren, wissen wir leider nicht,
da sie über ein weites Gebiet der Ruine zerstreut lagen. Da aber für die Decke
aus Carnac das Frigidarium als genauerer Fundort gesichert ist, verdient hervor-
gehoben zu werden — vgl. Anm. 1 —, dass die grösseren Fundgruppen der Muscheln
und zugehörigen Mosaiken aus den Barbara-Thermen in den Lichthöfen 10 und 11
lagen, also aus nächster Nähe des Frigidariums stammen. Im Hinblick auf die
grossen Kaltwasserbecken der Frigidarien möchte einem der eigenartige Muschelschmuck
am ehesten dort angebracht erscheinen.
Zur Datierung dieses barocken Wand- oder Deckenschmuckes sei bemerkt,
dass die gemalte muschelübersäte Decke in Carnac erst in spätrömischer Zeit zu Grunde
ging, wie die mitgefundenen Kleinaltertümer beweisen. In dieselbe Epoche werden
die durch Muschelbelag bereicherten buntfarbigen Mosaikflächen der Barbara-Thermen
datiert, da das Mosaik fast ausschliesslich aus Glaspasten besteht. Die Vorstufen zu
dieser Verzierungsweise finden sich freilich schon an den mosaikgeschmückten Nischen
spätpompeianischer Wandbrunnen.
So geringfügig die Reste muschelverzierter Mosaiken aus den Barbara-Thermen sind,
so tragen sie doch wesentlich zur Belebung des Bildes bei, das wir uns von der Innenaus-
stattung jenes Prachtbaues und des in ihm herrschenden Geschmackes zu machen suchen.
NEUE FUNDE.
Selz. Römischer Meilenstein.
54. Steiner erwähnt im Jahresbericht des Vereins zur Erhaltung der Alter-
tümer in Weißenburg und Umgegend 9, 1913 S. 157 einen römischen Meilen-
stein aus Selz in der Sammlung Kautzsch.
Der Besitzer, früher kaiserl. Forstmeister in Selz, jetzt in Grötzingen
bei Durlach wohnhaft, hat mir freundlichst die Besichtigung des Steines ge-
stattet, wofür auch hier gedankt sei.
Der Stein ist roter Sandstein, der später offenbar als Baustein zugehauen
wurde; gefunden ist er im Juni 1913 in Selz hinter dem Haus Bahnhofstraße Nr. 357
bei Grabungen für das Fundament eines Nebengebäudes, 70 cm unter dem Boden.
Seine Höhe ist noch 33 cm, der Querschnitt der Säule beträgt 34—39 cm, die
Buchstaben sind 6 cm hoch. Die erhaltene Inschrift lautet:
•UAKb In 1 setzt das A direkt am C an; in Z. 4 ist
LIC'INIO VA zwischen V und 1 ein Zwischenraum — vielleicht einer
‘ Unebenheit in der Oberfläche des Steines wegen —,
LE RI AN O P dann hat wie es scheint dem Steinmetzen der Raum
I7' ™ V ir- A/G nicht mehr gereicht, so daß er A und V ligierte.
es sich zu handeln — ist hier mit reichen Sternmustern in weiss, gelb, braun, grün,
blau und rot bemalt und über und über mit unzähligen symmetrisch eingedrückten
Muscheln und Schneckenhäusern verziert.
Dass dieser Deckenschmuck in Gallien nicht ganz vereinzelt dasteht, beweist
schon die von Miln S. 118 zitierte Parallele aus Poulker, das gleichfalls in der
Bretagne gelegen ist. Die Fundstücke gelangten in das benachbarte Museum von Quimper.
Verwandtes ist ferner z. B. in Oberkulm beobachtet worden. Haller von
Königsfelden schreibt in seinem Werk „Helvetien unter den Römern“ II, 1812, S.
436: „Das vornehmste, was in Oberkulm zum Vorscheine kam, waren grosse Über-
bleibsel von Bädern ... die Wände theils mit weisslichten und farbigten Marmor-
Plättchen, theils aber mit alfresco gemalten Blumen und hin und wieder sogar mit
natürlichen kleinen Muscheln und Meerschnecken verziert.“
Der eigenartige Schmuck in Oberkulm fand sich also in einem Bad und auch in
Poulker und Carnac wurden die muschelverzierten Stuckfragmente in Bädern gefunden.
Dass auch die Trierer Muscheln aus einer Badeanlage stammen, wird unter diesen
Umständen kein Zufall sein.
An welcher Stelle der Thermen sie angebracht waren, wissen wir leider nicht,
da sie über ein weites Gebiet der Ruine zerstreut lagen. Da aber für die Decke
aus Carnac das Frigidarium als genauerer Fundort gesichert ist, verdient hervor-
gehoben zu werden — vgl. Anm. 1 —, dass die grösseren Fundgruppen der Muscheln
und zugehörigen Mosaiken aus den Barbara-Thermen in den Lichthöfen 10 und 11
lagen, also aus nächster Nähe des Frigidariums stammen. Im Hinblick auf die
grossen Kaltwasserbecken der Frigidarien möchte einem der eigenartige Muschelschmuck
am ehesten dort angebracht erscheinen.
Zur Datierung dieses barocken Wand- oder Deckenschmuckes sei bemerkt,
dass die gemalte muschelübersäte Decke in Carnac erst in spätrömischer Zeit zu Grunde
ging, wie die mitgefundenen Kleinaltertümer beweisen. In dieselbe Epoche werden
die durch Muschelbelag bereicherten buntfarbigen Mosaikflächen der Barbara-Thermen
datiert, da das Mosaik fast ausschliesslich aus Glaspasten besteht. Die Vorstufen zu
dieser Verzierungsweise finden sich freilich schon an den mosaikgeschmückten Nischen
spätpompeianischer Wandbrunnen.
So geringfügig die Reste muschelverzierter Mosaiken aus den Barbara-Thermen sind,
so tragen sie doch wesentlich zur Belebung des Bildes bei, das wir uns von der Innenaus-
stattung jenes Prachtbaues und des in ihm herrschenden Geschmackes zu machen suchen.
NEUE FUNDE.
Selz. Römischer Meilenstein.
54. Steiner erwähnt im Jahresbericht des Vereins zur Erhaltung der Alter-
tümer in Weißenburg und Umgegend 9, 1913 S. 157 einen römischen Meilen-
stein aus Selz in der Sammlung Kautzsch.
Der Besitzer, früher kaiserl. Forstmeister in Selz, jetzt in Grötzingen
bei Durlach wohnhaft, hat mir freundlichst die Besichtigung des Steines ge-
stattet, wofür auch hier gedankt sei.
Der Stein ist roter Sandstein, der später offenbar als Baustein zugehauen
wurde; gefunden ist er im Juni 1913 in Selz hinter dem Haus Bahnhofstraße Nr. 357
bei Grabungen für das Fundament eines Nebengebäudes, 70 cm unter dem Boden.
Seine Höhe ist noch 33 cm, der Querschnitt der Säule beträgt 34—39 cm, die
Buchstaben sind 6 cm hoch. Die erhaltene Inschrift lautet:
•UAKb In 1 setzt das A direkt am C an; in Z. 4 ist
LIC'INIO VA zwischen V und 1 ein Zwischenraum — vielleicht einer
‘ Unebenheit in der Oberfläche des Steines wegen —,
LE RI AN O P dann hat wie es scheint dem Steinmetzen der Raum
I7' ™ V ir- A/G nicht mehr gereicht, so daß er A und V ligierte.