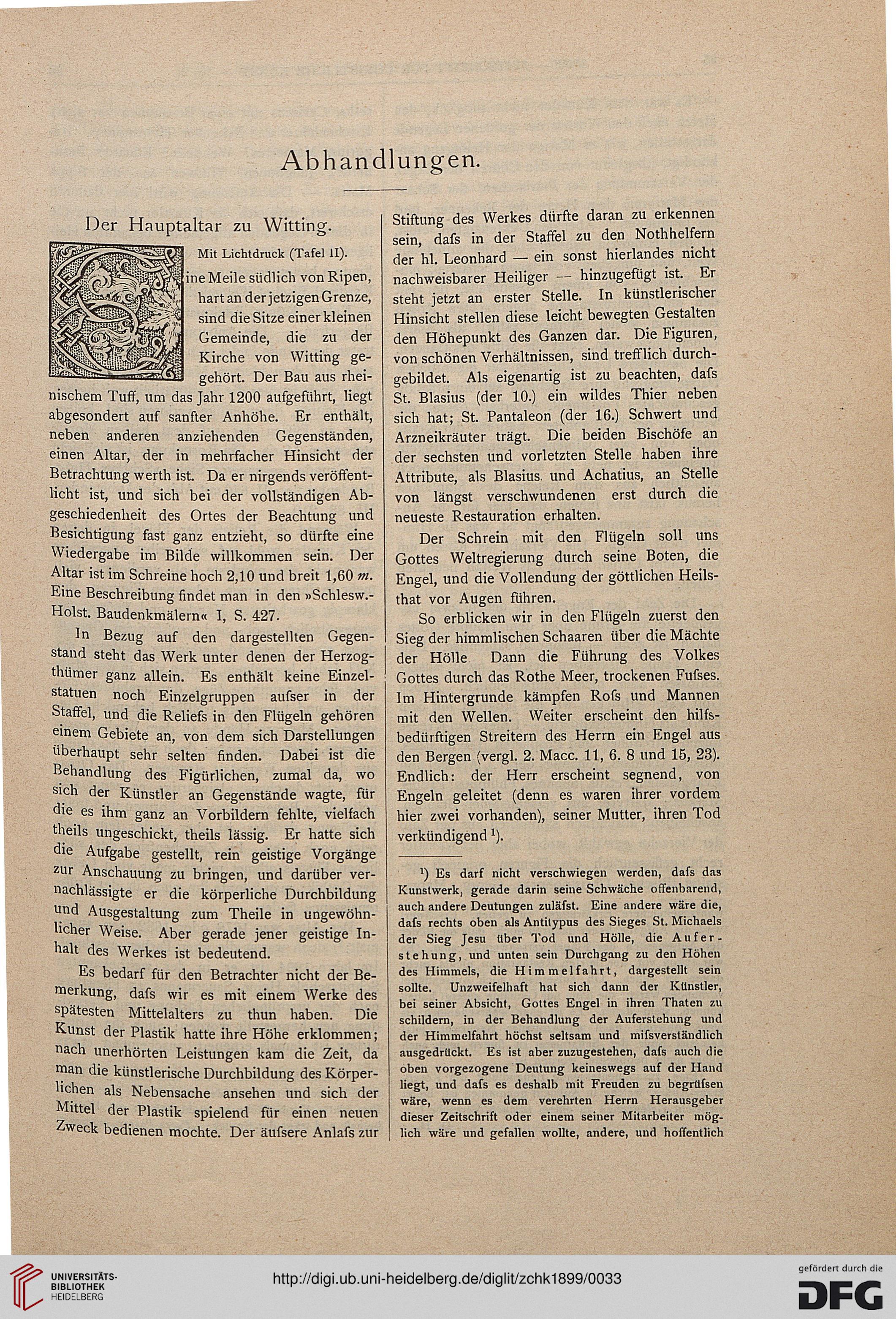Abhandlungen.
Der Hauptaltar zu Witting.
Mit Lichtdruck (Tafel II).
jineMeile südlich vonRipen,
hart an der jetzigen Grenze,
sind die Sitze einer kleinen
Gemeinde, die zu der
Kirche von Witting ge-
^^^^^^^^^^^ gehört. Der Bau aus rhei-
nischem Tuff, um das Jahr 1200 aufgeführt, liegt
abgesondert auf sanfter Anhöhe. Er enthält,
neben anderen anziehenden Gegenständen,
einen Altar, der in mehrfacher Hinsicht der
Betrachtung werth ist. Da er nirgends veröffent-
licht ist, und sich bei der vollständigen Ab-
geschiedenheit des Ortes der Beachtung und
Besichtigung fast ganz entzieht, so dürfte eine
Wiedergabe im Bilde willkommen sein. Der
Altar ist im Schreine hoch 2,10 und breit 1,60 m.
Eine Beschreibung findet man in den »Schlesw.-
Holst. Baudenkmälern« I, S. 427.
In Bezug auf den dargestellten Gegen-
stand steht das Werk unter denen der Herzog-
tümer ganz allein. Es enthält keine Einzel-
statuen noch Einzelgruppen aufser in der
Staffel, und die Reliefs in den Flügeln gehören
einem Gebiete an, von dem sich Darstellungen
überhaupt sehr selten finden. Dabei ist die
Behandlung des Figürlichen, zumal da, wo
sich der Künstler an Gegenstände wagte, für
die es ihm ganz an Vorbildern fehlte, vielfach
theils ungeschickt, theils lässig. Er hatte sich
die Aufgabe gestellt, rein geistige Vorgänge
zur Anschauung zu bringen, und darüber ver-
nachlässigte er die körperliche Durchbildung
und Ausgestaltung zum Theile in ungewöhn-
licher Weise. Aber gerade jener geistige In-
halt des Werkes ist bedeutend.
Es bedarf für den Betrachter nicht der Be-
merkung, dafs wir es mit einem Werke des
spätesten Mittelalters zu thun haben. Die
Kunst der Plastik hatte ihre Höhe erklommen;
nach unerhörten Leistungen kam die Zeit, da
man die künstlerische Durchbildung des Körper-
lichen als Nebensache ansehen und sich der
Mittel der Plastik spielend für einen neuen
Zweck bedienen mochte. Der äufsere Anlafs zur
Stiftung des Werkes dürfte daran zu erkennen
sein, dafs in der Staffel zu den Nothhelfern
der hl. Leonhard — ein sonst hierlandes nicht
nachweisbarer Heiliger — hinzugefügt ist. Er
steht jetzt an erster Stelle. In künstlerischer
Hinsicht stellen diese leicht bewegten Gestalten
den Höhepunkt des Ganzen dar. Die Figuren,
von schönen Verhältnissen, sind trefflich durch-
gebildet. Als eigenartig ist zu beachten, dafs
St. Blasius (der 10.) ein wildes Thier neben
sich hat; St. Pantaleon (der 16.) Schwert und
Arzneikräuter trägt. Die beiden Bischöfe an
der sechsten und vorletzten Stelle haben ihre
Attribute, als Blasius. und Achatius, an Stelle
von längst verschwundenen erst durch die
neueste Restauration erhalten.
Der Schrein mit den Flügeln soll uns
Gottes Weltregierung durch seine Boten, die
Engel, und die Vollendung der göttlichen Heils-
that vor Augen führen.
So erblicken wir in den Flügeln zuerst den
Sieg der himmlischen Schaaren über die Mächte
der Hölle Dann die Führung des Volkes
Gottes durch das Rothe Meer, trockenen Fufses.
Im Hintergrunde kämpfen Rofs und Mannen
mit den Wellen. Weiter erscheint den hilfs-
bedürftigen Streitern des Herrn ein Engel aus
den Bergen (vergl. 2. Macc. 11, 6. 8 und 15, 23).
Endlich: der Herr erscheint segnend, von
Engeln geleitet (denn es waren ihrer vordem
hier zwei vorhanden), seiner Mutter, ihren Tod
verkündigend 1).
T) Es darf nicht verschwiegen werden, dafs das
Kunstwerk, gerade darin seine Schwäche offenbarend,
auch andere Deutungen zuläfst. Eine andere wäre die,
dafs rechts oben als Antilypus des Sieges St. Michaels
der Sieg Jesu über Tod und Hölle, die Aufer-
stehung, und unten sein Durchgang zu den Höhen
des Himmels, die Himmelfahrt, dargestellt sein
sollte. Unzweifelhaft hat sich dann der Künstler,
bei seiner Absicht, Gottes Engel in ihren Thaten zu
schildern, in der Behandlung der Auferstehung und
der Himmelfahrt höchst seltsam und mifsverständlich
ausgedrückt. Es ist aber zuzugestehen, dafs auch die
oben vorgezogene Deutung keineswegs auf der Hand
liegt, und dafs es deshalb mit Freuden zu begrüfsen
wäre, wenn es dem verehrten Herrn Herausgeber
dieser Zeitschrift oder einem seiner Mitarbeiter mög-
lich wäre und gefallen wollte, andere, und hoffentlich
Der Hauptaltar zu Witting.
Mit Lichtdruck (Tafel II).
jineMeile südlich vonRipen,
hart an der jetzigen Grenze,
sind die Sitze einer kleinen
Gemeinde, die zu der
Kirche von Witting ge-
^^^^^^^^^^^ gehört. Der Bau aus rhei-
nischem Tuff, um das Jahr 1200 aufgeführt, liegt
abgesondert auf sanfter Anhöhe. Er enthält,
neben anderen anziehenden Gegenständen,
einen Altar, der in mehrfacher Hinsicht der
Betrachtung werth ist. Da er nirgends veröffent-
licht ist, und sich bei der vollständigen Ab-
geschiedenheit des Ortes der Beachtung und
Besichtigung fast ganz entzieht, so dürfte eine
Wiedergabe im Bilde willkommen sein. Der
Altar ist im Schreine hoch 2,10 und breit 1,60 m.
Eine Beschreibung findet man in den »Schlesw.-
Holst. Baudenkmälern« I, S. 427.
In Bezug auf den dargestellten Gegen-
stand steht das Werk unter denen der Herzog-
tümer ganz allein. Es enthält keine Einzel-
statuen noch Einzelgruppen aufser in der
Staffel, und die Reliefs in den Flügeln gehören
einem Gebiete an, von dem sich Darstellungen
überhaupt sehr selten finden. Dabei ist die
Behandlung des Figürlichen, zumal da, wo
sich der Künstler an Gegenstände wagte, für
die es ihm ganz an Vorbildern fehlte, vielfach
theils ungeschickt, theils lässig. Er hatte sich
die Aufgabe gestellt, rein geistige Vorgänge
zur Anschauung zu bringen, und darüber ver-
nachlässigte er die körperliche Durchbildung
und Ausgestaltung zum Theile in ungewöhn-
licher Weise. Aber gerade jener geistige In-
halt des Werkes ist bedeutend.
Es bedarf für den Betrachter nicht der Be-
merkung, dafs wir es mit einem Werke des
spätesten Mittelalters zu thun haben. Die
Kunst der Plastik hatte ihre Höhe erklommen;
nach unerhörten Leistungen kam die Zeit, da
man die künstlerische Durchbildung des Körper-
lichen als Nebensache ansehen und sich der
Mittel der Plastik spielend für einen neuen
Zweck bedienen mochte. Der äufsere Anlafs zur
Stiftung des Werkes dürfte daran zu erkennen
sein, dafs in der Staffel zu den Nothhelfern
der hl. Leonhard — ein sonst hierlandes nicht
nachweisbarer Heiliger — hinzugefügt ist. Er
steht jetzt an erster Stelle. In künstlerischer
Hinsicht stellen diese leicht bewegten Gestalten
den Höhepunkt des Ganzen dar. Die Figuren,
von schönen Verhältnissen, sind trefflich durch-
gebildet. Als eigenartig ist zu beachten, dafs
St. Blasius (der 10.) ein wildes Thier neben
sich hat; St. Pantaleon (der 16.) Schwert und
Arzneikräuter trägt. Die beiden Bischöfe an
der sechsten und vorletzten Stelle haben ihre
Attribute, als Blasius. und Achatius, an Stelle
von längst verschwundenen erst durch die
neueste Restauration erhalten.
Der Schrein mit den Flügeln soll uns
Gottes Weltregierung durch seine Boten, die
Engel, und die Vollendung der göttlichen Heils-
that vor Augen führen.
So erblicken wir in den Flügeln zuerst den
Sieg der himmlischen Schaaren über die Mächte
der Hölle Dann die Führung des Volkes
Gottes durch das Rothe Meer, trockenen Fufses.
Im Hintergrunde kämpfen Rofs und Mannen
mit den Wellen. Weiter erscheint den hilfs-
bedürftigen Streitern des Herrn ein Engel aus
den Bergen (vergl. 2. Macc. 11, 6. 8 und 15, 23).
Endlich: der Herr erscheint segnend, von
Engeln geleitet (denn es waren ihrer vordem
hier zwei vorhanden), seiner Mutter, ihren Tod
verkündigend 1).
T) Es darf nicht verschwiegen werden, dafs das
Kunstwerk, gerade darin seine Schwäche offenbarend,
auch andere Deutungen zuläfst. Eine andere wäre die,
dafs rechts oben als Antilypus des Sieges St. Michaels
der Sieg Jesu über Tod und Hölle, die Aufer-
stehung, und unten sein Durchgang zu den Höhen
des Himmels, die Himmelfahrt, dargestellt sein
sollte. Unzweifelhaft hat sich dann der Künstler,
bei seiner Absicht, Gottes Engel in ihren Thaten zu
schildern, in der Behandlung der Auferstehung und
der Himmelfahrt höchst seltsam und mifsverständlich
ausgedrückt. Es ist aber zuzugestehen, dafs auch die
oben vorgezogene Deutung keineswegs auf der Hand
liegt, und dafs es deshalb mit Freuden zu begrüfsen
wäre, wenn es dem verehrten Herrn Herausgeber
dieser Zeitschrift oder einem seiner Mitarbeiter mög-
lich wäre und gefallen wollte, andere, und hoffentlich