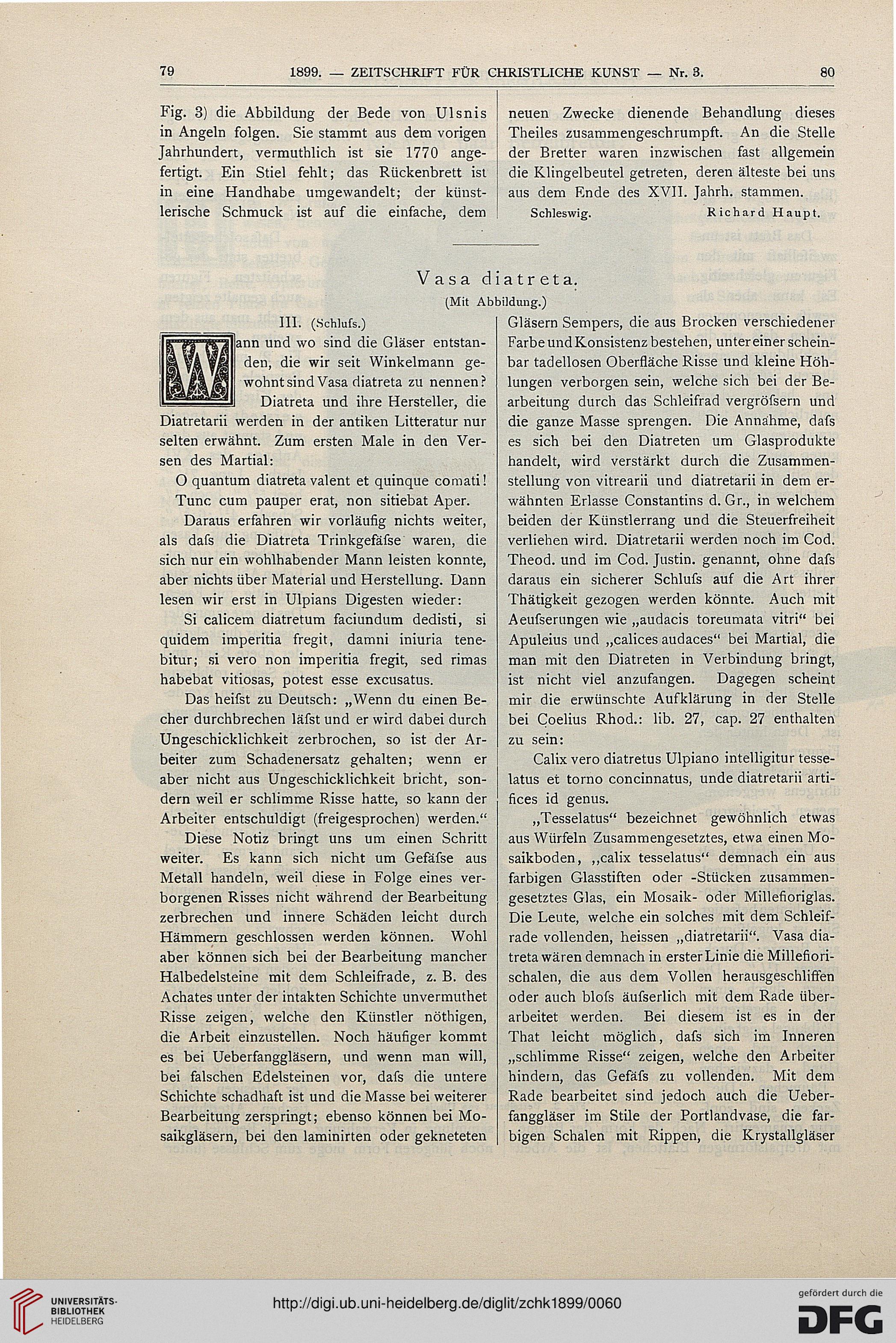79
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Fig. 3) die Abbildung der Bede von Ulsnis
in Angeln folgen. Sie stammt aus dem vorigen
Jahrhundert, vermuthlich ist sie 1770 ange-
fertigt. Ein Stiel fehlt; das Rückenbrett ist
in eine Handhabe umgewandelt; der künst-
lerische Schmuck ist auf die einfache, dem
neuen Zwecke dienende Behandlung dieses
Theiles zusammengeschrumpft. An die Stelle
der Bretter waren inzwischen fast allgemein
die Klingelbeutel getreten, deren älteste bei uns
aus dem Ende des XVII. Jahrh. stammen.
Schleswig. Richard Haupt.
III. (Schlufs.)
ann und wo sind die Gläser entstan-
den, die wir seit Winkelmann ge-
wohnt sind Vasa diatreta zu nennen?
Diatreta und ihre Hersteller, die
Diatretarii werden in der antiken Litteratur nur
selten erwähnt. Zum ersten Male in den Ver-
sen des Martial:
O quantum diatreta valent et quinque comati!
Tunc cum pauper erat, non sitiebat Aper.
Daraus erfahren wir vorläufig nichts weiter,
als dafs die Diatreta Trinkgefäfse waren, die
sich nur ein wohlhabender Mann leisten konnte,
aber nichts über Material und Herstellung. Dann
lesen wir erst in Ulpians Digesten wieder:
Si calicem diatretum faciundum dedisti, si
quidem imperitia fregit, damni iniuria tene-
bitur; si vero non imperitia fregit, sed rimas
habebat vitiosas, potest esse excusatus.
Das heifst zu Deutsch: „Wenn du einen Be-
cher durchbrechen läfst und er wird dabei durch
Ungeschicklichkeit zerbrochen, so ist der Ar-
beiter zum Schadenersatz gehalten; wenn er
aber nicht aus Ungeschicklichkeit bricht, son-
dern weil er schlimme Risse hatte, so kann der
Arbeiter entschuldigt (freigesprochen) werden."
Diese Notiz bringt uns um einen Schritt
weiter. Es kann sich nicht um Gefäfse aus
Metall handeln, weil diese in Folge eines ver-
borgenen Risses nicht während der Bearbeitung
zerbrechen und innere Schäden leicht durch
Hämmern geschlossen werden können. Wohl
aber können sich bei der Bearbeitung mancher
Halbedelsteine mit dem Schleifrade, z. B. des
Achates unter der intakten Schichte unvermuthet
Risse zeigen, welche den Künstler nöthigen,
die Arbeit einzustellen. Noch häufiger kommt
es bei Ueberfanggläsern, und wenn man will,
bei falschen Edelsteinen vor, dafs die untere
Schichte schadhaft ist und die Masse bei weiterer
Bearbeitung zerspringt; ebenso können bei Mo-
saikgläsern, bei den laminirten oder gekneteten
Vasa diatreta.
(Mit Abbildung.)
Gläsern Sempers, die aus Brocken verschiedener
Farbe und Konsistenz bestehen, unter einer schein-
bar tadellosen Oberfläche Risse und kleine Höh-
lungen verborgen sein, welche sich bei der Be-
arbeitung durch das Schleifrad vergröfsern und
die ganze Masse sprengen. Die Annähme, dafs
es sich bei den Diatreten um Glasprodukte
handelt, wird verstärkt durch die Zusammen-
stellung von vitrearii und diatretarii in dem er-
wähnten Erlasse Constantins d. Gr., in welchem
beiden der Künstlerrang und die Steuerfreiheit
verliehen wird. Diatretarii werden noch im Cod.
Theod. und im Cod. Justin, genannt, ohne dafs
daraus ein sicherer Schlufs auf die Art ihrer
Thätigkeit gezogen werden könnte. Auch mit
Aeufserungen wie „audacis toreumata vitri" bei
Apuleius und „calices audaces" bei Martial, die
man mit den Diatreten in Verbindung bringt,
ist nicht viel anzufangen. Dagegen scheint
mir die erwünschte Aufklärung in der Stelle
bei Coelius Rhod.: lib. 27, cap. 27 enthalten
zu sein:
Calix vero diatretus Ulpiano intelligitur tesse-
latus et torno concinnatus, unde diatretarii arti-
fices id genus.
„Tesselatus" bezeichnet gewöhnlich etwas
aus Würfeln Zusammengesetztes, etwa einen Mo-
saikboden, „calix tesselatus" demnach ein aus
farbigen Glasstiften oder -Stücken zusammen-
gesetztes Glas, ein Mosaik- oder Millefioriglas.
Die Leute, welche ein solches mit dem Schleif-
rade vollenden, heissen „diatretarii". Vasa dia-
treta wären demnach in erster Linie die Millefiori-
schalen, die aus dem Vollen herausgeschliffen
oder auch blofs äufserlich mit dem Rade über-
arbeitet werden. Bei diesem ist es in der
That leicht möglich, dafs sich im Inneren
„schlimme Risse" zeigen, welche den Arbeiter
hindern, das Gefäfs zu vollenden. Mit dem
Rade bearbeitet sind jedoch auch die Ueber-
fanggläser im Stile der Portlandvase, die far-
bigen Schalen mit Rippen, die Krystallgläser
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
80
Fig. 3) die Abbildung der Bede von Ulsnis
in Angeln folgen. Sie stammt aus dem vorigen
Jahrhundert, vermuthlich ist sie 1770 ange-
fertigt. Ein Stiel fehlt; das Rückenbrett ist
in eine Handhabe umgewandelt; der künst-
lerische Schmuck ist auf die einfache, dem
neuen Zwecke dienende Behandlung dieses
Theiles zusammengeschrumpft. An die Stelle
der Bretter waren inzwischen fast allgemein
die Klingelbeutel getreten, deren älteste bei uns
aus dem Ende des XVII. Jahrh. stammen.
Schleswig. Richard Haupt.
III. (Schlufs.)
ann und wo sind die Gläser entstan-
den, die wir seit Winkelmann ge-
wohnt sind Vasa diatreta zu nennen?
Diatreta und ihre Hersteller, die
Diatretarii werden in der antiken Litteratur nur
selten erwähnt. Zum ersten Male in den Ver-
sen des Martial:
O quantum diatreta valent et quinque comati!
Tunc cum pauper erat, non sitiebat Aper.
Daraus erfahren wir vorläufig nichts weiter,
als dafs die Diatreta Trinkgefäfse waren, die
sich nur ein wohlhabender Mann leisten konnte,
aber nichts über Material und Herstellung. Dann
lesen wir erst in Ulpians Digesten wieder:
Si calicem diatretum faciundum dedisti, si
quidem imperitia fregit, damni iniuria tene-
bitur; si vero non imperitia fregit, sed rimas
habebat vitiosas, potest esse excusatus.
Das heifst zu Deutsch: „Wenn du einen Be-
cher durchbrechen läfst und er wird dabei durch
Ungeschicklichkeit zerbrochen, so ist der Ar-
beiter zum Schadenersatz gehalten; wenn er
aber nicht aus Ungeschicklichkeit bricht, son-
dern weil er schlimme Risse hatte, so kann der
Arbeiter entschuldigt (freigesprochen) werden."
Diese Notiz bringt uns um einen Schritt
weiter. Es kann sich nicht um Gefäfse aus
Metall handeln, weil diese in Folge eines ver-
borgenen Risses nicht während der Bearbeitung
zerbrechen und innere Schäden leicht durch
Hämmern geschlossen werden können. Wohl
aber können sich bei der Bearbeitung mancher
Halbedelsteine mit dem Schleifrade, z. B. des
Achates unter der intakten Schichte unvermuthet
Risse zeigen, welche den Künstler nöthigen,
die Arbeit einzustellen. Noch häufiger kommt
es bei Ueberfanggläsern, und wenn man will,
bei falschen Edelsteinen vor, dafs die untere
Schichte schadhaft ist und die Masse bei weiterer
Bearbeitung zerspringt; ebenso können bei Mo-
saikgläsern, bei den laminirten oder gekneteten
Vasa diatreta.
(Mit Abbildung.)
Gläsern Sempers, die aus Brocken verschiedener
Farbe und Konsistenz bestehen, unter einer schein-
bar tadellosen Oberfläche Risse und kleine Höh-
lungen verborgen sein, welche sich bei der Be-
arbeitung durch das Schleifrad vergröfsern und
die ganze Masse sprengen. Die Annähme, dafs
es sich bei den Diatreten um Glasprodukte
handelt, wird verstärkt durch die Zusammen-
stellung von vitrearii und diatretarii in dem er-
wähnten Erlasse Constantins d. Gr., in welchem
beiden der Künstlerrang und die Steuerfreiheit
verliehen wird. Diatretarii werden noch im Cod.
Theod. und im Cod. Justin, genannt, ohne dafs
daraus ein sicherer Schlufs auf die Art ihrer
Thätigkeit gezogen werden könnte. Auch mit
Aeufserungen wie „audacis toreumata vitri" bei
Apuleius und „calices audaces" bei Martial, die
man mit den Diatreten in Verbindung bringt,
ist nicht viel anzufangen. Dagegen scheint
mir die erwünschte Aufklärung in der Stelle
bei Coelius Rhod.: lib. 27, cap. 27 enthalten
zu sein:
Calix vero diatretus Ulpiano intelligitur tesse-
latus et torno concinnatus, unde diatretarii arti-
fices id genus.
„Tesselatus" bezeichnet gewöhnlich etwas
aus Würfeln Zusammengesetztes, etwa einen Mo-
saikboden, „calix tesselatus" demnach ein aus
farbigen Glasstiften oder -Stücken zusammen-
gesetztes Glas, ein Mosaik- oder Millefioriglas.
Die Leute, welche ein solches mit dem Schleif-
rade vollenden, heissen „diatretarii". Vasa dia-
treta wären demnach in erster Linie die Millefiori-
schalen, die aus dem Vollen herausgeschliffen
oder auch blofs äufserlich mit dem Rade über-
arbeitet werden. Bei diesem ist es in der
That leicht möglich, dafs sich im Inneren
„schlimme Risse" zeigen, welche den Arbeiter
hindern, das Gefäfs zu vollenden. Mit dem
Rade bearbeitet sind jedoch auch die Ueber-
fanggläser im Stile der Portlandvase, die far-
bigen Schalen mit Rippen, die Krystallgläser