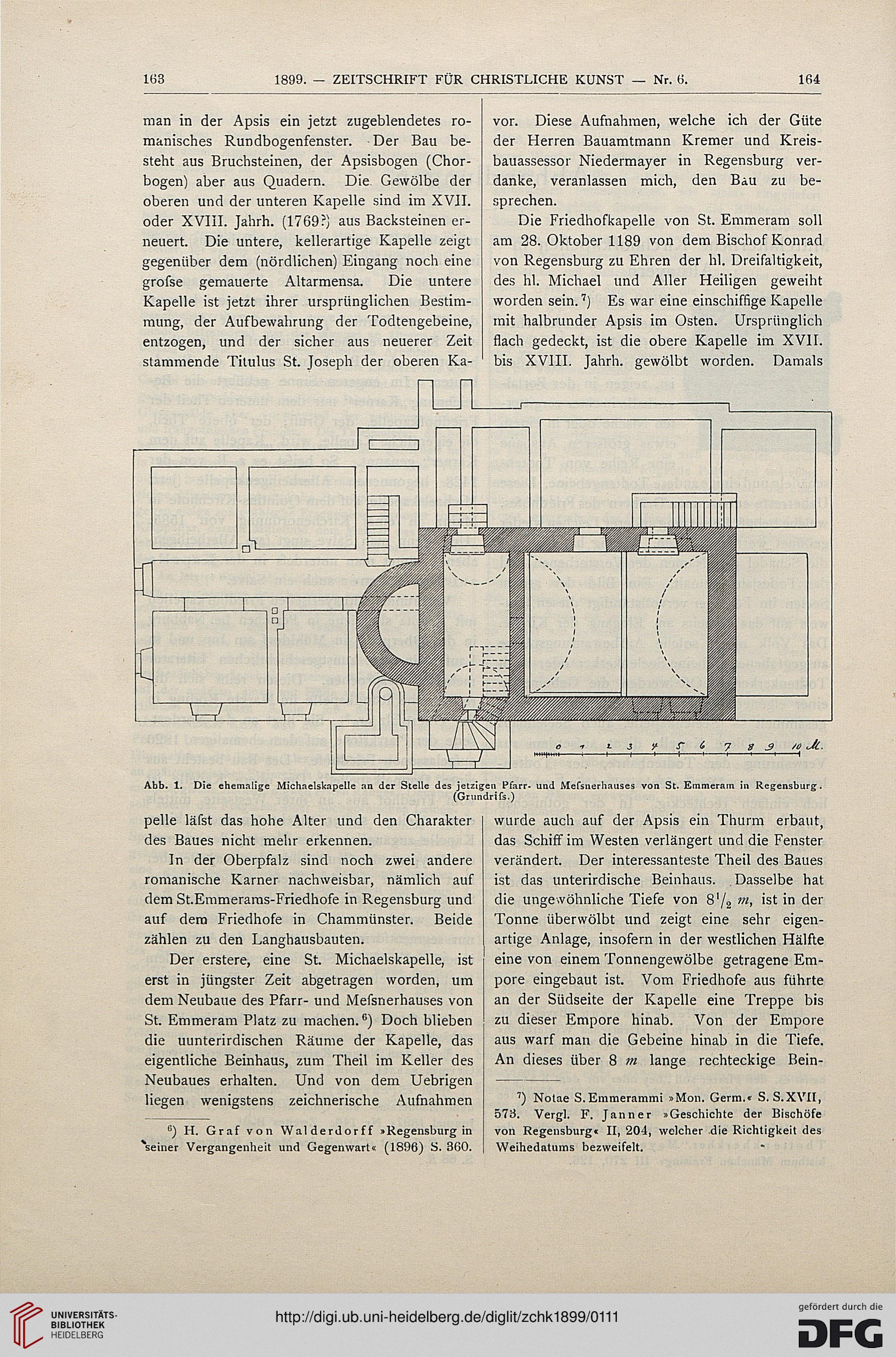163
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
164
man in der Apsis ein jetzt zugeblendetes ro-
manisches Rundbogenfenster. Der Bau be-
steht aus Bruchsteinen, der Apsisbogen (Chor-
bogen) aber aus Quadern. Die Gewölbe der
oberen und der unteren Kapelle sind im XVII.
oder XVIII. Jahrh. (1769?) aus Backsteinen er-
neuert. Die untere, kellerartige Kapelle zeigt
gegenüber dem (nördlichen) Eingang noch eine
grofse gemauerte Altarmensa. Die untere
Kapelle ist jetzt ihrer ursprünglichen Bestim-
mung, der Aufbewahrung der Todtengebeine,
entzogen, und der sicher aus neuerer Zeit
stammende Titulus St. Joseph der oberen Ka-
vor. Diese Aufnahmen, welche ich der Güte
der Herren Bauamtmann Kremer und Kreis-
bauassessor Niedermayer in Regensburg ver-
danke, veranlassen mich, den Bau zu be-
sprechen.
Die Friedhofkapelle von St. Emmeram soll
am 28. Oktober 1189 von dem Bischof Konrad
von Regensburg zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit,
des hl. Michael und Aller Heiligen geweiht
worden sein.7) Es war eine einschiffige Kapelle
mit halbrunder Apsis im Osten. Ursprünglich
flach gedeckt, ist die obere Kapelle im XVII.
bis XVIII. Jahrh. gewölbt worden. Damals
Abb. 1. Die ehemalige Michaelskapelle an der Stelle des jetzigen Pfarr- und Mefsnerhauses von St. Emmeram in Regensburg.
(Gnmdrifs.)
pelle läfst das hohe Alter und den Charakter
des Baues nicht mehr erkennen.
In der Oberpfalz sind noch zwei andere
romanische Karner nachweisbar, nämlich auf
dem St.Emmerams-Friedhofe in Regensburg und
auf dem Friedhofe in Chammünster. Beide
zählen zu den Langhausbauten.
Der erstere, eine St. Michaelskapelle, ist
erst in jüngster Zeit abgetragen worden, um
dem Neubaue des Pfarr- und Mefsnerhauses von
St. Emmeram Platz zu machen. °) Doch blieben
die uunterirdischen Räume der Kapelle, das
eigentliche Beinhaus, zum Theil im Keller des
Neubaues erhalten. Und von dem Uebrigen
liegen wenigstens zeichnerische Aufnahmen
°) H. Graf von Walderdorff »Regensburgin
seiner Vergangenheit und Gegenwart« (1896) S. 360.
wurde auch auf der Apsis ein Thurm erbaut,
das Schiff im Westen verlängert und die Fenster
verändert. Der interessanteste Theil des Baues
ist das unterirdische Beinhaus. Dasselbe hat
die ungewöhnliche Tiefe von 8'/2 m> ist in der
Tonne überwölbt und zeigt eine sehr eigen-
artige Anlage, insofern in der westlichen Hälfte
eine von einem Tonnengewölbe getragene Em-
pore eingebaut ist. Vom Friedhofe aus führte
an der Südseite der Kapelle eine Treppe bis
zu dieser Empore hinab. Von der Empore
aus warf man die Gebeine hinab in die Tiefe.
An dieses über 8 m lange rechteckige Bein-
7) Notae S.Emmerammi »Mon. Germ.« S. S.XVII,
573. Vergl. F. Janner »Geschichte der Bischöfe
von Regensburg« II, 204, welcher die Richtigkeit des
Weihedatums bezweifelt.
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 6.
164
man in der Apsis ein jetzt zugeblendetes ro-
manisches Rundbogenfenster. Der Bau be-
steht aus Bruchsteinen, der Apsisbogen (Chor-
bogen) aber aus Quadern. Die Gewölbe der
oberen und der unteren Kapelle sind im XVII.
oder XVIII. Jahrh. (1769?) aus Backsteinen er-
neuert. Die untere, kellerartige Kapelle zeigt
gegenüber dem (nördlichen) Eingang noch eine
grofse gemauerte Altarmensa. Die untere
Kapelle ist jetzt ihrer ursprünglichen Bestim-
mung, der Aufbewahrung der Todtengebeine,
entzogen, und der sicher aus neuerer Zeit
stammende Titulus St. Joseph der oberen Ka-
vor. Diese Aufnahmen, welche ich der Güte
der Herren Bauamtmann Kremer und Kreis-
bauassessor Niedermayer in Regensburg ver-
danke, veranlassen mich, den Bau zu be-
sprechen.
Die Friedhofkapelle von St. Emmeram soll
am 28. Oktober 1189 von dem Bischof Konrad
von Regensburg zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit,
des hl. Michael und Aller Heiligen geweiht
worden sein.7) Es war eine einschiffige Kapelle
mit halbrunder Apsis im Osten. Ursprünglich
flach gedeckt, ist die obere Kapelle im XVII.
bis XVIII. Jahrh. gewölbt worden. Damals
Abb. 1. Die ehemalige Michaelskapelle an der Stelle des jetzigen Pfarr- und Mefsnerhauses von St. Emmeram in Regensburg.
(Gnmdrifs.)
pelle läfst das hohe Alter und den Charakter
des Baues nicht mehr erkennen.
In der Oberpfalz sind noch zwei andere
romanische Karner nachweisbar, nämlich auf
dem St.Emmerams-Friedhofe in Regensburg und
auf dem Friedhofe in Chammünster. Beide
zählen zu den Langhausbauten.
Der erstere, eine St. Michaelskapelle, ist
erst in jüngster Zeit abgetragen worden, um
dem Neubaue des Pfarr- und Mefsnerhauses von
St. Emmeram Platz zu machen. °) Doch blieben
die uunterirdischen Räume der Kapelle, das
eigentliche Beinhaus, zum Theil im Keller des
Neubaues erhalten. Und von dem Uebrigen
liegen wenigstens zeichnerische Aufnahmen
°) H. Graf von Walderdorff »Regensburgin
seiner Vergangenheit und Gegenwart« (1896) S. 360.
wurde auch auf der Apsis ein Thurm erbaut,
das Schiff im Westen verlängert und die Fenster
verändert. Der interessanteste Theil des Baues
ist das unterirdische Beinhaus. Dasselbe hat
die ungewöhnliche Tiefe von 8'/2 m> ist in der
Tonne überwölbt und zeigt eine sehr eigen-
artige Anlage, insofern in der westlichen Hälfte
eine von einem Tonnengewölbe getragene Em-
pore eingebaut ist. Vom Friedhofe aus führte
an der Südseite der Kapelle eine Treppe bis
zu dieser Empore hinab. Von der Empore
aus warf man die Gebeine hinab in die Tiefe.
An dieses über 8 m lange rechteckige Bein-
7) Notae S.Emmerammi »Mon. Germ.« S. S.XVII,
573. Vergl. F. Janner »Geschichte der Bischöfe
von Regensburg« II, 204, welcher die Richtigkeit des
Weihedatums bezweifelt.