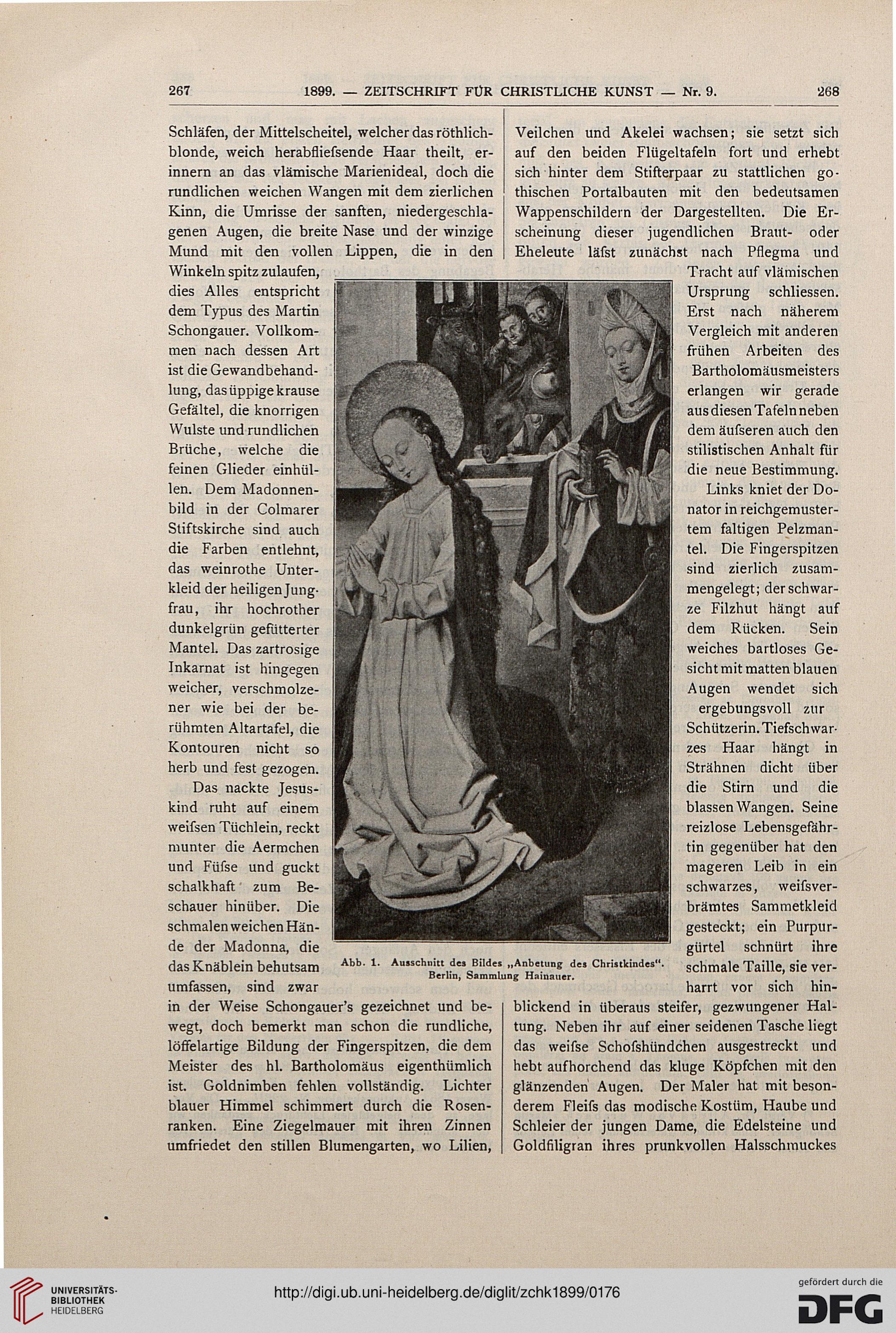267
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
268
Schläfen, der Mittelscheitel, welcher das röthlich-
blonde, weich herabfliefsende Haar theilt, er-
innern an das vlämische Marienideal, doch die
rundlichen weichen Wangen mit dem zierlichen
Kinn, die Umrisse der sanften, niedergeschla-
genen Augen, die breite Nase und der winzige
Mund mit den vollen Lippen, die in den
Winkeln spitz zulaufen,
dies Alles entspricht
dem Typus des Martin
Schongauer. Vollkom-
men nach dessen Art
ist die Gewandbehand-
lung, das üppige krause
Gefältel, die knorrigen
Wulste und rundlichen
Brüche, welche die
feinen Glieder einhül-
len. Dem Madonnen-
bild in der Colmarer
Stiftskirche sind auch
die Farben entlehnt,
das weinrothe Unter-
kleid der heiligen Jung-
frau, ihr hochrother
dunkelgrün gefütterter
Mantel. Das zartrosige
Inkarnat ist hingegen
weicher, verschmolze-
ner wie bei der be-
rühmten Altartafel, die
Kontouren nicht so
herb und fest gezogen.
Das nackte Jesus-
kind ruht auf einem
weifsen Tüchlein, reckt
munter die Aermchen
und Füfse und guckt
schalkhaft zum Be-
schauer hinüber. Die
schmalen weichen Hän-
de der Madonna, die
das Knäblein behutsam
umfassen, sind zwar
in der Weise Schongauer's gezeichnet und be-
wegt, doch bemerkt man schon die rundliche,
löffelartige Bildung der Fingerspitzen, die dem
Meister des hl. Bartholomäus eigenthümlich
ist. Goldnimben fehlen vollständig. Lichter
blauer Himmel schimmert durch die Rosen-
ranken. Eine Ziegelmauer mit ihren Zinnen
umfriedet den stillen Blumengarten, wo Lilien,
Abb. I. Ausschnitt des Bildes „Anbetung des Christkindes".
Berlin, Sammlung Hainauer.
Veilchen und Akelei wachsen; sie setzt sich
auf den beiden Flügeltafeln fort und erhebt
sich hinter dem Stifterpaar zu stattlichen go-
thischen Portalbauten mit den bedeutsamen
Wappenschildern der Dargestellten. Die Er-
scheinung dieser jugendlichen Braut- oder
Eheleute läfst zunächst nach Pflegma und
Tracht auf vlämischen
Ursprung schliessen.
Erst nach näherem
Vergleich mit anderen
frühen Arbeiten des
Bartholomäusmeisters
erlangen wir gerade
aus diesen Tafeln neben
dem äufseren auch den
stilistischen Anhalt für
die neue Bestimmung.
Links kniet der Do-
nator in reichgemuster-
tem faltigen Pelzman-
tel. Die Fingerspitzen
sind zierlich zusam-
mengelegt; der schwar-
ze Filzhut hängt auf
dem Rücken. Sein
weiches bartloses Ge-
sicht mit matten blauen
Augen wendet sich
ergebungsvoll zur
Schützerin. Tiefschwar-
zes Haar hängt in
Strähnen dicht über
die Stirn und die
blassen Wangen. Seine
reizlose Lebensgefähr-
tin gegenüber hat den
mageren Leib in ein
schwarzes, weifs ver-
brämtes Sammetkleid
gesteckt; ein Purpur-
gürtel schnürt ihre
schmale Taille, sie ver-
harrt vor sich hin-
blickend in überaus steifer, gezwungener Hal-
tung. Neben ihr auf einer seidenen Tasche liegt
das weifse Schofshündchen ausgestreckt und
hebt aufhorchend das kluge Köpfchen mit den
glänzenden Augen. Der Maler hat mit beson-
derem Fleifs das modische Kostüm, Haube und
Schleier der jungen Dame, die Edelsteine und
Goldfiligran ihres prunkvollen Halsschmuckes
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
268
Schläfen, der Mittelscheitel, welcher das röthlich-
blonde, weich herabfliefsende Haar theilt, er-
innern an das vlämische Marienideal, doch die
rundlichen weichen Wangen mit dem zierlichen
Kinn, die Umrisse der sanften, niedergeschla-
genen Augen, die breite Nase und der winzige
Mund mit den vollen Lippen, die in den
Winkeln spitz zulaufen,
dies Alles entspricht
dem Typus des Martin
Schongauer. Vollkom-
men nach dessen Art
ist die Gewandbehand-
lung, das üppige krause
Gefältel, die knorrigen
Wulste und rundlichen
Brüche, welche die
feinen Glieder einhül-
len. Dem Madonnen-
bild in der Colmarer
Stiftskirche sind auch
die Farben entlehnt,
das weinrothe Unter-
kleid der heiligen Jung-
frau, ihr hochrother
dunkelgrün gefütterter
Mantel. Das zartrosige
Inkarnat ist hingegen
weicher, verschmolze-
ner wie bei der be-
rühmten Altartafel, die
Kontouren nicht so
herb und fest gezogen.
Das nackte Jesus-
kind ruht auf einem
weifsen Tüchlein, reckt
munter die Aermchen
und Füfse und guckt
schalkhaft zum Be-
schauer hinüber. Die
schmalen weichen Hän-
de der Madonna, die
das Knäblein behutsam
umfassen, sind zwar
in der Weise Schongauer's gezeichnet und be-
wegt, doch bemerkt man schon die rundliche,
löffelartige Bildung der Fingerspitzen, die dem
Meister des hl. Bartholomäus eigenthümlich
ist. Goldnimben fehlen vollständig. Lichter
blauer Himmel schimmert durch die Rosen-
ranken. Eine Ziegelmauer mit ihren Zinnen
umfriedet den stillen Blumengarten, wo Lilien,
Abb. I. Ausschnitt des Bildes „Anbetung des Christkindes".
Berlin, Sammlung Hainauer.
Veilchen und Akelei wachsen; sie setzt sich
auf den beiden Flügeltafeln fort und erhebt
sich hinter dem Stifterpaar zu stattlichen go-
thischen Portalbauten mit den bedeutsamen
Wappenschildern der Dargestellten. Die Er-
scheinung dieser jugendlichen Braut- oder
Eheleute läfst zunächst nach Pflegma und
Tracht auf vlämischen
Ursprung schliessen.
Erst nach näherem
Vergleich mit anderen
frühen Arbeiten des
Bartholomäusmeisters
erlangen wir gerade
aus diesen Tafeln neben
dem äufseren auch den
stilistischen Anhalt für
die neue Bestimmung.
Links kniet der Do-
nator in reichgemuster-
tem faltigen Pelzman-
tel. Die Fingerspitzen
sind zierlich zusam-
mengelegt; der schwar-
ze Filzhut hängt auf
dem Rücken. Sein
weiches bartloses Ge-
sicht mit matten blauen
Augen wendet sich
ergebungsvoll zur
Schützerin. Tiefschwar-
zes Haar hängt in
Strähnen dicht über
die Stirn und die
blassen Wangen. Seine
reizlose Lebensgefähr-
tin gegenüber hat den
mageren Leib in ein
schwarzes, weifs ver-
brämtes Sammetkleid
gesteckt; ein Purpur-
gürtel schnürt ihre
schmale Taille, sie ver-
harrt vor sich hin-
blickend in überaus steifer, gezwungener Hal-
tung. Neben ihr auf einer seidenen Tasche liegt
das weifse Schofshündchen ausgestreckt und
hebt aufhorchend das kluge Köpfchen mit den
glänzenden Augen. Der Maler hat mit beson-
derem Fleifs das modische Kostüm, Haube und
Schleier der jungen Dame, die Edelsteine und
Goldfiligran ihres prunkvollen Halsschmuckes