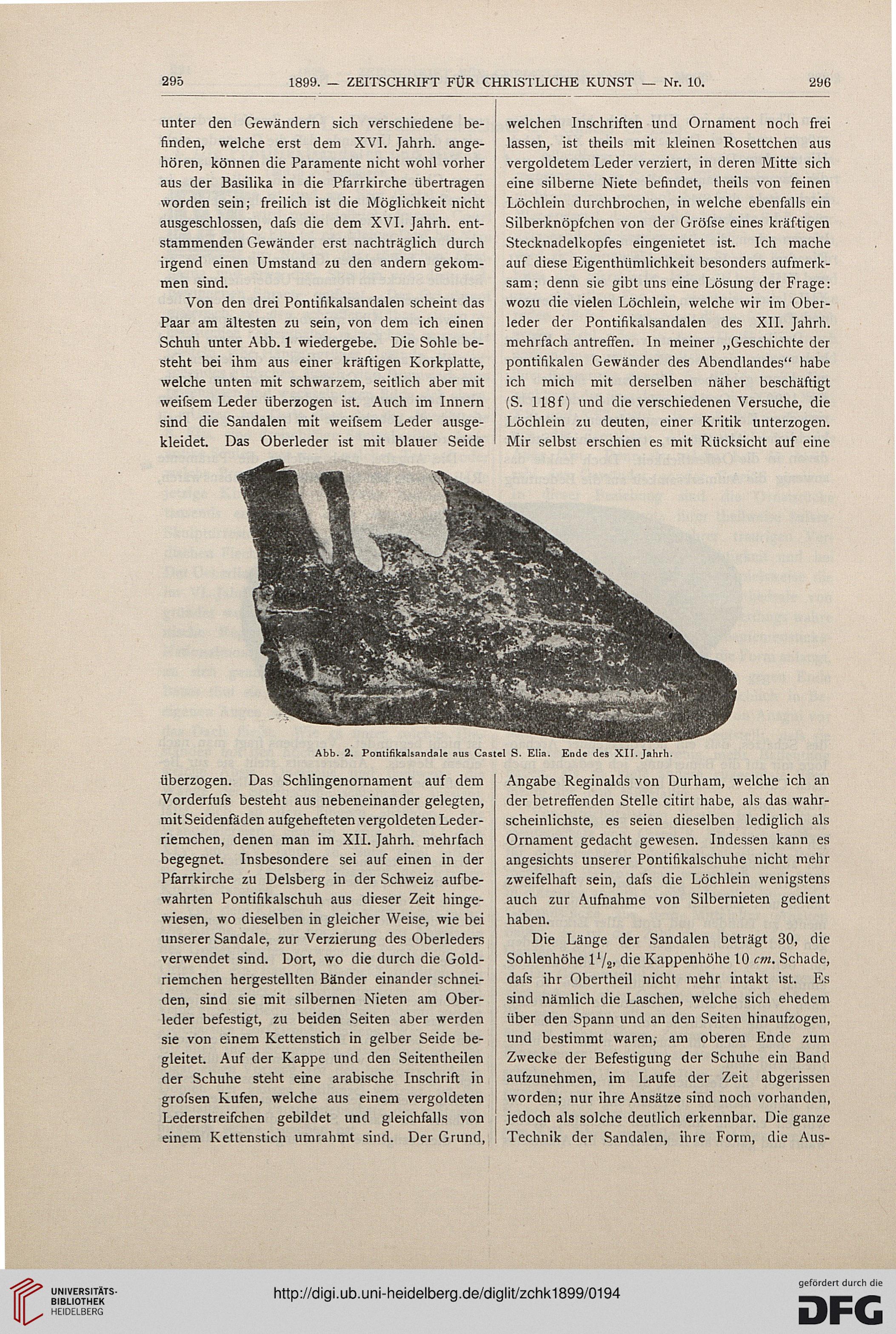295
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 10.
296
unter den Gewändern sich verschiedene be-
finden, welche erst dem XVI. Jahrh. ange-
hören, können die Paramente nicht wohl vorher
aus der Basilika in die Pfarrkirche übertragen
worden sein; freilich ist die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen, dafs die dem XVI. Jahrh. ent-
stammenden Gewänder erst nachträglich durch
irgend einen Umstand zu den andern gekom-
men sind.
Von den drei Pontifikalsandalen scheint das
Paar am ältesten zu sein, von dem ich einen
Schuh unter Abb. 1 wiedergebe. Die Sohle be-
steht bei ihm aus einer kräftigen Korkplatte,
welche unten mit schwarzem, seitlich aber mit
weifsem Leder überzogen ist. Auch im Innern
sind die Sandalen mit weifsem Leder ausge-
kleidet. Das Oberleder ist mit blauer Seide
welchen Inschriften und Ornament noch frei
lassen, ist theils mit kleinen Rosettchen aus
vergoldetem Leder verziert, in deren Mitte sich
eine silberne Niete befindet, theils von feinen
Löchlein durchbrochen, in welche ebenfalls ein
Silberknöpfchen von der Gröfse eines kräftigen
Stecknadelkopfes eingenietet ist. Ich mache
auf diese Eigenthümlichkeit besonders aufmerk-
sam; denn sie gibt uns eine Lösung der Frage:
wozu die vielen Löchlein, welche wir im Ober-
leder der Pontifikalsandalen des XII. Jahrh.
mehrfach antreffen. In meiner „Geschichte der
pontifikalen Gewänder des Abendlandes" habe
ich mich mit derselben näher beschäftigt
(S. 118f) und die verschiedenen Versuche, die
Löchlein zu deuten, einer Kritik unterzogen.
Mir selbst erschien es mit Rücksicht auf eine
Abb. 2. Pontifikalsandale aus Castel S. Elia. Ende des XII. Jahrh.
überzogen. Das Schiingenornament auf dem
Vorderfufs besteht aus nebeneinander gelegten,
mit Seidenfäden aufgehefteten vergoldeten Leder-
riemchen, denen man im XII. Jahrh. mehrfach
begegnet. Insbesondere sei auf einen in der
Pfarrkirche zu Delsberg in der Schweiz aufbe-
wahrten Pontifikalschuh aus dieser Zeit hinge-
wiesen, wo dieselben in gleicher Weise, wie bei
unserer Sandale, zur Verzierung des Oberleders
verwendet sind. Dort, wo die durch die Gold-
riemchen hergestellten Bänder einander schnei-
den, sind sie mit silbernen Nieten am Ober-
leder befestigt, zu beiden Seiten aber werden
sie von einem Kettenstich in gelber Seide be-
gleitet. Auf der Kappe und den Seitentheilen
der Schuhe steht eine arabische Inschrift in
grofsen Kufen, welche aus einem vergoldeten
Lederstreifchen gebildet und gleichfalls von
einem Kettenstich umrahmt sind. Der Grund,
Angabe Reginalds von Durham, welche ich an
der betreffenden Stelle citirt habe, als das wahr-
scheinlichste, es seien dieselben lediglich als
Ornament gedacht gewesen. Indessen kann es
angesichts unserer Pontifikalschuhe nicht mehr
zweifelhaft sein, dafs die Löchlein wenigstens
auch zur Aufnahme von Silbernieten gedient
haben.
Die Länge der Sandalen beträgt 30, die
Sohlenhöhe ll/2, die Kappenhöhe 10 cm. Schade,
dafs ihr Obertheil nicht mehr intakt ist. Es
sind nämlich die Laschen, welche sich ehedem
über den Spann und an den Seiten hinaufzogen,
und bestimmt waren; am oberen Ende zum
Zwecke der Befestigung der Schuhe ein Band
aufzunehmen, im Laufe der Zeit abgerissen
worden; nur ihre Ansätze sind noch vorhanden,
jedoch als solche deutlich erkennbar. Die ganze
Technik der Sandalen, ihre Form, die Aus-
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 10.
296
unter den Gewändern sich verschiedene be-
finden, welche erst dem XVI. Jahrh. ange-
hören, können die Paramente nicht wohl vorher
aus der Basilika in die Pfarrkirche übertragen
worden sein; freilich ist die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen, dafs die dem XVI. Jahrh. ent-
stammenden Gewänder erst nachträglich durch
irgend einen Umstand zu den andern gekom-
men sind.
Von den drei Pontifikalsandalen scheint das
Paar am ältesten zu sein, von dem ich einen
Schuh unter Abb. 1 wiedergebe. Die Sohle be-
steht bei ihm aus einer kräftigen Korkplatte,
welche unten mit schwarzem, seitlich aber mit
weifsem Leder überzogen ist. Auch im Innern
sind die Sandalen mit weifsem Leder ausge-
kleidet. Das Oberleder ist mit blauer Seide
welchen Inschriften und Ornament noch frei
lassen, ist theils mit kleinen Rosettchen aus
vergoldetem Leder verziert, in deren Mitte sich
eine silberne Niete befindet, theils von feinen
Löchlein durchbrochen, in welche ebenfalls ein
Silberknöpfchen von der Gröfse eines kräftigen
Stecknadelkopfes eingenietet ist. Ich mache
auf diese Eigenthümlichkeit besonders aufmerk-
sam; denn sie gibt uns eine Lösung der Frage:
wozu die vielen Löchlein, welche wir im Ober-
leder der Pontifikalsandalen des XII. Jahrh.
mehrfach antreffen. In meiner „Geschichte der
pontifikalen Gewänder des Abendlandes" habe
ich mich mit derselben näher beschäftigt
(S. 118f) und die verschiedenen Versuche, die
Löchlein zu deuten, einer Kritik unterzogen.
Mir selbst erschien es mit Rücksicht auf eine
Abb. 2. Pontifikalsandale aus Castel S. Elia. Ende des XII. Jahrh.
überzogen. Das Schiingenornament auf dem
Vorderfufs besteht aus nebeneinander gelegten,
mit Seidenfäden aufgehefteten vergoldeten Leder-
riemchen, denen man im XII. Jahrh. mehrfach
begegnet. Insbesondere sei auf einen in der
Pfarrkirche zu Delsberg in der Schweiz aufbe-
wahrten Pontifikalschuh aus dieser Zeit hinge-
wiesen, wo dieselben in gleicher Weise, wie bei
unserer Sandale, zur Verzierung des Oberleders
verwendet sind. Dort, wo die durch die Gold-
riemchen hergestellten Bänder einander schnei-
den, sind sie mit silbernen Nieten am Ober-
leder befestigt, zu beiden Seiten aber werden
sie von einem Kettenstich in gelber Seide be-
gleitet. Auf der Kappe und den Seitentheilen
der Schuhe steht eine arabische Inschrift in
grofsen Kufen, welche aus einem vergoldeten
Lederstreifchen gebildet und gleichfalls von
einem Kettenstich umrahmt sind. Der Grund,
Angabe Reginalds von Durham, welche ich an
der betreffenden Stelle citirt habe, als das wahr-
scheinlichste, es seien dieselben lediglich als
Ornament gedacht gewesen. Indessen kann es
angesichts unserer Pontifikalschuhe nicht mehr
zweifelhaft sein, dafs die Löchlein wenigstens
auch zur Aufnahme von Silbernieten gedient
haben.
Die Länge der Sandalen beträgt 30, die
Sohlenhöhe ll/2, die Kappenhöhe 10 cm. Schade,
dafs ihr Obertheil nicht mehr intakt ist. Es
sind nämlich die Laschen, welche sich ehedem
über den Spann und an den Seiten hinaufzogen,
und bestimmt waren; am oberen Ende zum
Zwecke der Befestigung der Schuhe ein Band
aufzunehmen, im Laufe der Zeit abgerissen
worden; nur ihre Ansätze sind noch vorhanden,
jedoch als solche deutlich erkennbar. Die ganze
Technik der Sandalen, ihre Form, die Aus-