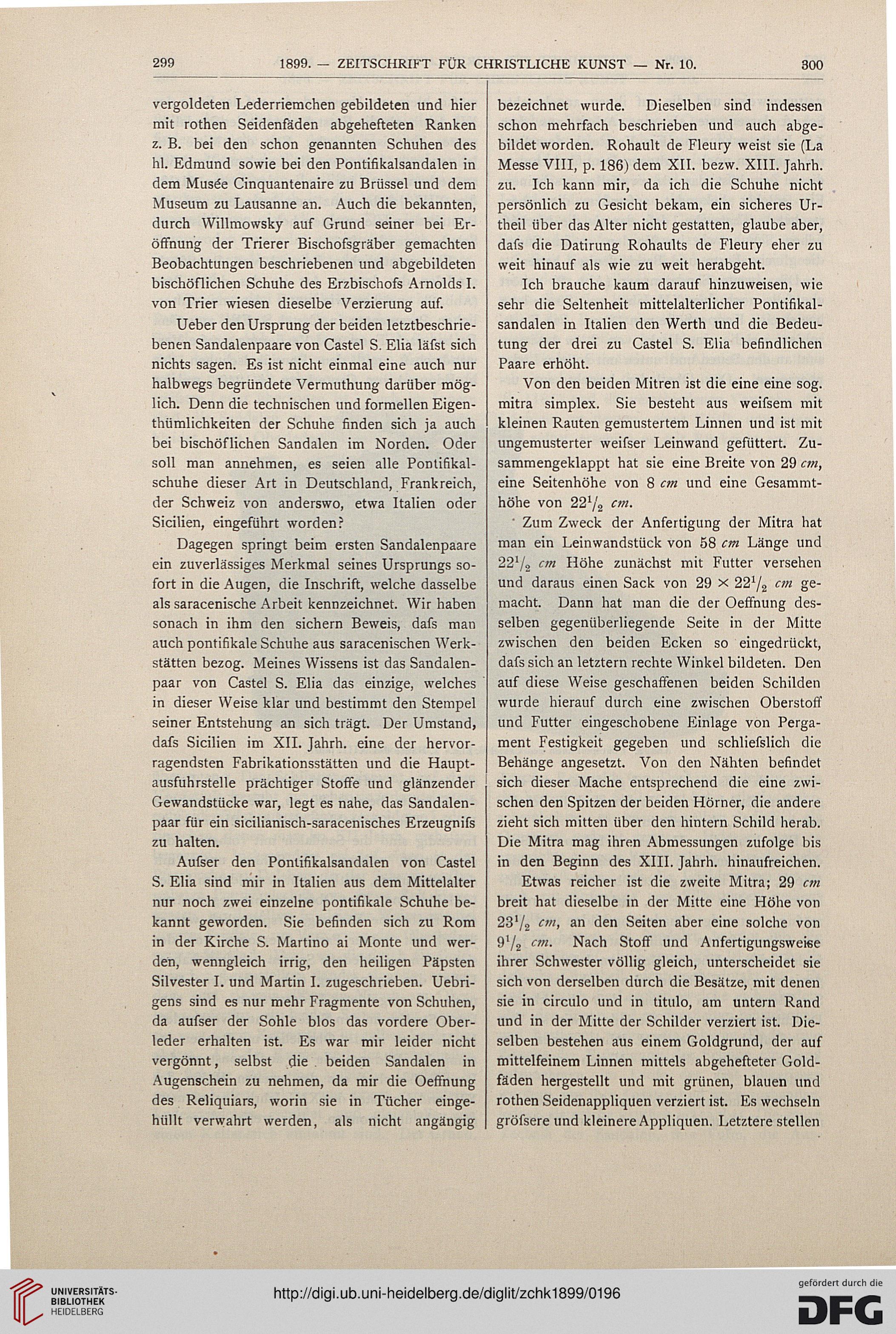299
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
300
vergoldeten Lederriemchen gebildeten und hier
mit rothen Seidenfäden abgehefteten Ranken
z. B. bei den schon genannten Schuhen des
hl. Edmund sowie bei den Pontifikalsandalen in
dem Muse"e Cinquantenaire zu Brüssel und dem
Museum zu Lausanne an. Auch die bekannten,
durch Willmowsky auf Grund seiner bei Er-
öffnung der Trierer Bischofsgräber gemachten
Beobachtungen beschriebenen und abgebildeten
bischöflichen Schuhe des Erzbischofs Arnolds I.
von Trier wiesen dieselbe Verzierung auf.
Ueber den Ursprung der beiden letztbeschrie-
benen Sandalenpaare von Castel S. Elia läfst sich
nichts sagen. Es ist nicht einmal eine auch nur
halbwegs begründete Vermuthung darüber mög-
lich. Denn die technischen und formellen Eigen -
thümlichkeiten der Schuhe finden sich ja auch
bei bischöflichen Sandalen im Norden. Oder
soll man annehmen, es seien alle Pontifikal-
schuhe dieser Art in Deutschland, Frankreich,
der Schweiz von anderswo, etwa Italien oder
Sicilien, eingeführt worden?
Dagegen springt beim ersten Sandalenpaare
ein zuverlässiges Merkmal seines Ursprungs so-
fort in die Augen, die Inschrift, welche dasselbe
als saracenische Arbeit kennzeichnet. Wir haben
sonach in ihm den sichern Beweis, dafs man
auch pontifikale Schuhe aus saracenischen Werk-
stätten bezog. Meines Wissens ist das Sandalen-
paar von Castel S. Elia das einzige, welches
in dieser Weise klar und bestimmt den Stempel
seiner Entstehung an sich trägt. Der Umstand,
dafs Sicilien im XII. Jahrh. eine der hervor-
ragendsten Fabrikationsstätten und die Haupt-
ausfuhrstelle prächtiger Stoffe und glänzender
Gewandstücke war, legt es nahe, das Sandalen-
paar für ein sicilianisch-saracenisches Erzeugnifs
zu halten.
Aufser den Pontifikalsandalen von Castel
S. Elia sind mir in Italien aus dem Mittelalter
nur noch zwei einzelne pontifikale Schuhe be-
kannt geworden. Sie befinden sich zu Rom
in der Kirche S. Martino ai Monte und wer-
den, wenngleich irrig, den heiligen Päpsten
Silvester I. und Martin I. zugeschrieben. Uebri-
gens sind es nur mehr Fragmente von Schuhen,
da aufser der Sohle blos das vordere Ober-
leder erhalten ist. Es war mir leider nicht
vergönnt, selbst die beiden Sandalen in
Augenschein zu nehmen, da mir die Oeffhung
des Reliquiars, worin sie in Tücher einge-
hüllt verwahrt werden, als nicht angängig
bezeichnet wurde. Dieselben sind indessen
schon mehrfach beschrieben und auch abge-
bildet worden. Rohault de Fleury weist sie (La
Messe VIII, p. 186) dem XII. bezw. XIII. Jahrh.
zu. Ich kann mir, da ich die Schuhe nicht
persönlich zu Gesicht bekam, ein sicheres Ur-
theil über das Alter nicht gestatten, glaube aber,
dafs die Datirung Rohaults de Fleury eher zu
weit hinauf als wie zu weit herabgeht.
Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, wie
sehr die Seltenheit mittelalterlicher Pontifikal-
sandalen in Italien den Werth und die Bedeu-
tung der drei zu Castel S. Elia befindlichen
Paare erhöht.
Von den beiden Mitren ist die eine eine sog.
mitra simplex. Sie besteht aus weifsem mit
kleinen Rauten gemustertem Linnen und ist mit
ungemusterter weifser Leinwand gefüttert. Zu-
sammengeklappt hat sie eine Breite von 29 cm,
eine Seitenhöhe von 8 cm und eine Gesammt-
höhe von 221/2 cm.
' Zum Zweck der Anfertigung der Mitra hat
man ein Leinwandstück von 58 cm Länge und
221/» cm Höhe zunächst mit Futter versehen
und daraus einen Sack von 29 x 22J/2 cm ge-
macht. Dann hat man die der Oeffnung des-
selben gegenüberliegende Seite in der Mitte
zwischen den beiden Ecken so eingedrückt,
dafs sich an letztern rechte Winkel bildeten. Den
auf diese Weise geschaffenen beiden Schilden
wurde hierauf durch eine zwischen OberstofT
und Futter eingeschobene Einlage von Perga-
ment Festigkeit gegeben und schliefslich die
Behänge angesetzt. Von den Nähten befindet
sich dieser Mache entsprechend die eine zwi-
schen den Spitzen der beiden Hörner, die andere
zieht sich mitten über den hintern Schild herab.
Die Mitra mag ihren Abmessungen zufolge bis
in den Beginn des XIII. Jahrh. hinaufreichen.
Etwas reicher ist die zweite Mitra; 29 cm
breit hat dieselbe in der Mitte eine Höhe von
23V2 cm, an den Seiten aber eine solche von
9V2 cm. Nach Stoff und Anfertigungsweise
ihrer Schwester völlig gleich, unterscheidet sie
sich von derselben durch die Besätze, mit denen
sie in circulo und in titulo, am untern Rand
und in der Mitte der Schilder verziert ist. Die-
selben bestehen aus einem Goldgrund, der auf
mittelfeinem Linnen mittels abgehefteter Gold-
fäden hergestellt und mit grünen, blauen und
rothen Seidenappliquen verziert ist. Es wechseln
gröfsere und kleinere Appliquen. Letztere stellen
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
300
vergoldeten Lederriemchen gebildeten und hier
mit rothen Seidenfäden abgehefteten Ranken
z. B. bei den schon genannten Schuhen des
hl. Edmund sowie bei den Pontifikalsandalen in
dem Muse"e Cinquantenaire zu Brüssel und dem
Museum zu Lausanne an. Auch die bekannten,
durch Willmowsky auf Grund seiner bei Er-
öffnung der Trierer Bischofsgräber gemachten
Beobachtungen beschriebenen und abgebildeten
bischöflichen Schuhe des Erzbischofs Arnolds I.
von Trier wiesen dieselbe Verzierung auf.
Ueber den Ursprung der beiden letztbeschrie-
benen Sandalenpaare von Castel S. Elia läfst sich
nichts sagen. Es ist nicht einmal eine auch nur
halbwegs begründete Vermuthung darüber mög-
lich. Denn die technischen und formellen Eigen -
thümlichkeiten der Schuhe finden sich ja auch
bei bischöflichen Sandalen im Norden. Oder
soll man annehmen, es seien alle Pontifikal-
schuhe dieser Art in Deutschland, Frankreich,
der Schweiz von anderswo, etwa Italien oder
Sicilien, eingeführt worden?
Dagegen springt beim ersten Sandalenpaare
ein zuverlässiges Merkmal seines Ursprungs so-
fort in die Augen, die Inschrift, welche dasselbe
als saracenische Arbeit kennzeichnet. Wir haben
sonach in ihm den sichern Beweis, dafs man
auch pontifikale Schuhe aus saracenischen Werk-
stätten bezog. Meines Wissens ist das Sandalen-
paar von Castel S. Elia das einzige, welches
in dieser Weise klar und bestimmt den Stempel
seiner Entstehung an sich trägt. Der Umstand,
dafs Sicilien im XII. Jahrh. eine der hervor-
ragendsten Fabrikationsstätten und die Haupt-
ausfuhrstelle prächtiger Stoffe und glänzender
Gewandstücke war, legt es nahe, das Sandalen-
paar für ein sicilianisch-saracenisches Erzeugnifs
zu halten.
Aufser den Pontifikalsandalen von Castel
S. Elia sind mir in Italien aus dem Mittelalter
nur noch zwei einzelne pontifikale Schuhe be-
kannt geworden. Sie befinden sich zu Rom
in der Kirche S. Martino ai Monte und wer-
den, wenngleich irrig, den heiligen Päpsten
Silvester I. und Martin I. zugeschrieben. Uebri-
gens sind es nur mehr Fragmente von Schuhen,
da aufser der Sohle blos das vordere Ober-
leder erhalten ist. Es war mir leider nicht
vergönnt, selbst die beiden Sandalen in
Augenschein zu nehmen, da mir die Oeffhung
des Reliquiars, worin sie in Tücher einge-
hüllt verwahrt werden, als nicht angängig
bezeichnet wurde. Dieselben sind indessen
schon mehrfach beschrieben und auch abge-
bildet worden. Rohault de Fleury weist sie (La
Messe VIII, p. 186) dem XII. bezw. XIII. Jahrh.
zu. Ich kann mir, da ich die Schuhe nicht
persönlich zu Gesicht bekam, ein sicheres Ur-
theil über das Alter nicht gestatten, glaube aber,
dafs die Datirung Rohaults de Fleury eher zu
weit hinauf als wie zu weit herabgeht.
Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, wie
sehr die Seltenheit mittelalterlicher Pontifikal-
sandalen in Italien den Werth und die Bedeu-
tung der drei zu Castel S. Elia befindlichen
Paare erhöht.
Von den beiden Mitren ist die eine eine sog.
mitra simplex. Sie besteht aus weifsem mit
kleinen Rauten gemustertem Linnen und ist mit
ungemusterter weifser Leinwand gefüttert. Zu-
sammengeklappt hat sie eine Breite von 29 cm,
eine Seitenhöhe von 8 cm und eine Gesammt-
höhe von 221/2 cm.
' Zum Zweck der Anfertigung der Mitra hat
man ein Leinwandstück von 58 cm Länge und
221/» cm Höhe zunächst mit Futter versehen
und daraus einen Sack von 29 x 22J/2 cm ge-
macht. Dann hat man die der Oeffnung des-
selben gegenüberliegende Seite in der Mitte
zwischen den beiden Ecken so eingedrückt,
dafs sich an letztern rechte Winkel bildeten. Den
auf diese Weise geschaffenen beiden Schilden
wurde hierauf durch eine zwischen OberstofT
und Futter eingeschobene Einlage von Perga-
ment Festigkeit gegeben und schliefslich die
Behänge angesetzt. Von den Nähten befindet
sich dieser Mache entsprechend die eine zwi-
schen den Spitzen der beiden Hörner, die andere
zieht sich mitten über den hintern Schild herab.
Die Mitra mag ihren Abmessungen zufolge bis
in den Beginn des XIII. Jahrh. hinaufreichen.
Etwas reicher ist die zweite Mitra; 29 cm
breit hat dieselbe in der Mitte eine Höhe von
23V2 cm, an den Seiten aber eine solche von
9V2 cm. Nach Stoff und Anfertigungsweise
ihrer Schwester völlig gleich, unterscheidet sie
sich von derselben durch die Besätze, mit denen
sie in circulo und in titulo, am untern Rand
und in der Mitte der Schilder verziert ist. Die-
selben bestehen aus einem Goldgrund, der auf
mittelfeinem Linnen mittels abgehefteter Gold-
fäden hergestellt und mit grünen, blauen und
rothen Seidenappliquen verziert ist. Es wechseln
gröfsere und kleinere Appliquen. Letztere stellen