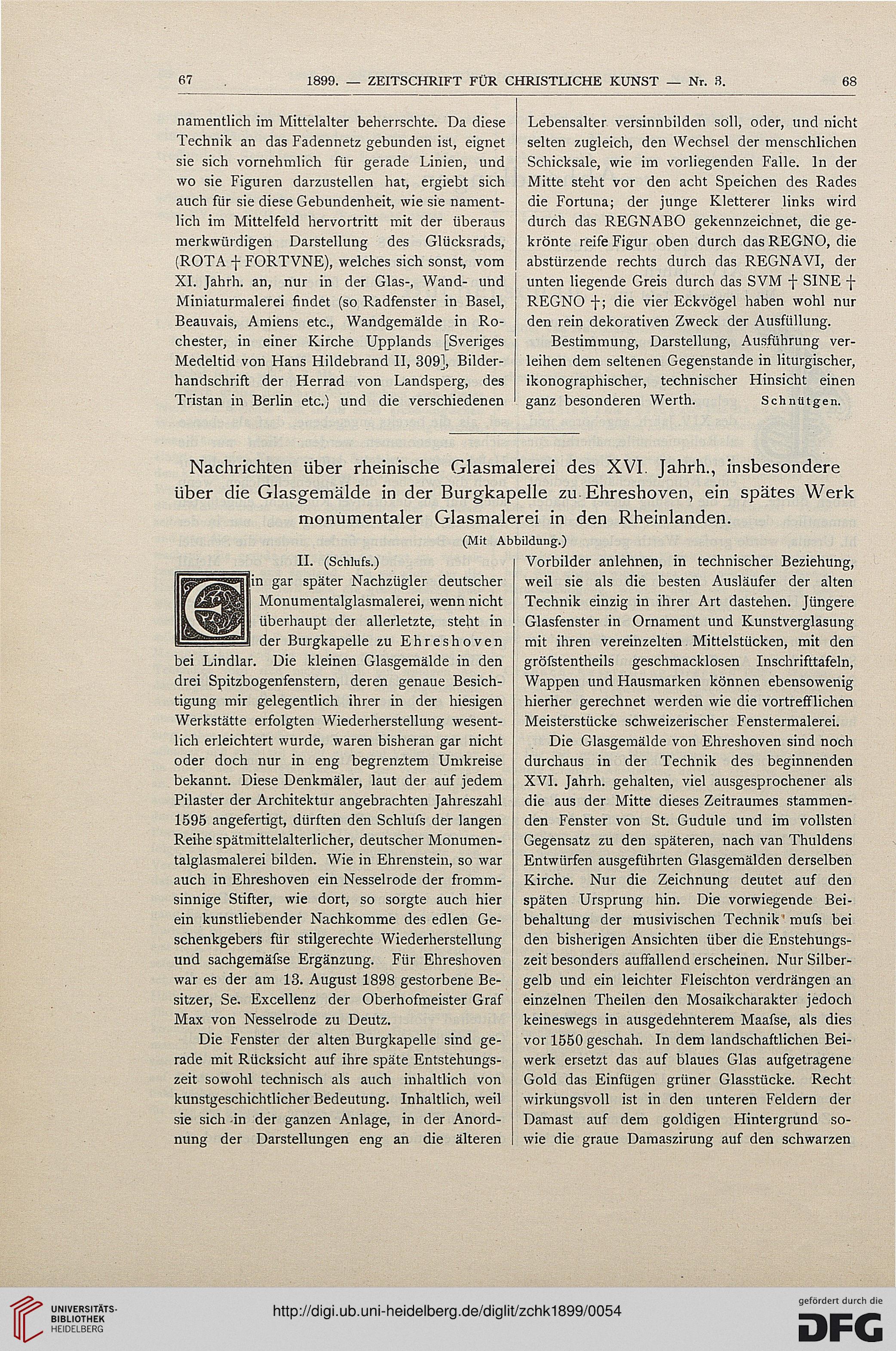67
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
namentlich im Mittelalter beherrschte. Da diese
Technik an das Fadennetz gebunden ist, eignet
sie sich vornehmlich für gerade Linien, und
wo sie Figuren darzustellen hat, ergiebt sich
auch für sie diese Gebundenheit, wie sie nament-
lich im Mittelfeld hervortritt mit der überaus
merkwürdigen Darstellung des Glücksrads,
(ROTA f FORTVNE), welches sich sonst, vom
XI. Jahrh. an, nur in der Glas-, Wand- und
Miniaturmalerei findet (so Radfenster in Basel,
Beauvais, Amiens etc., Wandgemälde in Ro-
chester, in einer Kirche Upplands [Sveriges
Medeltid von Hans Hildebrand II, 309], Bilder-
handschrift der Herrad von Landsperg, des
Tristan in Berlin etc.) und die verschiedenen
Lebensalter, versinnbilden soll, oder, und nicht
selten zugleich, den Wechsel der menschlichen
Schicksale, wie im vorliegenden Falle. In der
Mitte steht vor den acht Speichen des Rades
die Fortuna; der junge Kletterer links wird
durch das REGNABO gekennzeichnet, die ge-
krönte reife Figur oben durch dasREGNO, die
abstürzende rechts durch das REGNAVI, der
unten liegende Greis durch das SVM f SINE -f-
REGNO f; die vier Eckvögel haben wohl nur
den rein dekorativen Zweck der Ausfüllung.
Bestimmung, Darstellung, Ausführung ver-
leihen dem seltenen Gegenstande in liturgischer,
ikonographischer, technischer Hinsicht einen
ganz besonderen Werth. Schnütgen.
Nachrichten über rheinische Glasmalerei des XVI. Jahrh., insbesondere
über die Glasgemälde in der Burgkapelle zu Ehreshoven, ein spätes Werk
monumentaler Glasmalerei in den Rheinlanden.
(Mit Abbildung.)
IL (Schlufs.)
in gar später Nachzügler deutscher
Monumentalglasmalerei, wenn nicht
überhaupt der allerletzte, steht in
der Burgkapelle zu Ehreshoven
bei Lindlar. Die kleinen Glasgemälde in den
drei Spitzbogenfenstern, deren genaue Besich-
tigung mir gelegentlich ihrer in der hiesigen
Werkstätte erfolgten Wiederherstellung wesent-
lich erleichtert wurde, waren bisheran gar nicht
oder doch nur in eng begrenztem Umkreise
bekannt. Diese Denkmäler, laut der auf jedem
Pilaster der Architektur angebrachten Jahreszahl
1595 angefertigt, dürften den Schlufs der langen
Reihe spätmittelalterlicher, deutscher Monumen-
talglasmalerei bilden. Wie in Ehrenstein, so war
auch in Ehreshoven ein Nesselrode der fromm-
sinnige Stifter, wie dort, so sorgte auch hier
ein kunstliebender Nachkomme des edlen Ge-
schenkgebers für stilgerechte Wiederherstellung
und sachgemäfse Ergänzung. Für Ehreshoven
war es der am 13. August 1898 gestorbene Be-
sitzer, Se. Excellenz der Oberhofmeister Graf
Max von Nesselrode zu Deutz.
Die Fenster der alten Burgkapelle sind ge-
rade mit Rücksicht auf ihre späte Entstehungs-
zeit sowohl technisch als auch inhaltlich von
kunstgeschichtlicher Bedeutung. Inhaltlich, weil
sie sich -in der ganzen Anlage, in der Anord-
nung der Darstellungen eng an die älteren
Vorbilder anlehnen, in technischer Beziehung,
weil sie als die besten Ausläufer der alten
Technik einzig in ihrer Art dastehen. Jüngere
Glasfenster in Ornament und Kunstverglasung
mit ihren vereinzelten Mittelstücken, mit den
gröfstentheils geschmacklosen Inschrifttafeln,
Wappen und Hausmarken können ebensowenig
hierher gerechnet werden wie die vortrefflichen
Meisterstücke schweizerischer Fenstermalerei.
Die Glasgemälde von Ehreshoven sind noch
durchaus in der Technik des beginnenden
XVI. Jahrh. gehalten, viel ausgesprochener als
die aus der Mitte dieses Zeitraumes stammen-
den Fenster von St. Gudule und im vollsten
Gegensatz zu den späteren, nach van Thuldens
Entwürfen ausgeführten Glasgemälden derselben
Kirche. Nur die Zeichnung deutet auf den
späten Ursprung hin. Die vorwiegende Bei-
behaltung der musivischen Technik ■ mufs bei
den bisherigen Ansichten über die Enstehungs-
zeit besonders auffallend erscheinen. Nur Silber-
gelb und ein leichter Fleischton verdrängen an
einzelnen Theilen den Mosaikcharakter jedoch
keineswegs in ausgedehnterem Maafse, als dies
vor 1550 geschah. In dem landschaftlichen Bei-
werk ersetzt das auf blaues Glas aufgetragene
Gold das Einfügen grüner Glasstücke. Recht
wirkungsvoll ist in den unteren Feldern der
Damast auf dem goldigen Hintergrund so-
wie die graue Damaszirung auf den schwarzen
1899. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 3.
namentlich im Mittelalter beherrschte. Da diese
Technik an das Fadennetz gebunden ist, eignet
sie sich vornehmlich für gerade Linien, und
wo sie Figuren darzustellen hat, ergiebt sich
auch für sie diese Gebundenheit, wie sie nament-
lich im Mittelfeld hervortritt mit der überaus
merkwürdigen Darstellung des Glücksrads,
(ROTA f FORTVNE), welches sich sonst, vom
XI. Jahrh. an, nur in der Glas-, Wand- und
Miniaturmalerei findet (so Radfenster in Basel,
Beauvais, Amiens etc., Wandgemälde in Ro-
chester, in einer Kirche Upplands [Sveriges
Medeltid von Hans Hildebrand II, 309], Bilder-
handschrift der Herrad von Landsperg, des
Tristan in Berlin etc.) und die verschiedenen
Lebensalter, versinnbilden soll, oder, und nicht
selten zugleich, den Wechsel der menschlichen
Schicksale, wie im vorliegenden Falle. In der
Mitte steht vor den acht Speichen des Rades
die Fortuna; der junge Kletterer links wird
durch das REGNABO gekennzeichnet, die ge-
krönte reife Figur oben durch dasREGNO, die
abstürzende rechts durch das REGNAVI, der
unten liegende Greis durch das SVM f SINE -f-
REGNO f; die vier Eckvögel haben wohl nur
den rein dekorativen Zweck der Ausfüllung.
Bestimmung, Darstellung, Ausführung ver-
leihen dem seltenen Gegenstande in liturgischer,
ikonographischer, technischer Hinsicht einen
ganz besonderen Werth. Schnütgen.
Nachrichten über rheinische Glasmalerei des XVI. Jahrh., insbesondere
über die Glasgemälde in der Burgkapelle zu Ehreshoven, ein spätes Werk
monumentaler Glasmalerei in den Rheinlanden.
(Mit Abbildung.)
IL (Schlufs.)
in gar später Nachzügler deutscher
Monumentalglasmalerei, wenn nicht
überhaupt der allerletzte, steht in
der Burgkapelle zu Ehreshoven
bei Lindlar. Die kleinen Glasgemälde in den
drei Spitzbogenfenstern, deren genaue Besich-
tigung mir gelegentlich ihrer in der hiesigen
Werkstätte erfolgten Wiederherstellung wesent-
lich erleichtert wurde, waren bisheran gar nicht
oder doch nur in eng begrenztem Umkreise
bekannt. Diese Denkmäler, laut der auf jedem
Pilaster der Architektur angebrachten Jahreszahl
1595 angefertigt, dürften den Schlufs der langen
Reihe spätmittelalterlicher, deutscher Monumen-
talglasmalerei bilden. Wie in Ehrenstein, so war
auch in Ehreshoven ein Nesselrode der fromm-
sinnige Stifter, wie dort, so sorgte auch hier
ein kunstliebender Nachkomme des edlen Ge-
schenkgebers für stilgerechte Wiederherstellung
und sachgemäfse Ergänzung. Für Ehreshoven
war es der am 13. August 1898 gestorbene Be-
sitzer, Se. Excellenz der Oberhofmeister Graf
Max von Nesselrode zu Deutz.
Die Fenster der alten Burgkapelle sind ge-
rade mit Rücksicht auf ihre späte Entstehungs-
zeit sowohl technisch als auch inhaltlich von
kunstgeschichtlicher Bedeutung. Inhaltlich, weil
sie sich -in der ganzen Anlage, in der Anord-
nung der Darstellungen eng an die älteren
Vorbilder anlehnen, in technischer Beziehung,
weil sie als die besten Ausläufer der alten
Technik einzig in ihrer Art dastehen. Jüngere
Glasfenster in Ornament und Kunstverglasung
mit ihren vereinzelten Mittelstücken, mit den
gröfstentheils geschmacklosen Inschrifttafeln,
Wappen und Hausmarken können ebensowenig
hierher gerechnet werden wie die vortrefflichen
Meisterstücke schweizerischer Fenstermalerei.
Die Glasgemälde von Ehreshoven sind noch
durchaus in der Technik des beginnenden
XVI. Jahrh. gehalten, viel ausgesprochener als
die aus der Mitte dieses Zeitraumes stammen-
den Fenster von St. Gudule und im vollsten
Gegensatz zu den späteren, nach van Thuldens
Entwürfen ausgeführten Glasgemälden derselben
Kirche. Nur die Zeichnung deutet auf den
späten Ursprung hin. Die vorwiegende Bei-
behaltung der musivischen Technik ■ mufs bei
den bisherigen Ansichten über die Enstehungs-
zeit besonders auffallend erscheinen. Nur Silber-
gelb und ein leichter Fleischton verdrängen an
einzelnen Theilen den Mosaikcharakter jedoch
keineswegs in ausgedehnterem Maafse, als dies
vor 1550 geschah. In dem landschaftlichen Bei-
werk ersetzt das auf blaues Glas aufgetragene
Gold das Einfügen grüner Glasstücke. Recht
wirkungsvoll ist in den unteren Feldern der
Damast auf dem goldigen Hintergrund so-
wie die graue Damaszirung auf den schwarzen