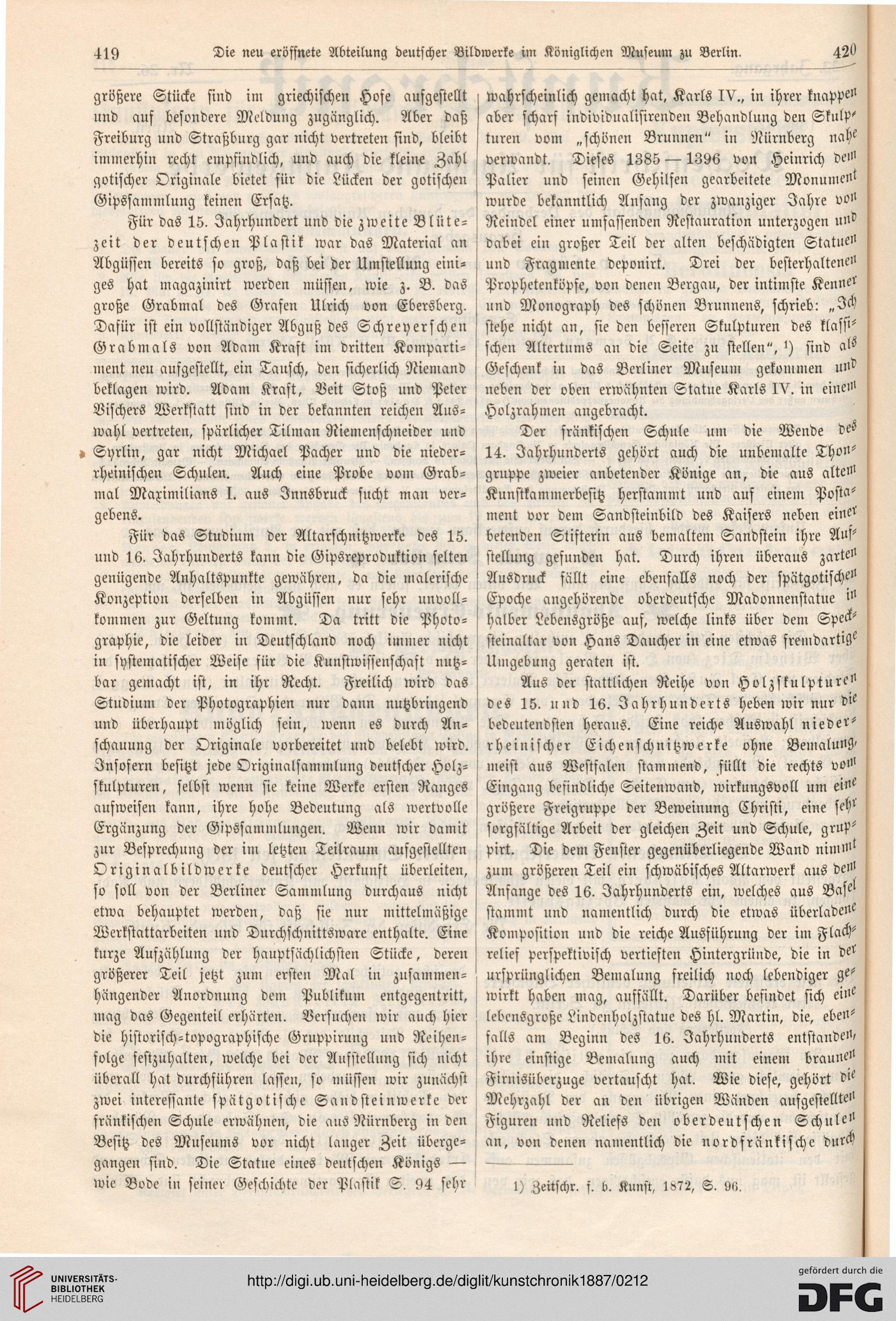419
Die neu eröffnete Abteilung deutscher Bildwerke im Königlichen Museum zu Berlin
420
größere Stücke sind ini griechischen Hose aufgestellt
und auf besondere Meldung zugänglich. Aber daß
Freiburg und Straßburg gar nicht vertreten sind, bleibt
immerhiu recht empfindlich, und auch die kleine Zahl
gotischer Originale bietet fiir die Lücken der gotischen
Gipssammlung keinen Ersatz.
Für das 15. Jahrhundert und die zweite Blüte-
zeit der deutschen Plastik war das Material an
Abgüssen bereits so groß, daß bei der Umstellung eini-
ges hat magazinirt werden müsien, wie z. B. das
große Grabmal des Grafen Ulrich von Ebersberg.
Dafür ist ein vollständiger Abguß des Schreyerscheu
Grabmals von Adam Krafl im drilten Komparti-
ment neu aufgestellt, ein Tausch, den sicherlich Nieniand
beklagen wird. Adam Kraft, Beit Stoß und Peter
Vischers Werkstatt sind in der bekannten reicheu Aus-
wahl vertreten, spärlicher Tilman Niemenschneider und
» Syrlin, gar nicht Michael Pacher und die nieder-
rheinischen Schulen. Auch eine Probe vom Grab-
mal Maximilians I. aus Jnnsbruck sucht man ver-
gebens.
FUr das Studium der Altarschnitzwerke des 15.
und 16. Jahrhunderts kann die Gipsreproduktion selten
genügende Anhaltspunkte gewähren, da die malerische
Konzeption derselben in Abgüssen nur sehr unvoll-
kommen zur Geltung kommt. Da tritt die Photo-
graphie, die leider in Deutschland noch immer nicht
in systematischer Weise für die Kunstwiffenschast nutz-
bar gemacht ist, in ihr Recht. Freilich wird das
Studium der Photographien nur dann nutzbringend
und überhaupt möglich seiu, wenn es durch An-
schauung der Originale vorbereitet und belebt wird.
Jnsofern besitzt jede Originalsammlung deutscher Holz-
skulpturen, selbst wenn sie keine Werke ersten Ranges
aufweisen kann, ihre hohe Bedeutung als wertvotle
Ergänzung der Gipssammlungen. Wenn wir damit
zur Besprechung der im letzten Teilraum ausgestellten
Originalbildwerke deutschcr Herkunst llberleiten,
so soll von der Berliner Sammlung durchaus nicht
etwa behauptet werden, daß sie nur mittelmäßige
Werkstattarbeiten nnd Durchschnittsware enthalte. Eine
kurze Aufzählung der hauptsächlichsten Stllcke, deren
größerer Teil jetzt zum ersten Mal in zusammen-
hängender Anordnung dem Publikum entgegentritt,
mag das Gegenteil erhärten. Versuchen wir auch hier
die historisch-topographische Gruppirung und Reihen-
solge festzuhalten, welche bei der Aufstelliing sich nicht
überall hat durchfllhren lassen, so inüsien wir zunächst
zwei interesianle spätgotische Saudsteinwerke der
sränkischen Schule erwähnen, die ans Nürnberg in den
Besitz des Museums vvr nicht langer Zeit überge-
gangen sind. Die Statue eines deutschen Königs —
wie Bode in seiner Geschichte der Plastik S. 94 sehr
wahrscheinlich gemacht hat, Karls IV., in ihrer knappe"
aber scharf individualisirenden Behandlung den Skulp^
turen vom „schönen Brunnen" in Nürnberg nahe
verwandt. Dieses 1385 —1396 Vvn Heinrich de>»
Palicr und seinen Gehilfen gearbeitete Monumenl
wurde bekanntlich Anfang der zwanziger Jahre vo»
Reindel einer umfasienden Restauration unterzogen u»d
dabei ein großer Teil der alten beschädigten Statue»
und Fragmente deponirt. Drei der besterhaltene»
Prophetenköpfe, von denen Bergau, der intimste Kenne»
und Monograph des schönen Brunnens, schrieb: ,,Jä)
stehe nicht an, sie den besieren Skulpturen des klassi^
schen Altertums an die Seite zu stellen", ') sind ak^
Geschenk in das Bcrliner Museum gekvmmen u>F
neben der oben erwähnten Statue Karls IV. in ei»e>»
Holzrahmen angebracht.
Der fränkischen Schnle um die Wende des
14. Jahrhunderts gehört auch die unbemalte Tho»"
gruppe zweier anbetender Könige an, die aus alte»>
Kunstkammerbesitz herstammt und auf einem Posta^
ment vor dem Sandsteinbild des Kaisers neben einc»
betenden Stifterin aus bemaltem Sandstein ihre A»si
stellung gefundeu hat. Durch ihreu überaus zarte»
Ausdruck fällt eine ebenfalls noch der spätgotische»
Epoche angehörende oberdeutsche Madonnenstatue >»
halber Lebensgröße auf, welche links über dem Spe^
steinaltar von Hans Daucher in eine etwas fremdartige
llmgebung geraten ist.
Aus der stattlichen Reihe von Holzskulpture»
des 15. und 16. Jahrhunderts heben wir nur d>e
bedeutendsten heraus. Eine reiche Auswahl niede»^
rheinischer Eichenschnitzwerke ohne Bemalu»8'
nieist aus Westfalen stammend, süllt die rechts vo>»
Eingang befindliche Seitenwand, wirkungsvoll um ei»e
größere Freigruppe der Beweinung Christi, eine sch>
sorgfältige Arbeit der gleichen Zeit und Schule, grup^
pirt. Die dem Fenster gegenüberliegende Wand nini»^
zuni größereu Teil ein schwäbisches Altarwerk aus de»>
Anfange des 16. Jahrhunderts ein, welches aus Base^
stammt und namentlich dnrch die etwas überlade»c
Komposition und die reiche Aussührung der im Flach^
relief perspektivisch vertiesten Hintergründe, die in de»
ursprünglichen Bemalung freilich noch lebendiger ge^
wirkt haben mag, auffällt. Darllber befindet sich ei>»'
lebensgrvße Lindcnholzstatue des hl. Martin, die, ebew
falls am Beginn des 16. Jahrhunderts entstande»,
ihre einstige Bemalung auch mit einem brau»e»
Firnisüberzuge vertauscht hat. Wie diese, gehört d>e
Mehrzahl der an den übrigen Wänden aufgestellte»
Figuren und Reliefs den oberdeutschen Schule»
an, von denen namentlich die nordsränkische durch
1) Zeitschr. f. b. Kunst, 1872, S. 9».
Die neu eröffnete Abteilung deutscher Bildwerke im Königlichen Museum zu Berlin
420
größere Stücke sind ini griechischen Hose aufgestellt
und auf besondere Meldung zugänglich. Aber daß
Freiburg und Straßburg gar nicht vertreten sind, bleibt
immerhiu recht empfindlich, und auch die kleine Zahl
gotischer Originale bietet fiir die Lücken der gotischen
Gipssammlung keinen Ersatz.
Für das 15. Jahrhundert und die zweite Blüte-
zeit der deutschen Plastik war das Material an
Abgüssen bereits so groß, daß bei der Umstellung eini-
ges hat magazinirt werden müsien, wie z. B. das
große Grabmal des Grafen Ulrich von Ebersberg.
Dafür ist ein vollständiger Abguß des Schreyerscheu
Grabmals von Adam Krafl im drilten Komparti-
ment neu aufgestellt, ein Tausch, den sicherlich Nieniand
beklagen wird. Adam Kraft, Beit Stoß und Peter
Vischers Werkstatt sind in der bekannten reicheu Aus-
wahl vertreten, spärlicher Tilman Niemenschneider und
» Syrlin, gar nicht Michael Pacher und die nieder-
rheinischen Schulen. Auch eine Probe vom Grab-
mal Maximilians I. aus Jnnsbruck sucht man ver-
gebens.
FUr das Studium der Altarschnitzwerke des 15.
und 16. Jahrhunderts kann die Gipsreproduktion selten
genügende Anhaltspunkte gewähren, da die malerische
Konzeption derselben in Abgüssen nur sehr unvoll-
kommen zur Geltung kommt. Da tritt die Photo-
graphie, die leider in Deutschland noch immer nicht
in systematischer Weise für die Kunstwiffenschast nutz-
bar gemacht ist, in ihr Recht. Freilich wird das
Studium der Photographien nur dann nutzbringend
und überhaupt möglich seiu, wenn es durch An-
schauung der Originale vorbereitet und belebt wird.
Jnsofern besitzt jede Originalsammlung deutscher Holz-
skulpturen, selbst wenn sie keine Werke ersten Ranges
aufweisen kann, ihre hohe Bedeutung als wertvotle
Ergänzung der Gipssammlungen. Wenn wir damit
zur Besprechung der im letzten Teilraum ausgestellten
Originalbildwerke deutschcr Herkunst llberleiten,
so soll von der Berliner Sammlung durchaus nicht
etwa behauptet werden, daß sie nur mittelmäßige
Werkstattarbeiten nnd Durchschnittsware enthalte. Eine
kurze Aufzählung der hauptsächlichsten Stllcke, deren
größerer Teil jetzt zum ersten Mal in zusammen-
hängender Anordnung dem Publikum entgegentritt,
mag das Gegenteil erhärten. Versuchen wir auch hier
die historisch-topographische Gruppirung und Reihen-
solge festzuhalten, welche bei der Aufstelliing sich nicht
überall hat durchfllhren lassen, so inüsien wir zunächst
zwei interesianle spätgotische Saudsteinwerke der
sränkischen Schule erwähnen, die ans Nürnberg in den
Besitz des Museums vvr nicht langer Zeit überge-
gangen sind. Die Statue eines deutschen Königs —
wie Bode in seiner Geschichte der Plastik S. 94 sehr
wahrscheinlich gemacht hat, Karls IV., in ihrer knappe"
aber scharf individualisirenden Behandlung den Skulp^
turen vom „schönen Brunnen" in Nürnberg nahe
verwandt. Dieses 1385 —1396 Vvn Heinrich de>»
Palicr und seinen Gehilfen gearbeitete Monumenl
wurde bekanntlich Anfang der zwanziger Jahre vo»
Reindel einer umfasienden Restauration unterzogen u»d
dabei ein großer Teil der alten beschädigten Statue»
und Fragmente deponirt. Drei der besterhaltene»
Prophetenköpfe, von denen Bergau, der intimste Kenne»
und Monograph des schönen Brunnens, schrieb: ,,Jä)
stehe nicht an, sie den besieren Skulpturen des klassi^
schen Altertums an die Seite zu stellen", ') sind ak^
Geschenk in das Bcrliner Museum gekvmmen u>F
neben der oben erwähnten Statue Karls IV. in ei»e>»
Holzrahmen angebracht.
Der fränkischen Schnle um die Wende des
14. Jahrhunderts gehört auch die unbemalte Tho»"
gruppe zweier anbetender Könige an, die aus alte»>
Kunstkammerbesitz herstammt und auf einem Posta^
ment vor dem Sandsteinbild des Kaisers neben einc»
betenden Stifterin aus bemaltem Sandstein ihre A»si
stellung gefundeu hat. Durch ihreu überaus zarte»
Ausdruck fällt eine ebenfalls noch der spätgotische»
Epoche angehörende oberdeutsche Madonnenstatue >»
halber Lebensgröße auf, welche links über dem Spe^
steinaltar von Hans Daucher in eine etwas fremdartige
llmgebung geraten ist.
Aus der stattlichen Reihe von Holzskulpture»
des 15. und 16. Jahrhunderts heben wir nur d>e
bedeutendsten heraus. Eine reiche Auswahl niede»^
rheinischer Eichenschnitzwerke ohne Bemalu»8'
nieist aus Westfalen stammend, süllt die rechts vo>»
Eingang befindliche Seitenwand, wirkungsvoll um ei»e
größere Freigruppe der Beweinung Christi, eine sch>
sorgfältige Arbeit der gleichen Zeit und Schule, grup^
pirt. Die dem Fenster gegenüberliegende Wand nini»^
zuni größereu Teil ein schwäbisches Altarwerk aus de»>
Anfange des 16. Jahrhunderts ein, welches aus Base^
stammt und namentlich dnrch die etwas überlade»c
Komposition und die reiche Aussührung der im Flach^
relief perspektivisch vertiesten Hintergründe, die in de»
ursprünglichen Bemalung freilich noch lebendiger ge^
wirkt haben mag, auffällt. Darllber befindet sich ei>»'
lebensgrvße Lindcnholzstatue des hl. Martin, die, ebew
falls am Beginn des 16. Jahrhunderts entstande»,
ihre einstige Bemalung auch mit einem brau»e»
Firnisüberzuge vertauscht hat. Wie diese, gehört d>e
Mehrzahl der an den übrigen Wänden aufgestellte»
Figuren und Reliefs den oberdeutschen Schule»
an, von denen namentlich die nordsränkische durch
1) Zeitschr. f. b. Kunst, 1872, S. 9».