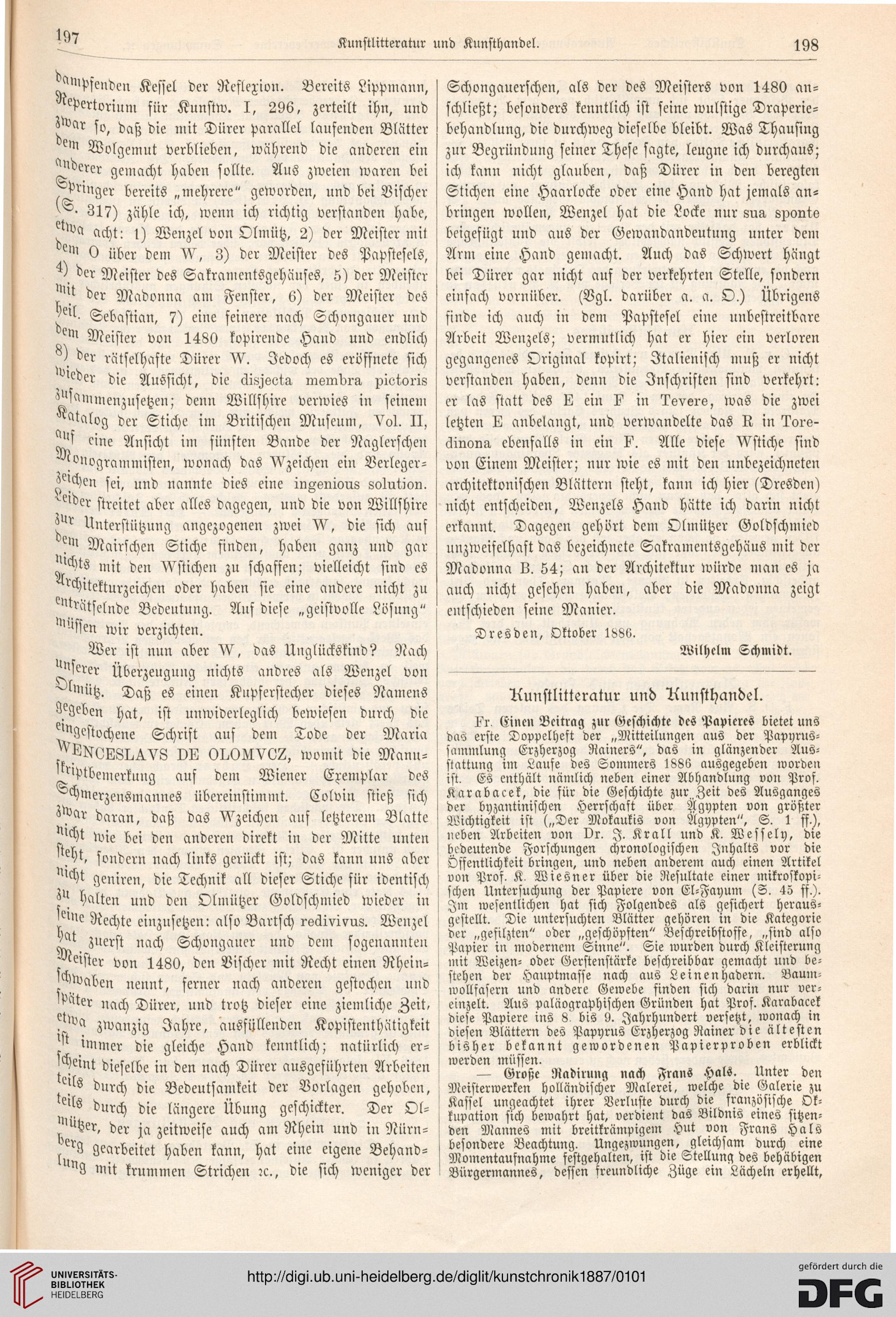197
Kunstlitteratur und Kunsthandel.
198
cuupfxnden Kessel der Rcslexivn. Bercits Lippmann,
^Pertorinm siir Kunstw. I, 296, zerteilt ihn, und
^cir so, daß die mit Diirer parallel laufenden Blätter
Wolgemut verblieben, während die anderen ein
^'derer gemacht haben sollte. Aus zweien waren bei
pringer bereits „mehrere" geworden, und bei Vischer
317) zähle ich, wenn ich richtig verstanden habe,
acht: i) Wenzel von Olmiitz, 2) dcr Meister mit
0 tibcr dem IV, 3) der Meister des Papstesels,
4) der Meister des Sakranientsgehäuses, 5) der Meister
H'U der Madonna am Fenster, 6) der Meister dcs
^>l. Sebnstian, 7) eine feinere nach Schongauer und
Meister von 1480 kopirende Hand und endlich
der rätselhafte Dürer IV. Jedoch es eröffnete sich
^ieder die Aussicht, die clisssotu msmbra piotori8
^^ciiiinienzusetzen; denn Willshire verwies in seinem
^»talog der Stiche im Britischen Museum, Vol. II,
cine Ansicht im fiinften Bande der Naglerschen
svnogrammisten, wonach das IVzeichen ein Verleger-
^vichen sei, und nannte dies eine 1nAsniori8 8o1ution.
^eider streitet aber alles dagegen, und die von Willshire
Ilnterstützung angezogenen zwei IV, die sich aus
Mairschen Stiche finden, habcn ganz und gar
u>chts niit den IVstichen zu schaffen; vielleicht sind es
^chitekturzeichen oder haben sie eine andere nicht zu
^llvätselnde Bcdeutnng. Auf diese „geistvolle Lösung"
"ntfien wir verzichten.
Wer ist nun aber IV, das Unglückskind? Nach
^>serer Überzeugung nichts andrcs als Wenzel von
ünütz. Daß es einen Knpferstecher dieses Namens
livgeben hat, ist unwidcrleglich bcwiesen durch die
^"gestochene Schrift aus dem Tode der Maria
'^U0U8Uä.V8 VU 0V0NV62, womit die Mann-
llnptbenierkung auf dem Wiener Exemplar des
^chnierzensmannes übereinstimmt. Colvin stieß sich
ächcir daran, daß das IVzeichen anf letzterem Blatte
^cht wie bei dcn anderen direkt in der Mitte unten
.lst, sondcrn nach links gerückt ist; das kann uns aber
^cht geniren, die Technik all dieser Stiche sür identisch
^ halten und den Olmützer Goldschmied wieder in
ü'Uie Rechte einzusetzen: also Bartsch rsäivivrm. Wenzel
wt Zuerst nach Schongauer und dem sogeiiannten
T^eister gon 1480, den Bischer mit Recht einen Rhein-
)wwaben iicnnt, ferner nach anderen gestochen nnd
'päter nnch Dllrer, und trotz dieser eine zicmliche Zeit,
^'ci zwanzig Jahre, ausfijllenden Kopistenthätigkeit
ü iinnier die gleiche Hand kenntlich; natürlich er-
schvint dieselbe in den nach Dürer ausgeführten Arbeiten
v>ls durch die Bedeutsamkeit der Vorlagen gehobcn,
vils durch die längere Übung geschickter. Der Ol-
'"ützer, der ja zeitweise auch am Rhein und in Nürn-
'^'8 gearbeitet haben kann, hat eine eigene Behand-
'W mit krummen Strichen ic., die sich weniger der
Schongauerschen, als der des Meisters von 1480 an-
schließt; besonders kenntlich ist seine wulstige Draperie-
behandlung, die durchweg dicselbe bleibt. Was Thausing
zur Begründung seiner These sagte, leugne ich durchaus;
ich kann nicht glauben, daß Dürer in den beregten
Stichen eine Haarlocke oder eine Hand hat jemals an-
bringen wollen, Wenzel hat die Locke nur 8ns. sponts
beigefügt und aus der Gewandandeutung unter dem
Arm eine Hand gemacht. Auch das Schwert hängt
bei Dürer gar nicht auf der verkehrten Stelle, sondern
einsach vornüber. (Vgl. darüber a. a. O.) Übrigens
finde ich auch in dem Papstesel eine unbestreitbare
Arbeit Wenzels; vermutlich hat er hier ein verloren
gegangencs Original kopirt; Jtalienisch muß cr nicht
verstanden haben, denn die Jnschriften sind verkehrt:
er las statt des V ein v in vsvsrs, was die zwei
letzten V anbelangt, und verwandelte das li in Vors-
äinoim. ebenfalls in ein v. Alle diese IVstiche sind
von Einem Meister; nur wie es mit den unbezeichneten
architektonischen Blättcrn steht, kann ich hier (Dresdcn)
nicht entscheiden, Wenzels Hand hätte ich darin nicht
erkannt. Dagegen gehört dem Olmützer Goldschmied
unzweiselhaft das bezeichncte Sakramentsgehäus mit dcr
Madonna 8. 54; an der Architektur würde man es ja
auch nicht gcsehen haben, aber die Madonna zeigt
entschieden seine Manier.
Dresden, Oktober 1886.
Wilhclm Schmidt.
Amistlitteratur und Aunsthandel.
llr. Einen Beitrag zur Geschichte de§ Papieres bietet uns
das erste Doppelheft der „Mitteilungen aus der Papyrus-
saimnlung Erzherzog Rainers", das in glänzender Aus-
stattung im Lause des Sommers 1886 ausgegeben worden
ist. Es enthält nämlich neben einer Abhandlung von Prof.
Karabacek, die für die Geschichte zur Zeit des Ausganges
der byzantinischen Herrschast über Ägypten von größter
Wichtigkeit ist („Der Mokaukis von Ägypten", S. 1 ff.),
neben Arbeiten von Or. I. Krall und K. Wessely, die
bcdeutende Forschungen chronologischen Jnhalts vor die
Offentlichksit bringen, und nsben anderem auch einen Artikel
von Prof. K. Wiesner über die Resultale einer mikroskopi-
schen Untersuchung der Papiere von El-Fayum (S. 45 ff.).
Jm wesentlichen hat sich Folgendes als gesichert heraus-
gestellt. Die untersuchten Blätter gehören in die Kategorie
der „gefilzten" oder „geschöpsten" Beschreibstoffe, „sind also
Papier in modernem Sinne". Sie wurden durch Kleisterung
mit Weizen- oder Gerstenstärke beschreibbar gemacht und be-
stehen der Hauptmasse nach aus Leinenhadern. Baum-
wollfasern und andere Gewebe finden sich darin nur ver-
einzelt. Aus paläographischen Gründen hat Prof. Karabacek
diese Papiere ins 8 bis 9. Jahrhundert versetzt, wonach in
diesen Blättern des Papyrus Erzherzog Rainer die ältesten
bisher bekannt gewordenen Papierproben erblickt
werden mllffsn.
— Große Radirung nach Frans Hals. Unter den
Meisterwerken hollandischer Malerei, welche die Galerie zu
Kassel ungeachtet ihrer Verluste durch die französische Ok-
kupation sich bewahrt hat, verdient das Bildnis eines sitzen-
den Mannes mit breitkrämpigem Hut von Frans Hals
besondere Beachtung. Ungezwungen, gleichsam durch eine
Momentaufnahme festgehallen, ist die Stellung des behäbigen
Bürgermannes, dessen freundliche Züge ein Lächeln erhellt,
Kunstlitteratur und Kunsthandel.
198
cuupfxnden Kessel der Rcslexivn. Bercits Lippmann,
^Pertorinm siir Kunstw. I, 296, zerteilt ihn, und
^cir so, daß die mit Diirer parallel laufenden Blätter
Wolgemut verblieben, während die anderen ein
^'derer gemacht haben sollte. Aus zweien waren bei
pringer bereits „mehrere" geworden, und bei Vischer
317) zähle ich, wenn ich richtig verstanden habe,
acht: i) Wenzel von Olmiitz, 2) dcr Meister mit
0 tibcr dem IV, 3) der Meister des Papstesels,
4) der Meister des Sakranientsgehäuses, 5) der Meister
H'U der Madonna am Fenster, 6) der Meister dcs
^>l. Sebnstian, 7) eine feinere nach Schongauer und
Meister von 1480 kopirende Hand und endlich
der rätselhafte Dürer IV. Jedoch es eröffnete sich
^ieder die Aussicht, die clisssotu msmbra piotori8
^^ciiiinienzusetzen; denn Willshire verwies in seinem
^»talog der Stiche im Britischen Museum, Vol. II,
cine Ansicht im fiinften Bande der Naglerschen
svnogrammisten, wonach das IVzeichen ein Verleger-
^vichen sei, und nannte dies eine 1nAsniori8 8o1ution.
^eider streitet aber alles dagegen, und die von Willshire
Ilnterstützung angezogenen zwei IV, die sich aus
Mairschen Stiche finden, habcn ganz und gar
u>chts niit den IVstichen zu schaffen; vielleicht sind es
^chitekturzeichen oder haben sie eine andere nicht zu
^llvätselnde Bcdeutnng. Auf diese „geistvolle Lösung"
"ntfien wir verzichten.
Wer ist nun aber IV, das Unglückskind? Nach
^>serer Überzeugung nichts andrcs als Wenzel von
ünütz. Daß es einen Knpferstecher dieses Namens
livgeben hat, ist unwidcrleglich bcwiesen durch die
^"gestochene Schrift aus dem Tode der Maria
'^U0U8Uä.V8 VU 0V0NV62, womit die Mann-
llnptbenierkung auf dem Wiener Exemplar des
^chnierzensmannes übereinstimmt. Colvin stieß sich
ächcir daran, daß das IVzeichen anf letzterem Blatte
^cht wie bei dcn anderen direkt in der Mitte unten
.lst, sondcrn nach links gerückt ist; das kann uns aber
^cht geniren, die Technik all dieser Stiche sür identisch
^ halten und den Olmützer Goldschmied wieder in
ü'Uie Rechte einzusetzen: also Bartsch rsäivivrm. Wenzel
wt Zuerst nach Schongauer und dem sogeiiannten
T^eister gon 1480, den Bischer mit Recht einen Rhein-
)wwaben iicnnt, ferner nach anderen gestochen nnd
'päter nnch Dllrer, und trotz dieser eine zicmliche Zeit,
^'ci zwanzig Jahre, ausfijllenden Kopistenthätigkeit
ü iinnier die gleiche Hand kenntlich; natürlich er-
schvint dieselbe in den nach Dürer ausgeführten Arbeiten
v>ls durch die Bedeutsamkeit der Vorlagen gehobcn,
vils durch die längere Übung geschickter. Der Ol-
'"ützer, der ja zeitweise auch am Rhein und in Nürn-
'^'8 gearbeitet haben kann, hat eine eigene Behand-
'W mit krummen Strichen ic., die sich weniger der
Schongauerschen, als der des Meisters von 1480 an-
schließt; besonders kenntlich ist seine wulstige Draperie-
behandlung, die durchweg dicselbe bleibt. Was Thausing
zur Begründung seiner These sagte, leugne ich durchaus;
ich kann nicht glauben, daß Dürer in den beregten
Stichen eine Haarlocke oder eine Hand hat jemals an-
bringen wollen, Wenzel hat die Locke nur 8ns. sponts
beigefügt und aus der Gewandandeutung unter dem
Arm eine Hand gemacht. Auch das Schwert hängt
bei Dürer gar nicht auf der verkehrten Stelle, sondern
einsach vornüber. (Vgl. darüber a. a. O.) Übrigens
finde ich auch in dem Papstesel eine unbestreitbare
Arbeit Wenzels; vermutlich hat er hier ein verloren
gegangencs Original kopirt; Jtalienisch muß cr nicht
verstanden haben, denn die Jnschriften sind verkehrt:
er las statt des V ein v in vsvsrs, was die zwei
letzten V anbelangt, und verwandelte das li in Vors-
äinoim. ebenfalls in ein v. Alle diese IVstiche sind
von Einem Meister; nur wie es mit den unbezeichneten
architektonischen Blättcrn steht, kann ich hier (Dresdcn)
nicht entscheiden, Wenzels Hand hätte ich darin nicht
erkannt. Dagegen gehört dem Olmützer Goldschmied
unzweiselhaft das bezeichncte Sakramentsgehäus mit dcr
Madonna 8. 54; an der Architektur würde man es ja
auch nicht gcsehen haben, aber die Madonna zeigt
entschieden seine Manier.
Dresden, Oktober 1886.
Wilhclm Schmidt.
Amistlitteratur und Aunsthandel.
llr. Einen Beitrag zur Geschichte de§ Papieres bietet uns
das erste Doppelheft der „Mitteilungen aus der Papyrus-
saimnlung Erzherzog Rainers", das in glänzender Aus-
stattung im Lause des Sommers 1886 ausgegeben worden
ist. Es enthält nämlich neben einer Abhandlung von Prof.
Karabacek, die für die Geschichte zur Zeit des Ausganges
der byzantinischen Herrschast über Ägypten von größter
Wichtigkeit ist („Der Mokaukis von Ägypten", S. 1 ff.),
neben Arbeiten von Or. I. Krall und K. Wessely, die
bcdeutende Forschungen chronologischen Jnhalts vor die
Offentlichksit bringen, und nsben anderem auch einen Artikel
von Prof. K. Wiesner über die Resultale einer mikroskopi-
schen Untersuchung der Papiere von El-Fayum (S. 45 ff.).
Jm wesentlichen hat sich Folgendes als gesichert heraus-
gestellt. Die untersuchten Blätter gehören in die Kategorie
der „gefilzten" oder „geschöpsten" Beschreibstoffe, „sind also
Papier in modernem Sinne". Sie wurden durch Kleisterung
mit Weizen- oder Gerstenstärke beschreibbar gemacht und be-
stehen der Hauptmasse nach aus Leinenhadern. Baum-
wollfasern und andere Gewebe finden sich darin nur ver-
einzelt. Aus paläographischen Gründen hat Prof. Karabacek
diese Papiere ins 8 bis 9. Jahrhundert versetzt, wonach in
diesen Blättern des Papyrus Erzherzog Rainer die ältesten
bisher bekannt gewordenen Papierproben erblickt
werden mllffsn.
— Große Radirung nach Frans Hals. Unter den
Meisterwerken hollandischer Malerei, welche die Galerie zu
Kassel ungeachtet ihrer Verluste durch die französische Ok-
kupation sich bewahrt hat, verdient das Bildnis eines sitzen-
den Mannes mit breitkrämpigem Hut von Frans Hals
besondere Beachtung. Ungezwungen, gleichsam durch eine
Momentaufnahme festgehallen, ist die Stellung des behäbigen
Bürgermannes, dessen freundliche Züge ein Lächeln erhellt,