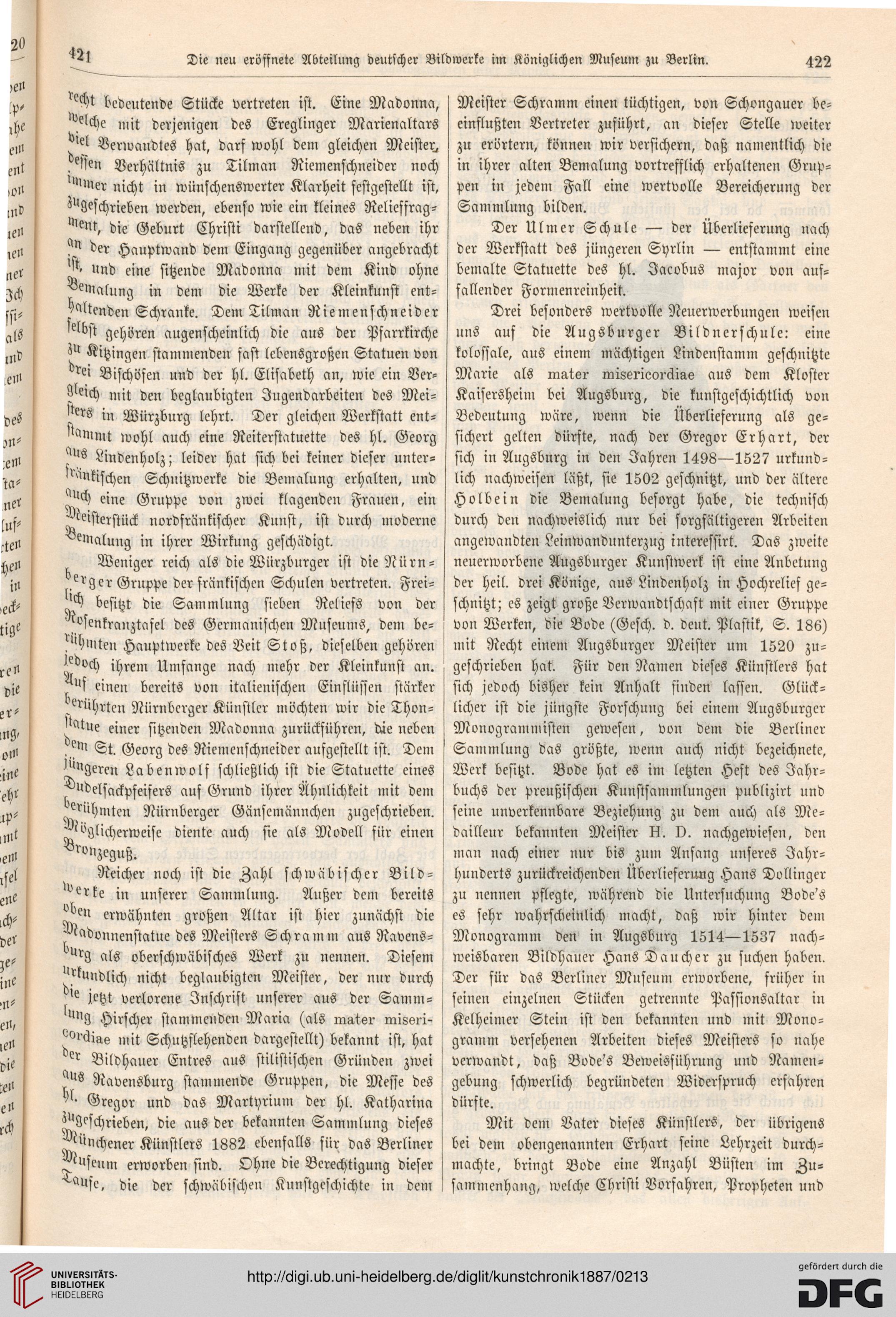Die neu eröffnete Abteilung deuticher Bildwerke im Königlichen Museum zu Berlin.
422
42s
bebcutende Stucke vertreten ist. Eine Madonna,
^kche niit derjenigen des Ereglinger Marienaltars
^t Berwandles hat, darf wohl dem gleichen Meister,
^dlsen Verhältnis zu Tilman Riemenschneider noch
^iiiier nicht in wünschenswerter Klarheit festgestellt ist,
^geschriebxn werden, ebenso wie ein kleines Relieffrag-
"'^nt, dw Geburt Christi darstellend, das neben ihr
der Hauptwand dem Eingang gegenüber angebracht
und eine sitzende Madonna mit dem Kind ohne
^viiialung in dem die Werke der Kleinkunst ent-
^ciltenden Schrauke. Dem Tilman Riemenschneider
'^tbst gehören augenscheinlich die aus der Pfarrkirche
Kitzingen stanimenden fast lebensgroßen Statuen von
^vi Bischöfen und der hl. Elisabeth an, wie ein Ber-
^kich ii,st den beglaubigten Jugendarbeiten des Mei-
liers i„ Würzburg lehrt. Der gleichen Werkstatt ent-
"kniint wohl auch eine Reiterstatuette des hl. Georg
Nus Lindenholz; leider hat sich bei keiner dieser unter-
ll'nnkischxa Schnitzwerke die Bemalung erhalten, und
eine Gruppe von zwci klagenden Frauen, ein
-ieisterstüst nordfränkischer Kunst, ist durch moderne
^Nialung in ihrer Wirkung geschädigt.
Weniger reich als die Würzburger ist die Nürn-
/rger Gruppe der fränkischcn Schulen vertreten. Frei-
Ph bcsitzt die Sammlung sieben Reliess von der
.nsenkranztasel des Germanischen Muscums, dem be-
^"hniteu Hauptwcrke des Veit Stoß, dieselben gehören
^vch ihrx„i Umfange nach mehr der Kleinkunst an.
^ si einen bcrcits von italienischen Einflüssen stärker
'vrührten Nürnbcrger Künstlcr möchten wir die Thon-
^ntue einer sitzenden Madonna zurllckführen, die nebcn
/'ni St. Georg des Riemenschneider aufgestellt ist. Dem
^Ngeren Labenwolf schließlich ist die Statuctte eines
^belsackpfeifers auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit dem
'vriihmten Nürnberger Gänsemännchen zugeschrieben.
^'vglicherweise diente auch sie als Modell für einen
^wnzeguß.
Reicher noch ist die Zahl schwäbischer Bild-
^vrke in unserer Sammlung. Außer dem bereits
nben erwähnten großen Altar ist hier zunächst die
-Radonnenstatue des Meisters Schramm aus Ravens-
als oberschwäbisches Werk zu nennen. Diesem
^Auiidlich nicht beglaubiglcn Meister, der nur durch
^ jetzt verlorene Jnschrist unserer aus der Samm-
^""g Hirscher stammeuden Maria (als inatsr inissri-
^räiaa mit Schutzflehenden dargestellt) bekannt ist, hat
^ Bildhauer Entres aus stilistischen Gründen zwei
Navensburg stammende Gruppen, die Mesie des
Gregor und das Martyrium der hl. Katharina
^gkschrieben, die aus der bekannten Sammlung dieses
^inchener Künstlers 1882 ebenfalls sür das Berliner
^^useiim erworben sind. Ohne die Berechtigung dieser
^^ufc, dix tzer schwäbischen Kunstgcschichte in dem
Meister Schramm einen tüchtigen, von Schongauer be-
einflußten Vertreter zuführt, an dieser Stelle weiter
zu erörtern, können wir versichern, daß namentlich dic
in ihrer alten Bemalung vortrefflich erhaltenen Grup-
pen in jedem Fall eine wertvolle Bereicherung der
Sammlung bilden.
Der Ulmer Schule — der Überlieferung nach
der Werkstatt des jüngeren Syrlin — entstammt eine
bemalte Statuette des hl. Jacobus major von auf-
fallender Formenreinheit.
Drei besonders wertvolle Neuerwerbungen weisen
nns auf die Augsburger Bildnerschule: eine
kolossale, aus einem mächtigen Lindenstamm geschnitzte
Marie als inatsr iniserieoräias aus dem Kloster
Kaisersheim bei Augsburg, die kunstgeschichtlich von
Bedeutuug wäre, weun die Überlieferung als ge-
sichert gelten dürfte, nach der Gregor Erhart, der
sich in Augsburg in den Jahren 1498—1527 urkund-
lich uachweisen läßt, sie 1502 geschnitzt, und der ältere
Holbein die Bemalung besorgt habe, die technisch
durch den nachweislich nur bei sorgfältigeren Arbeiten
angewandten Leinwandunterzug interessirt. Das zweite
neuerworbene Augsburger Kuustwerk ist eine Anbetung
der heil. drei Kvnige, aus Lindenholz in Hochrelief ge-
schnitzt; es zeigt große Verwaudtschaft mit einer Gruppe
von Werken, die Bvde (Gesch. d. deut. Plastik, S. 186)
mit Recht eincm Augsburger Meister um 1520 zu-
geschrieben hat. Für den Namen dieses Künstlers hnt
sich jedoch bisher kein Anhalt finden lassen. Glück-
licher ist die jüngste Forschung bei einem Augsburgcr
Monogrammisten gewesen, von dem die Berliner
Sammlung das größte, wenn auch nicht bezeichncte,
Wcrk besitzt. Bode hat es ini letztcn Heft des Jahr-
buchs der preußischen Kunstsammlungen publizirt und
seine unverkennbare Beziehung zu dem auch als Me-
dailleur bekannten Meister 8. O. nachgewiesen, den
man nach einer nur bis zum Ansang unseres Jahr-
hunderts zurückreichenden Überlieferung Hans Dvllinger
zu nennen pflegte, während die Untersnchung Bode's
es sehr wahrscbeinlich macht, daß wir hinter dem
Monogramm den in Augsburg 1514—1537 nach-
weisbaren Bildhauer Hans Daucher zu suchen haben.
Der für das Berliner Museum erworbene, früher in
seinen einzelnen Stücken getrennte Passionsaltar in
Kelheimer Stein ist den bekannten und mit Mono-
gramm versehenen Arbeiten dieses Meisters so nahe
verwandt, daß Bvde's Beweisführung und Nameu-
gebung schwerlich begründeten Widerspruch erfahrcn
dürfte.
Mit dem Vater dieses Künstlers, der übrigens
bei dem obengenannten Erhart seine Lehrzeit durch-
machte, bringt Bode eine Anzahl Büsten im Zu-
sammenhnng, welche Christi Borfahren, Propheten und
422
42s
bebcutende Stucke vertreten ist. Eine Madonna,
^kche niit derjenigen des Ereglinger Marienaltars
^t Berwandles hat, darf wohl dem gleichen Meister,
^dlsen Verhältnis zu Tilman Riemenschneider noch
^iiiier nicht in wünschenswerter Klarheit festgestellt ist,
^geschriebxn werden, ebenso wie ein kleines Relieffrag-
"'^nt, dw Geburt Christi darstellend, das neben ihr
der Hauptwand dem Eingang gegenüber angebracht
und eine sitzende Madonna mit dem Kind ohne
^viiialung in dem die Werke der Kleinkunst ent-
^ciltenden Schrauke. Dem Tilman Riemenschneider
'^tbst gehören augenscheinlich die aus der Pfarrkirche
Kitzingen stanimenden fast lebensgroßen Statuen von
^vi Bischöfen und der hl. Elisabeth an, wie ein Ber-
^kich ii,st den beglaubigten Jugendarbeiten des Mei-
liers i„ Würzburg lehrt. Der gleichen Werkstatt ent-
"kniint wohl auch eine Reiterstatuette des hl. Georg
Nus Lindenholz; leider hat sich bei keiner dieser unter-
ll'nnkischxa Schnitzwerke die Bemalung erhalten, und
eine Gruppe von zwci klagenden Frauen, ein
-ieisterstüst nordfränkischer Kunst, ist durch moderne
^Nialung in ihrer Wirkung geschädigt.
Weniger reich als die Würzburger ist die Nürn-
/rger Gruppe der fränkischcn Schulen vertreten. Frei-
Ph bcsitzt die Sammlung sieben Reliess von der
.nsenkranztasel des Germanischen Muscums, dem be-
^"hniteu Hauptwcrke des Veit Stoß, dieselben gehören
^vch ihrx„i Umfange nach mehr der Kleinkunst an.
^ si einen bcrcits von italienischen Einflüssen stärker
'vrührten Nürnbcrger Künstlcr möchten wir die Thon-
^ntue einer sitzenden Madonna zurllckführen, die nebcn
/'ni St. Georg des Riemenschneider aufgestellt ist. Dem
^Ngeren Labenwolf schließlich ist die Statuctte eines
^belsackpfeifers auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit dem
'vriihmten Nürnberger Gänsemännchen zugeschrieben.
^'vglicherweise diente auch sie als Modell für einen
^wnzeguß.
Reicher noch ist die Zahl schwäbischer Bild-
^vrke in unserer Sammlung. Außer dem bereits
nben erwähnten großen Altar ist hier zunächst die
-Radonnenstatue des Meisters Schramm aus Ravens-
als oberschwäbisches Werk zu nennen. Diesem
^Auiidlich nicht beglaubiglcn Meister, der nur durch
^ jetzt verlorene Jnschrist unserer aus der Samm-
^""g Hirscher stammeuden Maria (als inatsr inissri-
^räiaa mit Schutzflehenden dargestellt) bekannt ist, hat
^ Bildhauer Entres aus stilistischen Gründen zwei
Navensburg stammende Gruppen, die Mesie des
Gregor und das Martyrium der hl. Katharina
^gkschrieben, die aus der bekannten Sammlung dieses
^inchener Künstlers 1882 ebenfalls sür das Berliner
^^useiim erworben sind. Ohne die Berechtigung dieser
^^ufc, dix tzer schwäbischen Kunstgcschichte in dem
Meister Schramm einen tüchtigen, von Schongauer be-
einflußten Vertreter zuführt, an dieser Stelle weiter
zu erörtern, können wir versichern, daß namentlich dic
in ihrer alten Bemalung vortrefflich erhaltenen Grup-
pen in jedem Fall eine wertvolle Bereicherung der
Sammlung bilden.
Der Ulmer Schule — der Überlieferung nach
der Werkstatt des jüngeren Syrlin — entstammt eine
bemalte Statuette des hl. Jacobus major von auf-
fallender Formenreinheit.
Drei besonders wertvolle Neuerwerbungen weisen
nns auf die Augsburger Bildnerschule: eine
kolossale, aus einem mächtigen Lindenstamm geschnitzte
Marie als inatsr iniserieoräias aus dem Kloster
Kaisersheim bei Augsburg, die kunstgeschichtlich von
Bedeutuug wäre, weun die Überlieferung als ge-
sichert gelten dürfte, nach der Gregor Erhart, der
sich in Augsburg in den Jahren 1498—1527 urkund-
lich uachweisen läßt, sie 1502 geschnitzt, und der ältere
Holbein die Bemalung besorgt habe, die technisch
durch den nachweislich nur bei sorgfältigeren Arbeiten
angewandten Leinwandunterzug interessirt. Das zweite
neuerworbene Augsburger Kuustwerk ist eine Anbetung
der heil. drei Kvnige, aus Lindenholz in Hochrelief ge-
schnitzt; es zeigt große Verwaudtschaft mit einer Gruppe
von Werken, die Bvde (Gesch. d. deut. Plastik, S. 186)
mit Recht eincm Augsburger Meister um 1520 zu-
geschrieben hat. Für den Namen dieses Künstlers hnt
sich jedoch bisher kein Anhalt finden lassen. Glück-
licher ist die jüngste Forschung bei einem Augsburgcr
Monogrammisten gewesen, von dem die Berliner
Sammlung das größte, wenn auch nicht bezeichncte,
Wcrk besitzt. Bode hat es ini letztcn Heft des Jahr-
buchs der preußischen Kunstsammlungen publizirt und
seine unverkennbare Beziehung zu dem auch als Me-
dailleur bekannten Meister 8. O. nachgewiesen, den
man nach einer nur bis zum Ansang unseres Jahr-
hunderts zurückreichenden Überlieferung Hans Dvllinger
zu nennen pflegte, während die Untersnchung Bode's
es sehr wahrscbeinlich macht, daß wir hinter dem
Monogramm den in Augsburg 1514—1537 nach-
weisbaren Bildhauer Hans Daucher zu suchen haben.
Der für das Berliner Museum erworbene, früher in
seinen einzelnen Stücken getrennte Passionsaltar in
Kelheimer Stein ist den bekannten und mit Mono-
gramm versehenen Arbeiten dieses Meisters so nahe
verwandt, daß Bvde's Beweisführung und Nameu-
gebung schwerlich begründeten Widerspruch erfahrcn
dürfte.
Mit dem Vater dieses Künstlers, der übrigens
bei dem obengenannten Erhart seine Lehrzeit durch-
machte, bringt Bode eine Anzahl Büsten im Zu-
sammenhnng, welche Christi Borfahren, Propheten und