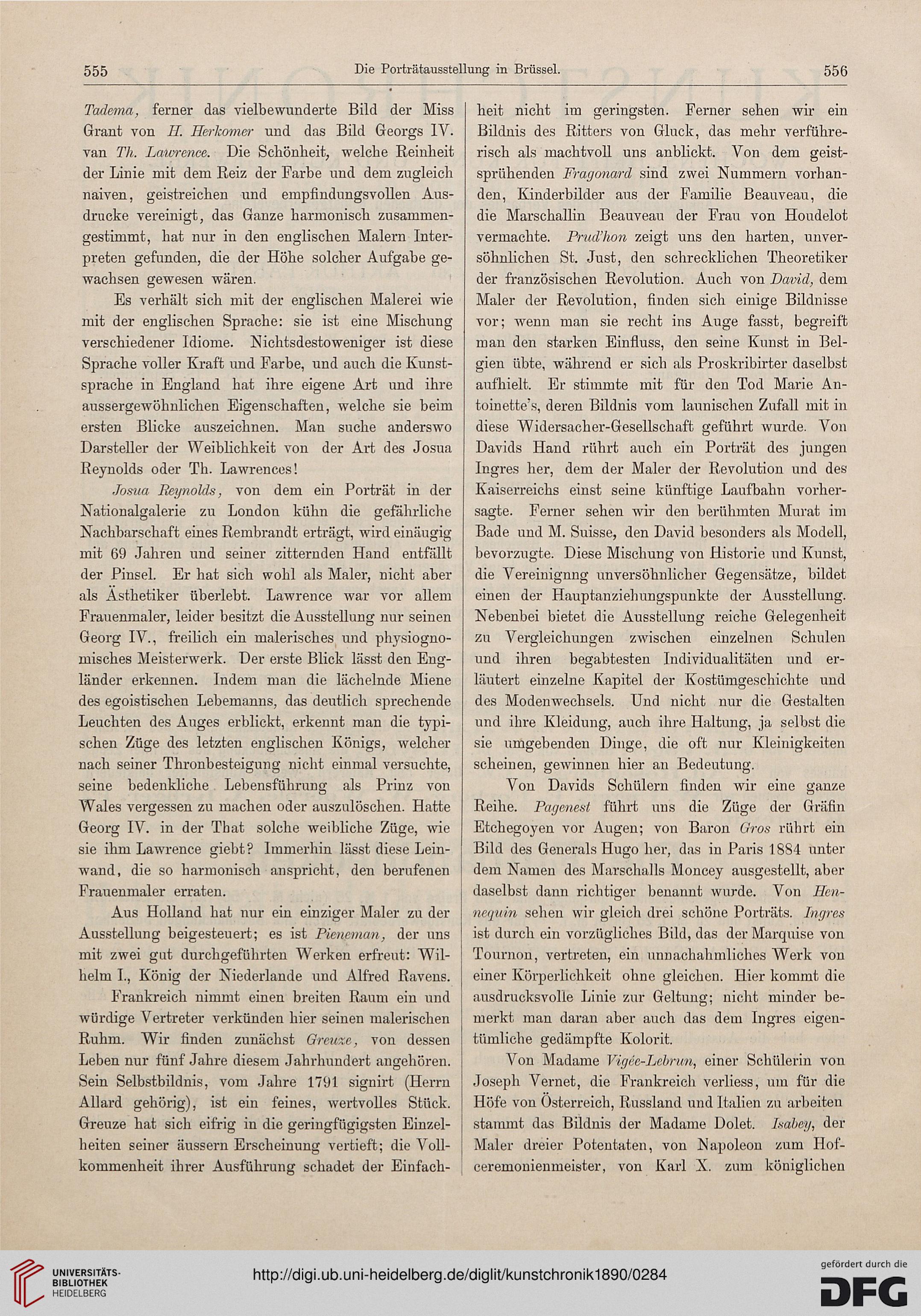555
Die Porträtausstellung in Brüssel.
556
Tadema, ferner das vielbewunderte Bild der Miss
Grant von IL Herkomer und das Bild Georgs IV.
van Th. Lawrence. Die Schönheit, welche Reinheit
der Linie mit dem Reiz der Farbe und dem zugleich
naiven, geistreichen und empfindungsvollen Aus-
drucke vereinigt, das Ganze harmonisch zusammen-
gestimmt, hat nur in den englischen Malern Inter-
preten gefunden, die der Höhe solcher Aufgabe ge-
wachsen gewesen wären.
Es verhält sich mit der englischen Malerei wie
mit der englischen Sprache: sie ist eine Mischung
verschiedener Idiome. Nichtsdestoweniger ist diese
Sprache voller Kraft und Farbe, und auch die Kunst-
sprache in England hat ihre eigene Art und ihre
aussergewöhnlichen Eigenschaften, welche sie beim
ersten Blicke auszeichnen. Man suche anderswo
Darsteller der Weiblichkeit von der Art des Josua
Reynolds oder Th. Lawrences!
Josua Reynolds, von dem ein Porträt in der
Nationalgalerie zu London kühn die gefährliche
Nachbarschaft eines Rembrandt erträgt, wird einäugig
mit 69 Jahren und seiner zitternden Hand entfällt
der Pinsel. Er hat sich wohl als Maler, nicht aber
als Ästhetiker überlebt. Lawrence war vor allem
Frauenmaler, leider besitzt die Ausstellung nur seinen
Georg IV., freilich ein malerisches und physiogno-
misches Meisterwerk. Der erste Blick lässt den Eng-
länder erkennen. Indem man die lächelnde Miene
des egoistischen Lebemanns, das deutlich sprechende
Leuchten des Auges erblickt, erkennt man die typi-
schen Züge des letzten englischen Königs, welcher
nach seiner Thronbesteigung nicht einmal versuchte,
seine bedenkliche Lebensführung als Prinz von
Wales vergessen zu machen oder auszulöschen. Hatte
Georg IV. in der That solche weibliche Züge, wie
sie ihm Lawrence giebt? Immerhin lässt diese Lein-
wand, die so harmonisch anspricht, den berufenen
Frauenmaler erraten.
Aus Holland hat nur ein einziger Maler zu der
Ausstellung beigesteuert; es ist Pieneman, der uns
mit zwei gut durchgeführten Werken erfreut: Wil-
helm I., König der Niederlande und Alfred Ravens.
Frankreich nimmt einen breiten Raum ein und
würdige Vertreter verkünden hier seinen malerischen
Ruhm. Wir finden zunächst Greuze, von dessen
Leben nur fünf Jahre diesem Jahrhundert angehören.
Sein Selbstbildnis, vom Jahre 1791 signirt (Herrn
Allard gehörig), ist ein feines, wertvolles Stück.
Greuze hat sich eifrig in die geringfügigsten Einzel-
heiten seiner äussern Erscheinung vertieft; die Voll-
kommenheit ihrer Ausführung schadet der Einfach-
heit nicht im geringsten. Ferner sehen wir ein
Bildnis des Ritters von Gluck, das mehr verführe-
risch als machtvoll uns anblickt. Von dem geist-
sprühenden Fragonard sind zwei Nummern vorhan-
den, Kinderbilder aus der Familie Beauveau, die
die Marschallin Beauveau der Frau von Houdelot
vermachte. Prud'hon zeigt uns den harten, unver-
söhnlichen St. Just, den schrecklichen Theoretiker
der französischen Revolution. Auch von David, dem
Maler der Revolution, finden sich einige Bildnisse
vor; wenn man sie recht ins Auge fasst, begreift
man den starken Einfluss, den seine Kunst in Bel-
gien übte, während er sich als Proskribirter daselbst
aufhielt. Er stimmte mit für den Tod Marie An-
toinette's, deren Bildnis vom launischen Zufall mit in
diese Widersacher-Gesellschaft geführt wurde. Von
Davids Hand rührt auch ein Porträt des jungen
Ingres her, dem der Maler der Revolution und des
Kaiserreichs einst seine künftige Laufbahn vorher-
sagte. Ferner sehen wir den berühmten Murat im
Bade und M. Suisse, den David besonders als Modell,
bevorzugte. Diese Mischung von Historie und Kunst,
die Vereinigung unversöhnlicher Gegensätze, bildet
einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung.
Nebenbei bietet die Ausstellung reiche Gelegenheit
zu Vergleichungen zwischen einzelnen Schulen
und ihren begabtesten Individualitäten und er-
läutert einzelne Kapitel der Kostümgeschichte und
des Modenwechsels. Und nicht nur die Gestalten
und ihre Kleidung, auch ihre Haltung, ja selbst die
sie umgebenden Dinge, die oft nur Kleinigkeiten
scheinen, gewinnen hier an Bedeutung.
Von Davids Schülern finden wir eine ganze
Reihe. Pagenest führt uns die Züge der Gräfin
Etchegoyen vor Augen; von Baron Gros rührt ein
Bild des Generals Hugo her, das in Paris 18S4 unter
dem Namen des Marschalls Moncey ausgestellt, aber
daselbst dann richtiger benannt wurde. Von Uen-
nequin sehen wir gleich drei schöne Porträts. Ingres
ist durch ein vorzügliches Bild, das der Marquise von
Tournon, vertreten, ein unnachahmliches Werk von
einer Körperlichkeit ohne gleichen. Hier kommt die
ausdrucksvolle Linie zur Geltung; nicht minder be-
merkt man daran aber auch das dem Ingres eigen-
tümliche gedämpfte Kolorit.
Von Madame Vigee-Lebrun, einer Schülerin von
Joseph Vernet, die Frankreich verliess, um für die
Höfe von Osterreich, Russland und Italien zu arbeiten
stammt das Bildnis der Madame Dolet. Isabey, der
Maler dreier Potentaten, von Napoleon zum Hof-
ceremonienmeister, von Karl X. zum königlichen
Die Porträtausstellung in Brüssel.
556
Tadema, ferner das vielbewunderte Bild der Miss
Grant von IL Herkomer und das Bild Georgs IV.
van Th. Lawrence. Die Schönheit, welche Reinheit
der Linie mit dem Reiz der Farbe und dem zugleich
naiven, geistreichen und empfindungsvollen Aus-
drucke vereinigt, das Ganze harmonisch zusammen-
gestimmt, hat nur in den englischen Malern Inter-
preten gefunden, die der Höhe solcher Aufgabe ge-
wachsen gewesen wären.
Es verhält sich mit der englischen Malerei wie
mit der englischen Sprache: sie ist eine Mischung
verschiedener Idiome. Nichtsdestoweniger ist diese
Sprache voller Kraft und Farbe, und auch die Kunst-
sprache in England hat ihre eigene Art und ihre
aussergewöhnlichen Eigenschaften, welche sie beim
ersten Blicke auszeichnen. Man suche anderswo
Darsteller der Weiblichkeit von der Art des Josua
Reynolds oder Th. Lawrences!
Josua Reynolds, von dem ein Porträt in der
Nationalgalerie zu London kühn die gefährliche
Nachbarschaft eines Rembrandt erträgt, wird einäugig
mit 69 Jahren und seiner zitternden Hand entfällt
der Pinsel. Er hat sich wohl als Maler, nicht aber
als Ästhetiker überlebt. Lawrence war vor allem
Frauenmaler, leider besitzt die Ausstellung nur seinen
Georg IV., freilich ein malerisches und physiogno-
misches Meisterwerk. Der erste Blick lässt den Eng-
länder erkennen. Indem man die lächelnde Miene
des egoistischen Lebemanns, das deutlich sprechende
Leuchten des Auges erblickt, erkennt man die typi-
schen Züge des letzten englischen Königs, welcher
nach seiner Thronbesteigung nicht einmal versuchte,
seine bedenkliche Lebensführung als Prinz von
Wales vergessen zu machen oder auszulöschen. Hatte
Georg IV. in der That solche weibliche Züge, wie
sie ihm Lawrence giebt? Immerhin lässt diese Lein-
wand, die so harmonisch anspricht, den berufenen
Frauenmaler erraten.
Aus Holland hat nur ein einziger Maler zu der
Ausstellung beigesteuert; es ist Pieneman, der uns
mit zwei gut durchgeführten Werken erfreut: Wil-
helm I., König der Niederlande und Alfred Ravens.
Frankreich nimmt einen breiten Raum ein und
würdige Vertreter verkünden hier seinen malerischen
Ruhm. Wir finden zunächst Greuze, von dessen
Leben nur fünf Jahre diesem Jahrhundert angehören.
Sein Selbstbildnis, vom Jahre 1791 signirt (Herrn
Allard gehörig), ist ein feines, wertvolles Stück.
Greuze hat sich eifrig in die geringfügigsten Einzel-
heiten seiner äussern Erscheinung vertieft; die Voll-
kommenheit ihrer Ausführung schadet der Einfach-
heit nicht im geringsten. Ferner sehen wir ein
Bildnis des Ritters von Gluck, das mehr verführe-
risch als machtvoll uns anblickt. Von dem geist-
sprühenden Fragonard sind zwei Nummern vorhan-
den, Kinderbilder aus der Familie Beauveau, die
die Marschallin Beauveau der Frau von Houdelot
vermachte. Prud'hon zeigt uns den harten, unver-
söhnlichen St. Just, den schrecklichen Theoretiker
der französischen Revolution. Auch von David, dem
Maler der Revolution, finden sich einige Bildnisse
vor; wenn man sie recht ins Auge fasst, begreift
man den starken Einfluss, den seine Kunst in Bel-
gien übte, während er sich als Proskribirter daselbst
aufhielt. Er stimmte mit für den Tod Marie An-
toinette's, deren Bildnis vom launischen Zufall mit in
diese Widersacher-Gesellschaft geführt wurde. Von
Davids Hand rührt auch ein Porträt des jungen
Ingres her, dem der Maler der Revolution und des
Kaiserreichs einst seine künftige Laufbahn vorher-
sagte. Ferner sehen wir den berühmten Murat im
Bade und M. Suisse, den David besonders als Modell,
bevorzugte. Diese Mischung von Historie und Kunst,
die Vereinigung unversöhnlicher Gegensätze, bildet
einen der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung.
Nebenbei bietet die Ausstellung reiche Gelegenheit
zu Vergleichungen zwischen einzelnen Schulen
und ihren begabtesten Individualitäten und er-
läutert einzelne Kapitel der Kostümgeschichte und
des Modenwechsels. Und nicht nur die Gestalten
und ihre Kleidung, auch ihre Haltung, ja selbst die
sie umgebenden Dinge, die oft nur Kleinigkeiten
scheinen, gewinnen hier an Bedeutung.
Von Davids Schülern finden wir eine ganze
Reihe. Pagenest führt uns die Züge der Gräfin
Etchegoyen vor Augen; von Baron Gros rührt ein
Bild des Generals Hugo her, das in Paris 18S4 unter
dem Namen des Marschalls Moncey ausgestellt, aber
daselbst dann richtiger benannt wurde. Von Uen-
nequin sehen wir gleich drei schöne Porträts. Ingres
ist durch ein vorzügliches Bild, das der Marquise von
Tournon, vertreten, ein unnachahmliches Werk von
einer Körperlichkeit ohne gleichen. Hier kommt die
ausdrucksvolle Linie zur Geltung; nicht minder be-
merkt man daran aber auch das dem Ingres eigen-
tümliche gedämpfte Kolorit.
Von Madame Vigee-Lebrun, einer Schülerin von
Joseph Vernet, die Frankreich verliess, um für die
Höfe von Osterreich, Russland und Italien zu arbeiten
stammt das Bildnis der Madame Dolet. Isabey, der
Maler dreier Potentaten, von Napoleon zum Hof-
ceremonienmeister, von Karl X. zum königlichen