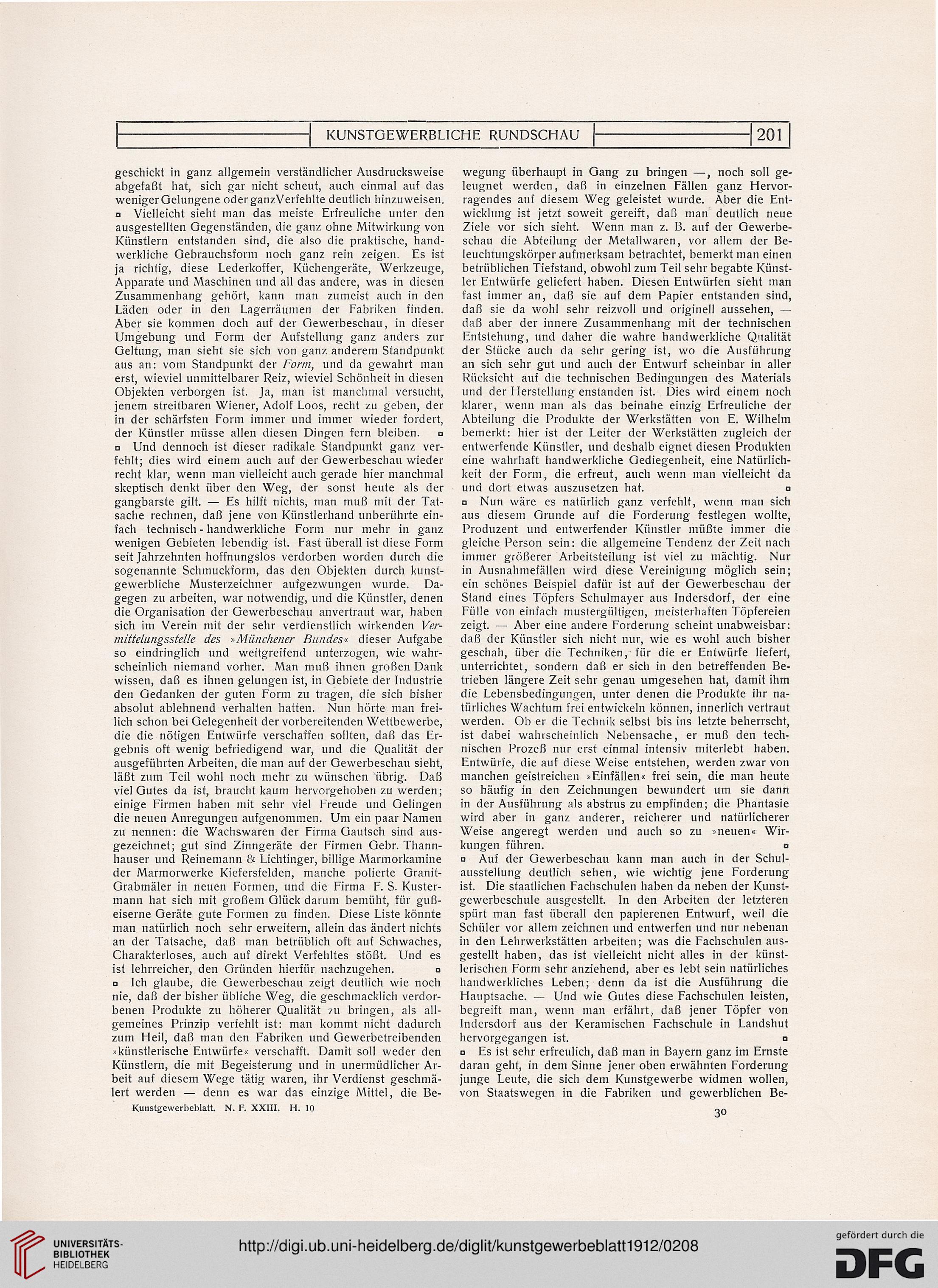KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
201
geschickt in ganz allgemein verständlicher Ausdrucksweise
abgefaßt hat, sich gar nicht scheut, auch einmal auf das
weniger Gelungene oder ganzVerfehlte deutlich hinzu weisen.
□ Vielleicht sieht man das meiste Erfreuliche unter den
ausgestellten Gegenständen, die ganz ohne Mitwirkung von
Künstlern entstanden sind, die also die praktische, hand-
werkliche Gebrauchsform noch ganz rein zeigen. Es ist
ja richtig, diese Lederkoffer, Küchengeräte, Werkzeuge,
Apparate und Maschinen und all das andere, was in diesen
Zusammenhang gehört, kann man zumeist auch in den
Läden oder in den Lagerräumen der Fabriken finden.
Aber sie kommen doch auf der Gewerbeschau, in dieser
Umgebung und Form der Aufstellung ganz anders zur
Geltung, man sieht sie sich von ganz anderem Standpunkt
aus an: vom Standpunkt der Form, und da gewahrt man
erst, wieviel unmittelbarer Reiz, wieviel Schönheit in diesen
Objekten verborgen ist. Ja, man ist manchmal versucht,
jenem streitbaren Wiener, Adolf Loos, recht zu geben, der
in der schärfsten Form immer und immer wieder fordert,
der Künstler müsse allen diesen Dingen fern bleiben. □
□ Und dennoch ist dieser radikale Standpunkt ganz ver-
fehlt; dies wird einem auch auf der Gewerbeschau wieder
recht klar, wenn man vielleicht auch gerade hier manchmal
skeptisch denkt über den Weg, der sonst heute als der
gangbarste gilt. — Es hilft nichts, man muß mit der Tat-
sache rechnen, daß jene von Künstlerhand unberührte ein-
fach technisch - handwerkliche Form nur mehr in ganz
wenigen Gebieten lebendig ist. Fast überall ist diese Form
seit Jahrzehnten hoffnungslos verdorben worden durch die
sogenannte Schmuckform, das den Objekten durch kunst-
gewerbliche Musterzeichner aufgezwungen wurde. Da-
gegen zu arbeiten, war notwendig, und die Künstler, denen
die Organisation der Gewerbeschau anvertraut war, haben
sich im Verein mit der sehr verdienstlich wirkenden Ver-
mittelungsstelle des »Münchener Bandes« dieser Aufgabe
so eindringlich und weitgreifend unterzogen, wie wahr-
scheinlich niemand vorher. Man muß ihnen großen Dank
wissen, daß es ihnen gelungen ist, in Gebiete der Industrie
den Gedanken der guten Form zu tragen, die sich bisher
absolut ablehnend verhalten hatten. Nun hörte man frei-
lich schon bei Gelegenheit der vorbereitenden Wettbewerbe,
die die nötigen Entwürfe verschaffen sollten, daß das Er-
gebnis oft wenig befriedigend war, und die Qualität der
ausgeführten Arbeiten, die man auf der Gewerbeschau sieht,
läßt zum Teil wohl noch mehr zu wünschen übrig. Daß
viel Gutes da ist, braucht kaum hervorgehobenzu werden;
einige Firmen haben mit sehr viel Freude und Gelingen
die neuen Anregungen aufgenommen. Um ein paar Namen
zu nennen: die Wachswaren der Firma Gautsch sind aus-
gezeichnet; gut sind Zinngeräte der Firmen Gebr. Thann-
hauser und Reinemann & Lichtinger, billige Marmorkamine
der Marmorwerke Kiefersfelden, manche polierte Granit-
Grabmäler in neuen Formen, und die Firma F. S. Kuster-
mann hat sich mit großem Glück darum bemüht, für guß-
eiserne Geräte gute Formen zu finden. Diese Liste könnte
man natürlich noch sehr erweitern, allein das ändert nichts
an der Tatsache, daß man betrüblich oft auf Schwaches,
Charakterloses, auch auf direkt Verfehltes stößt. Und es
ist lehrreicher, den Gründen hierfür nachzugehen. n
n Ich glaube, die Gewerbeschau zeigt deutlich wie noch
nie, daß der bisher übliche Weg, die geschmacklich verdor-
benen Produkte zu höherer Qualität zu bringen, als all-
gemeines Prinzip verfehlt ist: man kommt nicht dadurch
zum Heil, daß man den Fabriken und Gewerbetreibenden
»künstlerische Entwürfe« verschafft. Damit soll weder den
Künstlern, die mit Begeisterung und in unermüdlicher Ar-
beit auf diesem Wege tätig waren, ihr Verdienst geschmä-
lert werden — denn es war das einzige Mittel, die Be-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 10
wegung überhaupt in Gang zu bringen —, noch soll ge-
leugnet werden, daß in einzelnen Fällen ganz Hervor-
ragendes auf diesem Weg geleistet wurde. Aber die Ent-
wicklung ist jetzt soweit gereift, daß man deutlich neue
Ziele vor sich sieht. Wenn man z. B. auf der Gewerbe-
schau die Abteilung der Metallwaren, vor allem der Be-
leuchtungskörper aufmerksam betrachtet, bemerkt man einen
betrüblichen Tiefstand, obwohl zum Teil sehr begabte Künst-
ler Entwürfe geliefert haben. Diesen Entwürfen sieht man
fast immer an, daß sie auf dem Papier entstanden sind,
daß sie da wohl sehr reizvoll und originell aussehen, —
daß aber der innere Zusammenhang mit der technischen
Entstehung, und daher die wahre handwerkliche Qualität
der Stücke auch da sehr gering ist, wo die Ausführung
an sich sehr gut und auch der Entwurf scheinbar in aller
Rücksicht auf die technischen Bedingungen des Materials
und der Herstellung enstanden ist. Dies wird einem noch
klarer, wenn man als das beinahe einzig Erfreuliche der
Abteilung die Produkte der Werkstätten von E. Wilhelm
bemerkt: hier ist der Leiter der Werkstätten zugleich der
entwerfende Künstler, und deshalb eignet diesen Produkten
eine wahrhaft handwerkliche Gediegenheit, eine Natürlich-
keit der Form, die erfreut, auch wenn man vielleicht da
und dort etwas auszusetzen hat. □
□ Nun wäre es natürlich ganz verfehlt, wenn man sich
aus diesem Grunde auf die Forderung festlegen wollte,
Produzent und entwerfender Künstler müßte immer die
gleiche Person sein: die allgemeine Tendenz der Zeit nach
immer größerer Arbeitsteilung ist viel zu mächtig. Nur
in Ausnahmefällen wird diese Vereinigung möglich sein;
ein schönes Beispiel dafür ist auf der Gewerbeschau der
Stand eines Töpfers Schulmayer aus Indersdorf, der eine
Fülle von einfach mustergültigen, meisterhaften Töpfereien
zeigt. — Aber eine andere Forderung scheint unabweisbar:
daß der Künstler sich nicht nur, wie es wohl auch bisher
geschah, über die Techniken, für die er Entwürfe liefert,
unterrichtet, sondern daß er sich in den betreffenden Be-
trieben längere Zeit sehr genau umgesehen hat, damit ihm
die Lebensbedingungen, unter denen die Produkte ihr na-
türliches Wachtum frei entwickeln können, innerlich vertraut
werden. Ob er die Technik selbst bis ins letzte beherrscht,
ist dabei wahrscheinlich Nebensache, er muß den tech-
nischen Prozeß nur erst einmal intensiv miterlebt haben.
Entwürfe, die auf diese Weise entstehen, werden zwar von
manchen geistreichen »Einfällen« frei sein, die man heute
so häufig in den Zeichnungen bewundert um sie dann
in der Ausführung als abstrus zu empfinden; die Phantasie
wird aber in ganz anderer, reicherer und natürlicherer
Weise angeregt werden und auch so zu »neuen« Wir-
kungen führen. □
□ Auf der Gewerbeschau kann man auch in der Schul-
ausstellung deutlich sehen, wie wichtig jene Forderung
ist. Die staatlichen Fachschulen haben da neben der Kunst-
gewerbeschule ausgestellt. In den Arbeiten der letzteren
spürt man fast überall den papierenen Entwurf, weil die
Schüler vor allem zeichnen und entwerfen und nur nebenan
in den Lehrwerkstätten arbeiten; was die Fachschulen aus-
gestellt haben, das ist vielleicht nicht alles in der künst-
lerischen Form sehr anziehend, aber es lebt sein natürliches
handwerkliches Leben; denn da ist die Ausführung die
Hauptsache. — Und wie Gutes diese Fachschulen leisten,
begreift man, wenn man erfährt, daß jener Töpfer von
Indersdorf aus der Keramischen Fachschule in Landshut
hervorgegangen ist. □
□ Es ist sehr erfreulich, daß man in Bayern ganz im Ernste
daran geht, in dem Sinne jener oben erwähnten Forderung
junge Leute, die sich dem Kunstgewerbe widmen wollen,
von Staatswegen in die Fabriken und gewerblichen Be-
30
201
geschickt in ganz allgemein verständlicher Ausdrucksweise
abgefaßt hat, sich gar nicht scheut, auch einmal auf das
weniger Gelungene oder ganzVerfehlte deutlich hinzu weisen.
□ Vielleicht sieht man das meiste Erfreuliche unter den
ausgestellten Gegenständen, die ganz ohne Mitwirkung von
Künstlern entstanden sind, die also die praktische, hand-
werkliche Gebrauchsform noch ganz rein zeigen. Es ist
ja richtig, diese Lederkoffer, Küchengeräte, Werkzeuge,
Apparate und Maschinen und all das andere, was in diesen
Zusammenhang gehört, kann man zumeist auch in den
Läden oder in den Lagerräumen der Fabriken finden.
Aber sie kommen doch auf der Gewerbeschau, in dieser
Umgebung und Form der Aufstellung ganz anders zur
Geltung, man sieht sie sich von ganz anderem Standpunkt
aus an: vom Standpunkt der Form, und da gewahrt man
erst, wieviel unmittelbarer Reiz, wieviel Schönheit in diesen
Objekten verborgen ist. Ja, man ist manchmal versucht,
jenem streitbaren Wiener, Adolf Loos, recht zu geben, der
in der schärfsten Form immer und immer wieder fordert,
der Künstler müsse allen diesen Dingen fern bleiben. □
□ Und dennoch ist dieser radikale Standpunkt ganz ver-
fehlt; dies wird einem auch auf der Gewerbeschau wieder
recht klar, wenn man vielleicht auch gerade hier manchmal
skeptisch denkt über den Weg, der sonst heute als der
gangbarste gilt. — Es hilft nichts, man muß mit der Tat-
sache rechnen, daß jene von Künstlerhand unberührte ein-
fach technisch - handwerkliche Form nur mehr in ganz
wenigen Gebieten lebendig ist. Fast überall ist diese Form
seit Jahrzehnten hoffnungslos verdorben worden durch die
sogenannte Schmuckform, das den Objekten durch kunst-
gewerbliche Musterzeichner aufgezwungen wurde. Da-
gegen zu arbeiten, war notwendig, und die Künstler, denen
die Organisation der Gewerbeschau anvertraut war, haben
sich im Verein mit der sehr verdienstlich wirkenden Ver-
mittelungsstelle des »Münchener Bandes« dieser Aufgabe
so eindringlich und weitgreifend unterzogen, wie wahr-
scheinlich niemand vorher. Man muß ihnen großen Dank
wissen, daß es ihnen gelungen ist, in Gebiete der Industrie
den Gedanken der guten Form zu tragen, die sich bisher
absolut ablehnend verhalten hatten. Nun hörte man frei-
lich schon bei Gelegenheit der vorbereitenden Wettbewerbe,
die die nötigen Entwürfe verschaffen sollten, daß das Er-
gebnis oft wenig befriedigend war, und die Qualität der
ausgeführten Arbeiten, die man auf der Gewerbeschau sieht,
läßt zum Teil wohl noch mehr zu wünschen übrig. Daß
viel Gutes da ist, braucht kaum hervorgehobenzu werden;
einige Firmen haben mit sehr viel Freude und Gelingen
die neuen Anregungen aufgenommen. Um ein paar Namen
zu nennen: die Wachswaren der Firma Gautsch sind aus-
gezeichnet; gut sind Zinngeräte der Firmen Gebr. Thann-
hauser und Reinemann & Lichtinger, billige Marmorkamine
der Marmorwerke Kiefersfelden, manche polierte Granit-
Grabmäler in neuen Formen, und die Firma F. S. Kuster-
mann hat sich mit großem Glück darum bemüht, für guß-
eiserne Geräte gute Formen zu finden. Diese Liste könnte
man natürlich noch sehr erweitern, allein das ändert nichts
an der Tatsache, daß man betrüblich oft auf Schwaches,
Charakterloses, auch auf direkt Verfehltes stößt. Und es
ist lehrreicher, den Gründen hierfür nachzugehen. n
n Ich glaube, die Gewerbeschau zeigt deutlich wie noch
nie, daß der bisher übliche Weg, die geschmacklich verdor-
benen Produkte zu höherer Qualität zu bringen, als all-
gemeines Prinzip verfehlt ist: man kommt nicht dadurch
zum Heil, daß man den Fabriken und Gewerbetreibenden
»künstlerische Entwürfe« verschafft. Damit soll weder den
Künstlern, die mit Begeisterung und in unermüdlicher Ar-
beit auf diesem Wege tätig waren, ihr Verdienst geschmä-
lert werden — denn es war das einzige Mittel, die Be-
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXIII. H. 10
wegung überhaupt in Gang zu bringen —, noch soll ge-
leugnet werden, daß in einzelnen Fällen ganz Hervor-
ragendes auf diesem Weg geleistet wurde. Aber die Ent-
wicklung ist jetzt soweit gereift, daß man deutlich neue
Ziele vor sich sieht. Wenn man z. B. auf der Gewerbe-
schau die Abteilung der Metallwaren, vor allem der Be-
leuchtungskörper aufmerksam betrachtet, bemerkt man einen
betrüblichen Tiefstand, obwohl zum Teil sehr begabte Künst-
ler Entwürfe geliefert haben. Diesen Entwürfen sieht man
fast immer an, daß sie auf dem Papier entstanden sind,
daß sie da wohl sehr reizvoll und originell aussehen, —
daß aber der innere Zusammenhang mit der technischen
Entstehung, und daher die wahre handwerkliche Qualität
der Stücke auch da sehr gering ist, wo die Ausführung
an sich sehr gut und auch der Entwurf scheinbar in aller
Rücksicht auf die technischen Bedingungen des Materials
und der Herstellung enstanden ist. Dies wird einem noch
klarer, wenn man als das beinahe einzig Erfreuliche der
Abteilung die Produkte der Werkstätten von E. Wilhelm
bemerkt: hier ist der Leiter der Werkstätten zugleich der
entwerfende Künstler, und deshalb eignet diesen Produkten
eine wahrhaft handwerkliche Gediegenheit, eine Natürlich-
keit der Form, die erfreut, auch wenn man vielleicht da
und dort etwas auszusetzen hat. □
□ Nun wäre es natürlich ganz verfehlt, wenn man sich
aus diesem Grunde auf die Forderung festlegen wollte,
Produzent und entwerfender Künstler müßte immer die
gleiche Person sein: die allgemeine Tendenz der Zeit nach
immer größerer Arbeitsteilung ist viel zu mächtig. Nur
in Ausnahmefällen wird diese Vereinigung möglich sein;
ein schönes Beispiel dafür ist auf der Gewerbeschau der
Stand eines Töpfers Schulmayer aus Indersdorf, der eine
Fülle von einfach mustergültigen, meisterhaften Töpfereien
zeigt. — Aber eine andere Forderung scheint unabweisbar:
daß der Künstler sich nicht nur, wie es wohl auch bisher
geschah, über die Techniken, für die er Entwürfe liefert,
unterrichtet, sondern daß er sich in den betreffenden Be-
trieben längere Zeit sehr genau umgesehen hat, damit ihm
die Lebensbedingungen, unter denen die Produkte ihr na-
türliches Wachtum frei entwickeln können, innerlich vertraut
werden. Ob er die Technik selbst bis ins letzte beherrscht,
ist dabei wahrscheinlich Nebensache, er muß den tech-
nischen Prozeß nur erst einmal intensiv miterlebt haben.
Entwürfe, die auf diese Weise entstehen, werden zwar von
manchen geistreichen »Einfällen« frei sein, die man heute
so häufig in den Zeichnungen bewundert um sie dann
in der Ausführung als abstrus zu empfinden; die Phantasie
wird aber in ganz anderer, reicherer und natürlicherer
Weise angeregt werden und auch so zu »neuen« Wir-
kungen führen. □
□ Auf der Gewerbeschau kann man auch in der Schul-
ausstellung deutlich sehen, wie wichtig jene Forderung
ist. Die staatlichen Fachschulen haben da neben der Kunst-
gewerbeschule ausgestellt. In den Arbeiten der letzteren
spürt man fast überall den papierenen Entwurf, weil die
Schüler vor allem zeichnen und entwerfen und nur nebenan
in den Lehrwerkstätten arbeiten; was die Fachschulen aus-
gestellt haben, das ist vielleicht nicht alles in der künst-
lerischen Form sehr anziehend, aber es lebt sein natürliches
handwerkliches Leben; denn da ist die Ausführung die
Hauptsache. — Und wie Gutes diese Fachschulen leisten,
begreift man, wenn man erfährt, daß jener Töpfer von
Indersdorf aus der Keramischen Fachschule in Landshut
hervorgegangen ist. □
□ Es ist sehr erfreulich, daß man in Bayern ganz im Ernste
daran geht, in dem Sinne jener oben erwähnten Forderung
junge Leute, die sich dem Kunstgewerbe widmen wollen,
von Staatswegen in die Fabriken und gewerblichen Be-
30