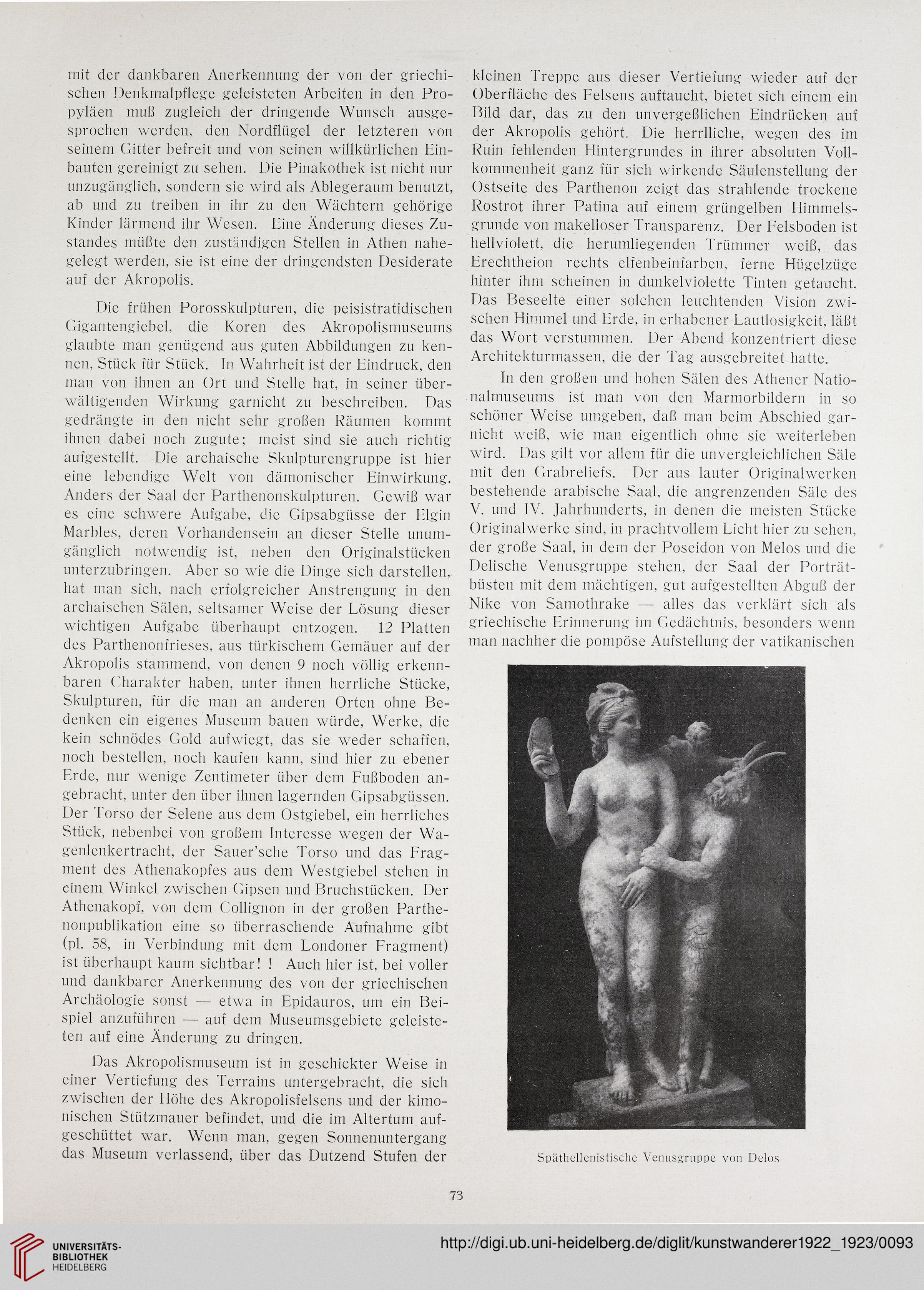mit der dankbaren Anerkennung der von der griechi-
schen Denkmalpflege geleisteten Arbeiten in den Pro-
pyläen muß zugleich der dringende Wunsch ausge-
sprochen werden, den Nordflügel der letzteren von
seinem Gitter befreit und von seinen willkürlichen Ein-
bauten gereinigt zu sehen. Die Pinakothek ist nicht nur
unzugänglich, sondern sie wird als Ablegeraum benutzt,
ab und zu treiben in ihr zu den Wächtern gehörige
Kinder lärmend ihr Wesen. Eine Änderung dieses Zu-
standes müßte den zuständigen Stellen in Athen nahe-
gelegt werden, sie ist eine der dringendsten Desiderate
auf der Akropolis.
Die frühen Porosskulpturen, die peisistratidischen
Gigantengiebel, die Koren des Akropolismuseums
glaubte man genügend aus guten Abbildungen zu ken-
nen, Stück für Stück. In Wahrheit ist der Eindruck, den
man von ihnen an ürt und Stelle hat, in seiner über-
wältigenden Wirkung garnicht zu beschreiben. Das
gedrängte in den nicht sehr großen Räumen kommt
ihnen dabei nocli zugute; meist sind sie auch richtig
aufgestellt. Die archaische Skulpturengruppe ist hier
eine lebendige Welt von dämonischer Einwirkung.
Anders der Saal der Parthenonskulpturen. Gewiß war
es eine schwere Aufgabe, die Gipsabgüsse der Elgin
Marbles, deren Vorhandensein an dieser Stelle unum-
gänglich notwendig ist, neben den Originalstücken
unterzubringen. Aber so wie die Dinge sich darstellen,
hat man sich, nach erfolgreicher Anstrengung in den
archaischen Sälen, seltsamer Weise der Lösung dieser
wichtigen Aufgabe iiberhaupt entzogen. 12 Platten
des Parthenonfrieses, aus türkischem Gemäuer auf der
Akropolis stammend, von denen 9 noch völlig erkenn-
baren Charakter haben, unter ihnen herrliche Stücke,
Skulpturen, für die man an anderen Orten ohne Be-
denken ein eigenes Museum bauen würde, Werke, die
kein schnödes Gold aufwiegt, das sie weder schaffen,
noch bestellen, noch kaufen kann, sind hier zu ebener
Erde, nur wenige Zentimeter über dem Fußboden an-
gebracht, unter den über ihnen lagernden Gipsabgüssen.
Der Torso der Selene aus dem Ostgiebel, ein herrliches
Stück, nebenbei von großem Interesse wegen der Wa-
genlenkertracht, der Sauer’sche Torso und das Frag-
ment des Athenakopfes aus dem Westgiebel stehen in
einem Winkel zwischen Gipsen und Bruchstücken. Der
Athenakopf, von dern Collignon in der großen Parthe-
nonpublikation eine so überraschende Aufnahme gibt
(pl. 58, in Verbindung mit dem Londoner Fragment)
ist überhaupt kaum sichtbar! ! Auch hier ist, bei voller
und dankbarer Anerkennung des von der griechischen
Archäologie sonst — etwa in Epidauros, um ein Bei-
spiel anzuführen — auf dem Museumsgebiete geleiste-
ten auf eine Änderung zu dringen.
Das Akropolismuseum ist in geschickter Weise in
einer Vertiefung des Terrains untergebracht, die sich
zwischen der Höhe des Akropolisfelsens und der kimo-
nischen Stützmauer befindet, und die itn Altertum auf-
geschüttet war. Wenn man, gegen Sonnenuntergang
das Museum verlassend, iiber das Dutzend Stufen der
kleinen Treppe aus dieser Vertiefung wieder auf der
Oberfläche des Felsens auftaucht, bietet sich eiuem ein
Bild dar, das zu den unvergeßlichen Eindrücken auf
der Akropolis gehört. Die herrlliche, wegen des im
Ruin fehlenden Hintergrundes in ihrer absoluten Voll-
kommenheit ganz fiir sich wirkende Säulenstellung der
Ostseite des Parthenon zeigt das strahlende trockene
Rostrot ilirer Patina auf einem grüngelben Himmels-
grunde von makelloser Transparenz. Der Felsboden ist
hellviolett, die herumliegenden Trümmer weiß, das
Erechtheion rechts elfenbeinfarben, ferne Hügelzüge
hinter ihm scheinen in dunkelviolette Tinten getaucht.
Das Beseelte einer solchen leuchtenden Vision zwi-
schen Himmel und Erde, in erhabener Lautlosigkeit, läßt
das Wort verstummen. Der Abend konzentriert diese
Architekturmassen, die der Tag ausgebreitet hatte.
In den großen und hohen Sälen des Athener Natio-
nalmuseums ist man von den Marmorbildern in so
schöner Weise umgeben, daß man beim Abschied gar-
nicht weiß, wie man eigentlich ohne sie weiterleben
wird. Das gilt vor allem für die unvergleichlichen Säle
mit den Grabreliefs. Der aus lauter Originalwerken
bestehende arabische Saal, die angrenzenden Säle des
V. und IV. Jahrhunderts, in denen die meisten Stücke
Originalwerke sind, in prachtvollem Liclit hier zu sehen,
der große Saal, in dctn der Poseidon von Melos und die
Delische Venusgruppe stehen, der Saal der Porträt-
büsten mit dem mächtigen, gut aufgestellten Abguß der
Nike von Samothrake — alles das verklärt sich als
griechische Erinnerung im C.edächtnis, besonders wenn
man nachher die pompöse Aufstellung der vatikanischen
Späthellenistische Venusgruppe von Delos
73
schen Denkmalpflege geleisteten Arbeiten in den Pro-
pyläen muß zugleich der dringende Wunsch ausge-
sprochen werden, den Nordflügel der letzteren von
seinem Gitter befreit und von seinen willkürlichen Ein-
bauten gereinigt zu sehen. Die Pinakothek ist nicht nur
unzugänglich, sondern sie wird als Ablegeraum benutzt,
ab und zu treiben in ihr zu den Wächtern gehörige
Kinder lärmend ihr Wesen. Eine Änderung dieses Zu-
standes müßte den zuständigen Stellen in Athen nahe-
gelegt werden, sie ist eine der dringendsten Desiderate
auf der Akropolis.
Die frühen Porosskulpturen, die peisistratidischen
Gigantengiebel, die Koren des Akropolismuseums
glaubte man genügend aus guten Abbildungen zu ken-
nen, Stück für Stück. In Wahrheit ist der Eindruck, den
man von ihnen an ürt und Stelle hat, in seiner über-
wältigenden Wirkung garnicht zu beschreiben. Das
gedrängte in den nicht sehr großen Räumen kommt
ihnen dabei nocli zugute; meist sind sie auch richtig
aufgestellt. Die archaische Skulpturengruppe ist hier
eine lebendige Welt von dämonischer Einwirkung.
Anders der Saal der Parthenonskulpturen. Gewiß war
es eine schwere Aufgabe, die Gipsabgüsse der Elgin
Marbles, deren Vorhandensein an dieser Stelle unum-
gänglich notwendig ist, neben den Originalstücken
unterzubringen. Aber so wie die Dinge sich darstellen,
hat man sich, nach erfolgreicher Anstrengung in den
archaischen Sälen, seltsamer Weise der Lösung dieser
wichtigen Aufgabe iiberhaupt entzogen. 12 Platten
des Parthenonfrieses, aus türkischem Gemäuer auf der
Akropolis stammend, von denen 9 noch völlig erkenn-
baren Charakter haben, unter ihnen herrliche Stücke,
Skulpturen, für die man an anderen Orten ohne Be-
denken ein eigenes Museum bauen würde, Werke, die
kein schnödes Gold aufwiegt, das sie weder schaffen,
noch bestellen, noch kaufen kann, sind hier zu ebener
Erde, nur wenige Zentimeter über dem Fußboden an-
gebracht, unter den über ihnen lagernden Gipsabgüssen.
Der Torso der Selene aus dem Ostgiebel, ein herrliches
Stück, nebenbei von großem Interesse wegen der Wa-
genlenkertracht, der Sauer’sche Torso und das Frag-
ment des Athenakopfes aus dem Westgiebel stehen in
einem Winkel zwischen Gipsen und Bruchstücken. Der
Athenakopf, von dern Collignon in der großen Parthe-
nonpublikation eine so überraschende Aufnahme gibt
(pl. 58, in Verbindung mit dem Londoner Fragment)
ist überhaupt kaum sichtbar! ! Auch hier ist, bei voller
und dankbarer Anerkennung des von der griechischen
Archäologie sonst — etwa in Epidauros, um ein Bei-
spiel anzuführen — auf dem Museumsgebiete geleiste-
ten auf eine Änderung zu dringen.
Das Akropolismuseum ist in geschickter Weise in
einer Vertiefung des Terrains untergebracht, die sich
zwischen der Höhe des Akropolisfelsens und der kimo-
nischen Stützmauer befindet, und die itn Altertum auf-
geschüttet war. Wenn man, gegen Sonnenuntergang
das Museum verlassend, iiber das Dutzend Stufen der
kleinen Treppe aus dieser Vertiefung wieder auf der
Oberfläche des Felsens auftaucht, bietet sich eiuem ein
Bild dar, das zu den unvergeßlichen Eindrücken auf
der Akropolis gehört. Die herrlliche, wegen des im
Ruin fehlenden Hintergrundes in ihrer absoluten Voll-
kommenheit ganz fiir sich wirkende Säulenstellung der
Ostseite des Parthenon zeigt das strahlende trockene
Rostrot ilirer Patina auf einem grüngelben Himmels-
grunde von makelloser Transparenz. Der Felsboden ist
hellviolett, die herumliegenden Trümmer weiß, das
Erechtheion rechts elfenbeinfarben, ferne Hügelzüge
hinter ihm scheinen in dunkelviolette Tinten getaucht.
Das Beseelte einer solchen leuchtenden Vision zwi-
schen Himmel und Erde, in erhabener Lautlosigkeit, läßt
das Wort verstummen. Der Abend konzentriert diese
Architekturmassen, die der Tag ausgebreitet hatte.
In den großen und hohen Sälen des Athener Natio-
nalmuseums ist man von den Marmorbildern in so
schöner Weise umgeben, daß man beim Abschied gar-
nicht weiß, wie man eigentlich ohne sie weiterleben
wird. Das gilt vor allem für die unvergleichlichen Säle
mit den Grabreliefs. Der aus lauter Originalwerken
bestehende arabische Saal, die angrenzenden Säle des
V. und IV. Jahrhunderts, in denen die meisten Stücke
Originalwerke sind, in prachtvollem Liclit hier zu sehen,
der große Saal, in dctn der Poseidon von Melos und die
Delische Venusgruppe stehen, der Saal der Porträt-
büsten mit dem mächtigen, gut aufgestellten Abguß der
Nike von Samothrake — alles das verklärt sich als
griechische Erinnerung im C.edächtnis, besonders wenn
man nachher die pompöse Aufstellung der vatikanischen
Späthellenistische Venusgruppe von Delos
73