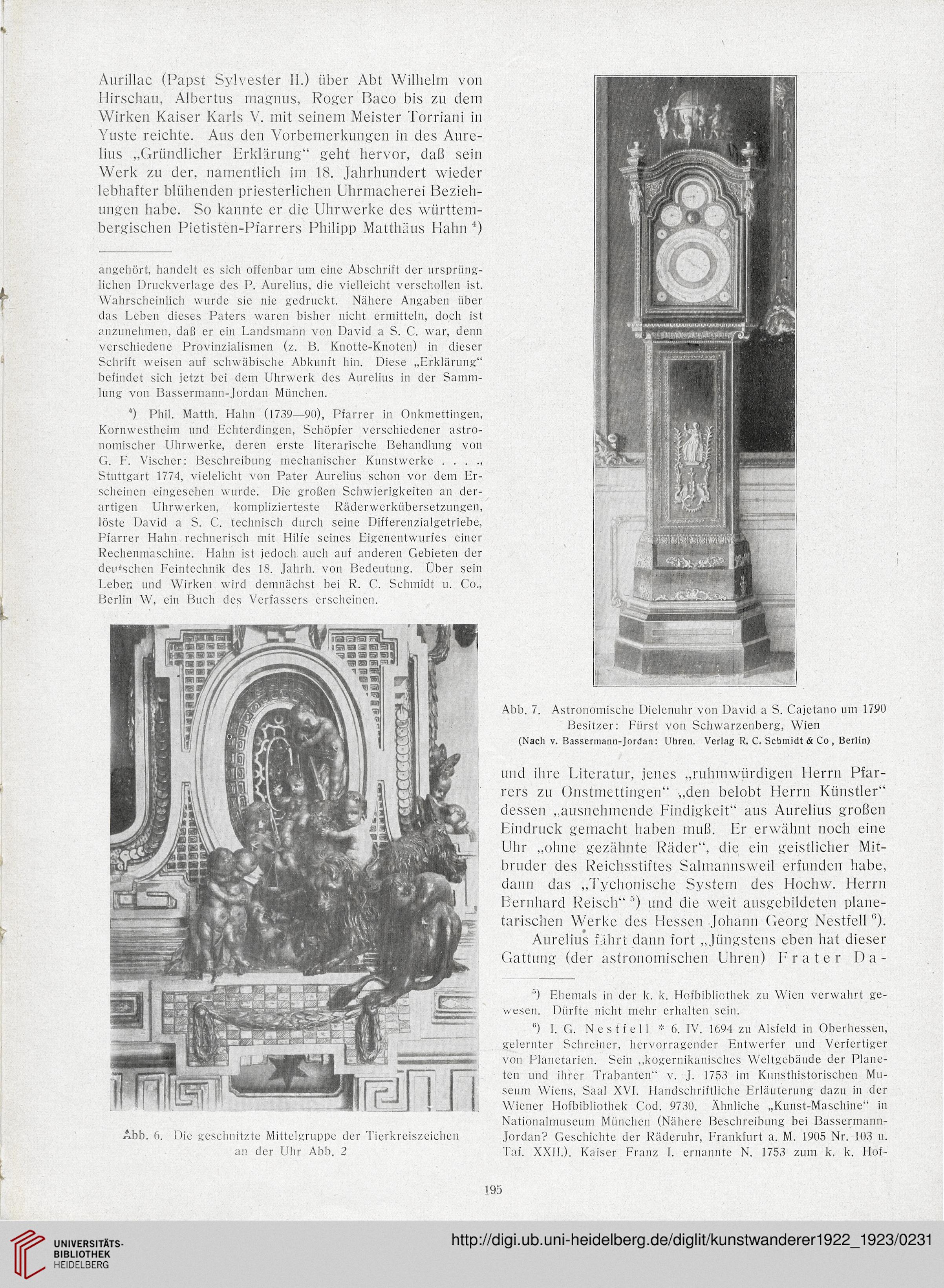Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 4./5.1922/23
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0231
DOI Heft:
1. Januarheft
DOI Artikel:Engelmann, Max: Werke der letzten Blüte klösterlicher Uhrmacherei
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.20303#0231
Aurillac (Papst Sylvester II.) über Abt Wilhelm von
Hirschau, Albertus magnus, Roger Baco bis zu dem
Wirken Kaiser Karis V. mit seinem Meister Torriani in
Yuste reichte. Aus den Vorbemerkungen in des Aure-
lius „Gründlicher Erklärung“ geht hervor, daß sein
Werk zu der, namentlich im 18. Jahrhundert wieder
lebhafter blühenden priesterlichen Uhrmacherei Bezieh-
ungen habe. So kannte er die Uhrwerke des württem-
bergischen Pietisten-Pfarrers Philipp Matthäus Hahn 4)
angehört, handelt es sich offenbar um eine Abschrift der urspriing-
lichen Druckverlage des P. Aurelius, die vielleicht verschollen ist.
Wahrscheinlich wurde sie nie gedruckt. Nähere Angaben über
das Leben dieses Paters waren bisher nicht ermitteln, doch ist
anzunehmen, daß er ein Landsmann von David a S. C. war, denn
verschiedene Provinzialismen (z. B. Knotte-Knoten) in dieser
Schrift weisen auf schwäbische Abkunft hin. Diese „Erklärung“
befindet sich jetzt bei dem Uhrwerk des Aurelius in der Samm-
lung von Bassermann-Jordan München.
4) Phil. Matth. Hahn (1739—90), Pfarrer in Onkmettingen,
Körnwestheim und Echterdingen, Schöpfer verschiedener astro-
nomischer Uhrwerke, deren erste literarische Behandlung von
G. F. Vischer: Beschreibung mechanischer Kunstwerke . . . .,
Stuttgart 1774, vielelicht von Pater Aurelius schon vor dem Er-
scheinen eingesehen wurde. Die großen Schwierigkeiten an der-
artigen Uhrwerken, komplizierteste Räderwerkübersetzungen,
löste David a S. C. technisch durch seine Differenzialgetriebe,
Pfarrer Hahn rechnerisch mit Hilfe seines Eigenentwurfes einer
Rechenmaschine. Hahn ist jedoch. auch auf anderen Gebieten der
deu+schen Feintechnik des 18. Jahrh. von Bedeutung. Über sein
Leben und Wirken wird demnächst bei R. C. Schmidt u. Co.,
Berlin W, ein Buch des Verfassers erscheinen.
Abb. 6. Die geschnitzte Mittelgruppe der Tierkreiszeichen
an der Uhr Abb. 2
Abb. 7. Astronomische Dielenuhr von David a S. Cajetano um 1790
Besitzer: Fiirst von Schwarzenberg, Wien
(Nach v. Bassermann-Jordan: Uhren. Verlag R. C. Schmidt & Co , Berlin)
und ihre Literatur, jenes „ruhmwürdigen Herrn Pfar-
rers zu Onstmettingen“ „den belobt Herrn Künstler“
dessen „ausnehmende Findigkeit“ aus Aurelius großen
Hindruck gemacht haben muß. Er erwähnt noch eine
Uhr „ohne gezähnte Räder“, die ein geistlicher Mit-
bruder des Reichsstiftes Salmannsweil erfunden habe,
dann das „Tychonische System des Hochw. Herrn
Bernhard Reisch“ r>) und die weit ausgebildeten plane-
tarischen Werke des Hessen Johann Georg Nestfell6).
Aurelius fährt dann fort „Jüngstens eben hat dieser
Gattung (der astronomischen Uhren) F r a t e r D a -
5) Ehemals in der k. k. Hofbibliothek zu Wien verwahrt ge-
wesen. Diirfte nicht mehr erlialten sein.
“) I. G. N e s t f e 11 * 6. IV. 1694 zu Alsfeld in Oberhessen,
gelernter Schreiner, hervorragender Entwerfer und Verfertiger
von Planetarien. Sein „kogernikanisches Weltgebäude der Plane-
ten und ihrer Trabanten“ v. J. 1753 im Kunsthistorischen Mu-
seum Wiens, Saal XVI. Handschriftliche Erläuterung dazu in der
Wiener Hofbibliothek Cod. 9730. Ähnliche „Kunst-Maschine“ in
Nationalmuseum München (Nähere Beschreibung bei Bassermann-
Jordan? Geschichte der Räderuhr, Frankfurt a. M. 1905 Nr. 103 u.
Taf. XXII.). Kaiser Franz I. ernannte N. 1753 zum k. k. Hof-
195
Hirschau, Albertus magnus, Roger Baco bis zu dem
Wirken Kaiser Karis V. mit seinem Meister Torriani in
Yuste reichte. Aus den Vorbemerkungen in des Aure-
lius „Gründlicher Erklärung“ geht hervor, daß sein
Werk zu der, namentlich im 18. Jahrhundert wieder
lebhafter blühenden priesterlichen Uhrmacherei Bezieh-
ungen habe. So kannte er die Uhrwerke des württem-
bergischen Pietisten-Pfarrers Philipp Matthäus Hahn 4)
angehört, handelt es sich offenbar um eine Abschrift der urspriing-
lichen Druckverlage des P. Aurelius, die vielleicht verschollen ist.
Wahrscheinlich wurde sie nie gedruckt. Nähere Angaben über
das Leben dieses Paters waren bisher nicht ermitteln, doch ist
anzunehmen, daß er ein Landsmann von David a S. C. war, denn
verschiedene Provinzialismen (z. B. Knotte-Knoten) in dieser
Schrift weisen auf schwäbische Abkunft hin. Diese „Erklärung“
befindet sich jetzt bei dem Uhrwerk des Aurelius in der Samm-
lung von Bassermann-Jordan München.
4) Phil. Matth. Hahn (1739—90), Pfarrer in Onkmettingen,
Körnwestheim und Echterdingen, Schöpfer verschiedener astro-
nomischer Uhrwerke, deren erste literarische Behandlung von
G. F. Vischer: Beschreibung mechanischer Kunstwerke . . . .,
Stuttgart 1774, vielelicht von Pater Aurelius schon vor dem Er-
scheinen eingesehen wurde. Die großen Schwierigkeiten an der-
artigen Uhrwerken, komplizierteste Räderwerkübersetzungen,
löste David a S. C. technisch durch seine Differenzialgetriebe,
Pfarrer Hahn rechnerisch mit Hilfe seines Eigenentwurfes einer
Rechenmaschine. Hahn ist jedoch. auch auf anderen Gebieten der
deu+schen Feintechnik des 18. Jahrh. von Bedeutung. Über sein
Leben und Wirken wird demnächst bei R. C. Schmidt u. Co.,
Berlin W, ein Buch des Verfassers erscheinen.
Abb. 6. Die geschnitzte Mittelgruppe der Tierkreiszeichen
an der Uhr Abb. 2
Abb. 7. Astronomische Dielenuhr von David a S. Cajetano um 1790
Besitzer: Fiirst von Schwarzenberg, Wien
(Nach v. Bassermann-Jordan: Uhren. Verlag R. C. Schmidt & Co , Berlin)
und ihre Literatur, jenes „ruhmwürdigen Herrn Pfar-
rers zu Onstmettingen“ „den belobt Herrn Künstler“
dessen „ausnehmende Findigkeit“ aus Aurelius großen
Hindruck gemacht haben muß. Er erwähnt noch eine
Uhr „ohne gezähnte Räder“, die ein geistlicher Mit-
bruder des Reichsstiftes Salmannsweil erfunden habe,
dann das „Tychonische System des Hochw. Herrn
Bernhard Reisch“ r>) und die weit ausgebildeten plane-
tarischen Werke des Hessen Johann Georg Nestfell6).
Aurelius fährt dann fort „Jüngstens eben hat dieser
Gattung (der astronomischen Uhren) F r a t e r D a -
5) Ehemals in der k. k. Hofbibliothek zu Wien verwahrt ge-
wesen. Diirfte nicht mehr erlialten sein.
“) I. G. N e s t f e 11 * 6. IV. 1694 zu Alsfeld in Oberhessen,
gelernter Schreiner, hervorragender Entwerfer und Verfertiger
von Planetarien. Sein „kogernikanisches Weltgebäude der Plane-
ten und ihrer Trabanten“ v. J. 1753 im Kunsthistorischen Mu-
seum Wiens, Saal XVI. Handschriftliche Erläuterung dazu in der
Wiener Hofbibliothek Cod. 9730. Ähnliche „Kunst-Maschine“ in
Nationalmuseum München (Nähere Beschreibung bei Bassermann-
Jordan? Geschichte der Räderuhr, Frankfurt a. M. 1905 Nr. 103 u.
Taf. XXII.). Kaiser Franz I. ernannte N. 1753 zum k. k. Hof-
195