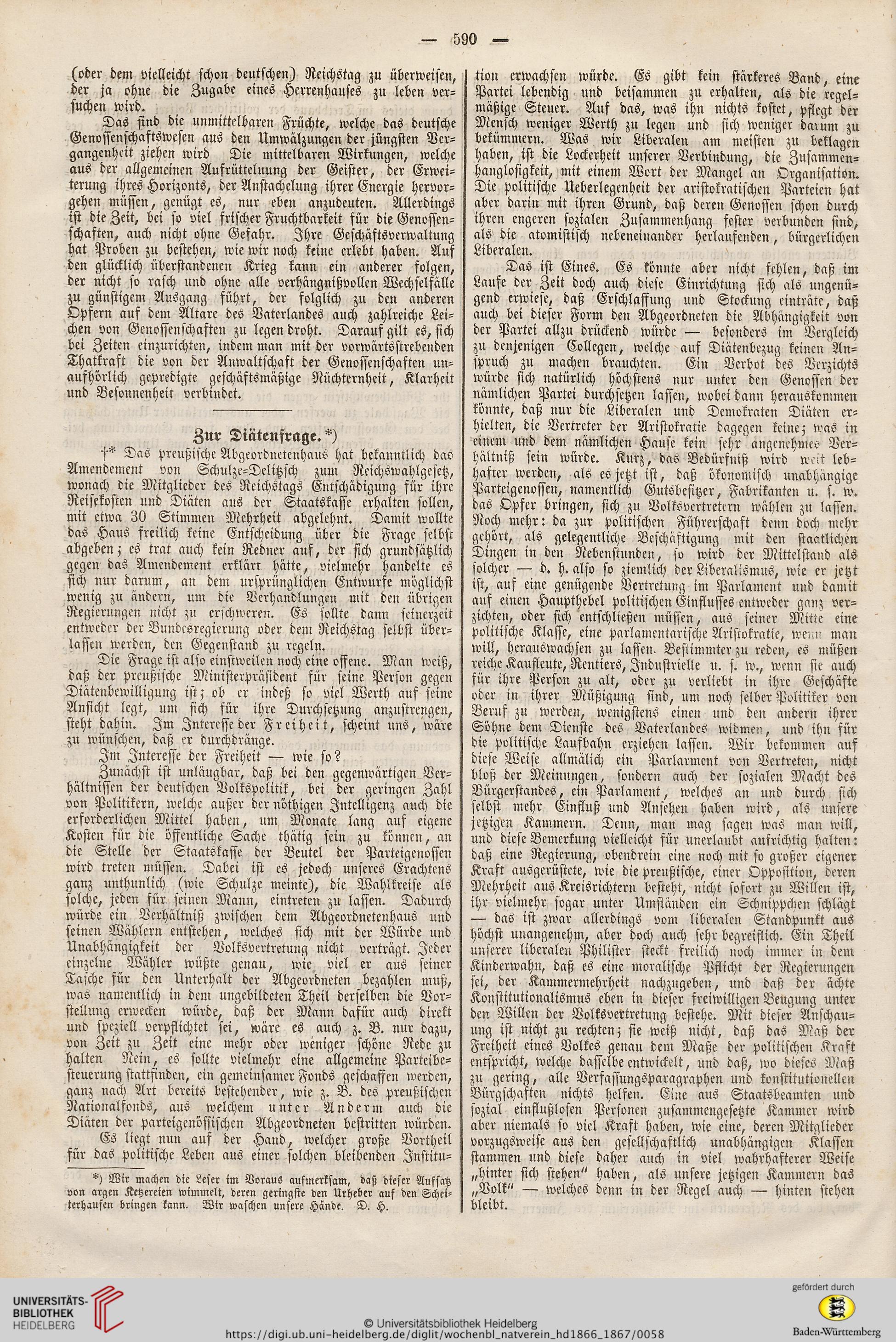590
(oder dem vielleicht schon deutschen) Reichstag zu überweisen,
der ja ohne die Zugabe eines Herrenhauses zu leben ver-
suchen wird.
Das sind die unmittelbaren Früchte, welche das deutsche
Genoffenschaftswesen aus den Umwälzungen der jüngsten Ver-
gangenheit ziehen wird Die mittelbaren Wirkungen, welche
aus der allgemeinen Aufrüttelnung der Geister, der Erwei-
terung ihres Horizonts, der Anstachelung ihrer Energie hervor-
gehen müssen, genügt es, nur eben anzudeuten. Allerdings
ist die Zeit, bei so viel frischer Fruchtbarkeit für die Genossen-
schaften, auch nicht ohne Gefahr. Ihre Gcschäftsverwaltung
hat Proben zu bestehen, wie wir noch keine erlebt haben. Auf
den glücklich überstandenen Krieg kann ein anderer folgen,
der nicht so rasch und ohne alle verhängnißvollen Wechselfälle
zu günstigem Ausgang führt, der folglich zu den anderen
Opfern auf dem Altäre des Vaterlandes auch zahlreiche Lei-
chen von Genossenschaften zu legen droht. Darauf gilt es, sich
bei Zeiten cinzurichten, indem man mit der vorwärtsstrebenden
Thatkraft die von der Anwaltschaft der Genossenschaften un-
aufhörlich gepredigte geschäftsmäßige Nüchternheit, Klarheit
und Besonnenheir verbindet.
Zur Diätenfrage.*)
ch* Das preußische Abgeordnetenhaus hat bekanntlich das
Amendement von Schulze-Delitzsch zum Rcichswahlgesctz,
wonach die Mitglieder des Reichstags Entschädigung für ihre
Reisekosten und Diäten aus der Staatskasse erhalten sollen,
mit etwa 30 Stimmen Mehrheit abgelehnt. Damit wollte
das Haus freilich keine Entscheidung über die Frage selbst
abgcben; es trat auch kein Redner auf, der sich grundsätzlich
gegen das Amendement erklärt hätte, vielmehr handelte es
sich nur darum, an dem ursprünglichen Entwürfe möglichst
wenig zu ändern, um die Verhandlungen mit den übrigen
Regierungen nicht zu erschweren. Es sollte dann seinerzeit
entweder der Bundesregierung oder dem Reichstag selbst über-
lassen werden, den Gegenstand zu regeln.
Die Frage ist also einstweilen noch eine offene. Man weiß,
daß der preußische Ministerpräsident für seine Person gegen
Diätcnbcwilligung ist; ob er indeß so viel Werth auf seine
Ansicht legt, um sich für ihre Durchsetzung anzustrengen,
steht dahin. Im Interesse der Freiheit, scheint uns, wäre
zu wünschen, daß er durchdränge.
Im Interesse der Freiheit — wie so?
Zunächst ist unläugbar, daß bei den gegenwärtigen Ver-
hältnissen der deutschen Volkspolitik, bei der geringen Zahl
von Politikern, welche außer der nöthigen Intelligenz auch die
erforderlichen Mittel haben, um Monate lang auf eigene
Kosten für die öffentliche Sache thätig sein zu können, an
die Stelle der Staatskasse der Beutel der Parteigenossen
wird treten müssen. Dabei ist es jedoch unseres Erachtens
ganz unthunlich (wie Schulze meinte), die Wahlkreise als
solche, jeden für seinen Mann, eintrctcn zu lassen. Dadurch
würde ein Verhältnis; zwischen dem Abgeordnetenhaus und
seinen Wählern entstehen, welches sich mit der Würde und
Unabhängigkeit der Volksvertretung nicht verträgt. Jeder
einzelne Wähler wüßte genau, wie viel er aus seiner
Tasche für den Unterhalt der Abgeordneten bezahlen muß,
was namentlich in dem ungebildeten Theil derselben die Vor-
stellung erwecken würde, daß der Alami dafür auch direkt
und speziell verpflichtet sei, wäre es auch z. B. nur dazu,
von Zeit zu Zeit eine mehr oder weniger schöne Rede zu
halten Nein, es sollte vielmehr eine allgemeine Parteibc-
steuerung stattfindcn, ein gemeinsamer Fonds geschaffen werden,
ganz nach Art bereits bestehender, wie z. B. des preußischen
Nationalfonds, aus welchem unter Andern: auch die
Diäten der parteigenössischcn Abgeordneten bestritten würden.
Es liegt nun auf der Hand, welcher große Vortheil
für das politische Leben aus einer solchen bleibenden Jnstitu-
*) Wir machen die Leser im Voraus aufmerksam, daß dieser Aufsatz
von argen Ketzereien wimmelt, deren geringste den Urheber auf den Schei-
terhaufen bringen kann. Wir waschen unsere Hände. D. H.
tion erwachsen würde. Es gibt kein stärkeres Band, eine
Partei lebendig und beisammen zu erhalten, als die regel-
mäßige Steuer. Auf das, was ihn nichts kostet, pflogt der
Mensch weniger Werth zu legen und sich weniger darum zu
bekümmern. Was wir Liberalen am meisten zu beklagen
haben, ist die Lockerheit unserer Verbindung, die Zusammen-
hanglosigkeit, mit einem Wert der Mangel an Organisation.
Die politische Ucberlegenheit der aristokratischen Parteien hat
aber darin mit ihren Grund, daß deren Genossen schon durch
ihren engeren sozialen Zusammenhang fester verbunden sind,
als die atomistisch nebeneinander herlaufcnden, bürgerlichen
Liberalen.
Das ist Eines. Es könnte aber nicht fehlen, daß im
Laufe der Zeit doch auch diese Einrichtung sich als ungenü-
gend erwiese, daß Erschlaffung und Stockung einträtc, daß
auch bei dieser Form den Abgeordneten die Abhängigkeit von
der Partei allzu drückend würde — besonders im Vergleich
zu denjenigen College«, welche auf Diätenbczug keinen An-
spruch zu machen brauchten. Ein Verbot des Verzichts
würde sich natürlich höchstens nur unter den Genossen der
nämlichen Partei durchsetzen lassen, wobei dann herauskvmmen
könnte, daß nur die Liberalen und Demokraten Diäten er-
hielten, die Vertreter der Aristokratie dagegen keine; waö in
einem und dem nämlichen Hause kein sehr angenehmes Ver-
häitniß sein würde. Kurz, das Bedürfniß wird weck leb-
hafter werden, als es jetzt ist, daß ökonomisch unabhängige
Parteigenossen, namentlich Gutsbesitzer, Fabrikanten u. s. w.
das Opfer bringen, sich zu Volksvertretern wählen zu lassen.
Noch mehr: da zur politischen Führerschaft denn doch mehr
gehört, als gelegentliche Beschäftigung mit den staatlichen
Dingen in den Nebenstunden, so wird der Mittelstand als
solcher — d. h. also so ziemlich der Liberalismus, wie er jetzt
ist, auf eine genügende Vertretung im Parlament und damit
auf einen Haupthebel politischen Einflusses entweder ganz ver-
zichten, oder sich entschließen müssen, aus seiner Mitte eine
politische Klaffe, eine parlamentarische Aristokratie, wenn man
will, herauswachsen zu lassen. Bestimmter zu reden, es müßen
reiche Kaufleute, Rentiers, Industrielle u. s. w., wenn sie auch
für ihre Person zu alt, oder zu verliebt in ihre Geschäfte
oder in ihrer Mäßigung sind, um noch selber Politiker von
Beruf zu werden, wenigstens einen und den andern ihrer
Söhne dem Dienste des Vaterlandes widmen, und ihn für
die politische Laufbahn erziehen lassen. Wir bekommen auf
diese Weise allmälich ein Parlarmcnt von Vertreten, nicht
bloß der Meinungen, sondern auch der sozialen Macht des
Bürgcrstandes, ein Parlament, welches an und durch sich
selbst mehr Einfluß und Ansehen haben wird, als unsere
jetzigen Kammern. Denn, man mag sagen was man will,
und diese Bemerkung vielleicht für unerlaubt aufrichtig halten:
daß eine Regierung, obendrein eine noch mit so großer eigener
Kraft ausgerüstete, wie die preußische, einer Opposition, deren
Mehrheit aus Kreisrichtcrn besteht, nicht sofort zu Willen ist,
ihr vielmehr sogar unter Umständen ein Schnippchen schlägt
— das ist zwar allerdings vom liberalen Standpunkt aus
höchst unangenehm, aber doch auch sehr begreiflich. Ein Theil
unserer liberalen Philister steckt freilich noch immer in dem
Kinderwahn, daß es eine moralische Pflicht der Regierungen
sei, der Kammermehrheit nachzugeben, und daß der ächte
Konstitutionalismus eben in dieser freiwilligen Beugung unter
den Willen der Volksvertretung bestehe. Mit dieser Anschau-
ung ist nicht zu rechten; sie weiß nicht, daß das Maß der
Freiheit eines Volkes genau dem Maße der politischen Kraft
entspricht, welche dasselbe entwickelt, und daß, wo dieses Maß
zu gering, alle Verfassungsparagraphen und konstitutionellen
Bürgschaften nichts helfen. Eine aus Staatsbeamten und
sozial einflußlosen Personen zusammengesetzte Kammer wird
aber niemals so viel Kraft haben, wie eine, deren Mitglieder
vorzugsweise aus den gesellschaftlich unabhängigen Klassen
stammen und diese daher auch in viel wahrhafterer Weise
„hinter sich stehen" haben, als unsere jetzigen Kammern das
„Volk" — welches denn in der Regel auch — hinten stehen
bleibt.
(oder dem vielleicht schon deutschen) Reichstag zu überweisen,
der ja ohne die Zugabe eines Herrenhauses zu leben ver-
suchen wird.
Das sind die unmittelbaren Früchte, welche das deutsche
Genoffenschaftswesen aus den Umwälzungen der jüngsten Ver-
gangenheit ziehen wird Die mittelbaren Wirkungen, welche
aus der allgemeinen Aufrüttelnung der Geister, der Erwei-
terung ihres Horizonts, der Anstachelung ihrer Energie hervor-
gehen müssen, genügt es, nur eben anzudeuten. Allerdings
ist die Zeit, bei so viel frischer Fruchtbarkeit für die Genossen-
schaften, auch nicht ohne Gefahr. Ihre Gcschäftsverwaltung
hat Proben zu bestehen, wie wir noch keine erlebt haben. Auf
den glücklich überstandenen Krieg kann ein anderer folgen,
der nicht so rasch und ohne alle verhängnißvollen Wechselfälle
zu günstigem Ausgang führt, der folglich zu den anderen
Opfern auf dem Altäre des Vaterlandes auch zahlreiche Lei-
chen von Genossenschaften zu legen droht. Darauf gilt es, sich
bei Zeiten cinzurichten, indem man mit der vorwärtsstrebenden
Thatkraft die von der Anwaltschaft der Genossenschaften un-
aufhörlich gepredigte geschäftsmäßige Nüchternheit, Klarheit
und Besonnenheir verbindet.
Zur Diätenfrage.*)
ch* Das preußische Abgeordnetenhaus hat bekanntlich das
Amendement von Schulze-Delitzsch zum Rcichswahlgesctz,
wonach die Mitglieder des Reichstags Entschädigung für ihre
Reisekosten und Diäten aus der Staatskasse erhalten sollen,
mit etwa 30 Stimmen Mehrheit abgelehnt. Damit wollte
das Haus freilich keine Entscheidung über die Frage selbst
abgcben; es trat auch kein Redner auf, der sich grundsätzlich
gegen das Amendement erklärt hätte, vielmehr handelte es
sich nur darum, an dem ursprünglichen Entwürfe möglichst
wenig zu ändern, um die Verhandlungen mit den übrigen
Regierungen nicht zu erschweren. Es sollte dann seinerzeit
entweder der Bundesregierung oder dem Reichstag selbst über-
lassen werden, den Gegenstand zu regeln.
Die Frage ist also einstweilen noch eine offene. Man weiß,
daß der preußische Ministerpräsident für seine Person gegen
Diätcnbcwilligung ist; ob er indeß so viel Werth auf seine
Ansicht legt, um sich für ihre Durchsetzung anzustrengen,
steht dahin. Im Interesse der Freiheit, scheint uns, wäre
zu wünschen, daß er durchdränge.
Im Interesse der Freiheit — wie so?
Zunächst ist unläugbar, daß bei den gegenwärtigen Ver-
hältnissen der deutschen Volkspolitik, bei der geringen Zahl
von Politikern, welche außer der nöthigen Intelligenz auch die
erforderlichen Mittel haben, um Monate lang auf eigene
Kosten für die öffentliche Sache thätig sein zu können, an
die Stelle der Staatskasse der Beutel der Parteigenossen
wird treten müssen. Dabei ist es jedoch unseres Erachtens
ganz unthunlich (wie Schulze meinte), die Wahlkreise als
solche, jeden für seinen Mann, eintrctcn zu lassen. Dadurch
würde ein Verhältnis; zwischen dem Abgeordnetenhaus und
seinen Wählern entstehen, welches sich mit der Würde und
Unabhängigkeit der Volksvertretung nicht verträgt. Jeder
einzelne Wähler wüßte genau, wie viel er aus seiner
Tasche für den Unterhalt der Abgeordneten bezahlen muß,
was namentlich in dem ungebildeten Theil derselben die Vor-
stellung erwecken würde, daß der Alami dafür auch direkt
und speziell verpflichtet sei, wäre es auch z. B. nur dazu,
von Zeit zu Zeit eine mehr oder weniger schöne Rede zu
halten Nein, es sollte vielmehr eine allgemeine Parteibc-
steuerung stattfindcn, ein gemeinsamer Fonds geschaffen werden,
ganz nach Art bereits bestehender, wie z. B. des preußischen
Nationalfonds, aus welchem unter Andern: auch die
Diäten der parteigenössischcn Abgeordneten bestritten würden.
Es liegt nun auf der Hand, welcher große Vortheil
für das politische Leben aus einer solchen bleibenden Jnstitu-
*) Wir machen die Leser im Voraus aufmerksam, daß dieser Aufsatz
von argen Ketzereien wimmelt, deren geringste den Urheber auf den Schei-
terhaufen bringen kann. Wir waschen unsere Hände. D. H.
tion erwachsen würde. Es gibt kein stärkeres Band, eine
Partei lebendig und beisammen zu erhalten, als die regel-
mäßige Steuer. Auf das, was ihn nichts kostet, pflogt der
Mensch weniger Werth zu legen und sich weniger darum zu
bekümmern. Was wir Liberalen am meisten zu beklagen
haben, ist die Lockerheit unserer Verbindung, die Zusammen-
hanglosigkeit, mit einem Wert der Mangel an Organisation.
Die politische Ucberlegenheit der aristokratischen Parteien hat
aber darin mit ihren Grund, daß deren Genossen schon durch
ihren engeren sozialen Zusammenhang fester verbunden sind,
als die atomistisch nebeneinander herlaufcnden, bürgerlichen
Liberalen.
Das ist Eines. Es könnte aber nicht fehlen, daß im
Laufe der Zeit doch auch diese Einrichtung sich als ungenü-
gend erwiese, daß Erschlaffung und Stockung einträtc, daß
auch bei dieser Form den Abgeordneten die Abhängigkeit von
der Partei allzu drückend würde — besonders im Vergleich
zu denjenigen College«, welche auf Diätenbczug keinen An-
spruch zu machen brauchten. Ein Verbot des Verzichts
würde sich natürlich höchstens nur unter den Genossen der
nämlichen Partei durchsetzen lassen, wobei dann herauskvmmen
könnte, daß nur die Liberalen und Demokraten Diäten er-
hielten, die Vertreter der Aristokratie dagegen keine; waö in
einem und dem nämlichen Hause kein sehr angenehmes Ver-
häitniß sein würde. Kurz, das Bedürfniß wird weck leb-
hafter werden, als es jetzt ist, daß ökonomisch unabhängige
Parteigenossen, namentlich Gutsbesitzer, Fabrikanten u. s. w.
das Opfer bringen, sich zu Volksvertretern wählen zu lassen.
Noch mehr: da zur politischen Führerschaft denn doch mehr
gehört, als gelegentliche Beschäftigung mit den staatlichen
Dingen in den Nebenstunden, so wird der Mittelstand als
solcher — d. h. also so ziemlich der Liberalismus, wie er jetzt
ist, auf eine genügende Vertretung im Parlament und damit
auf einen Haupthebel politischen Einflusses entweder ganz ver-
zichten, oder sich entschließen müssen, aus seiner Mitte eine
politische Klaffe, eine parlamentarische Aristokratie, wenn man
will, herauswachsen zu lassen. Bestimmter zu reden, es müßen
reiche Kaufleute, Rentiers, Industrielle u. s. w., wenn sie auch
für ihre Person zu alt, oder zu verliebt in ihre Geschäfte
oder in ihrer Mäßigung sind, um noch selber Politiker von
Beruf zu werden, wenigstens einen und den andern ihrer
Söhne dem Dienste des Vaterlandes widmen, und ihn für
die politische Laufbahn erziehen lassen. Wir bekommen auf
diese Weise allmälich ein Parlarmcnt von Vertreten, nicht
bloß der Meinungen, sondern auch der sozialen Macht des
Bürgcrstandes, ein Parlament, welches an und durch sich
selbst mehr Einfluß und Ansehen haben wird, als unsere
jetzigen Kammern. Denn, man mag sagen was man will,
und diese Bemerkung vielleicht für unerlaubt aufrichtig halten:
daß eine Regierung, obendrein eine noch mit so großer eigener
Kraft ausgerüstete, wie die preußische, einer Opposition, deren
Mehrheit aus Kreisrichtcrn besteht, nicht sofort zu Willen ist,
ihr vielmehr sogar unter Umständen ein Schnippchen schlägt
— das ist zwar allerdings vom liberalen Standpunkt aus
höchst unangenehm, aber doch auch sehr begreiflich. Ein Theil
unserer liberalen Philister steckt freilich noch immer in dem
Kinderwahn, daß es eine moralische Pflicht der Regierungen
sei, der Kammermehrheit nachzugeben, und daß der ächte
Konstitutionalismus eben in dieser freiwilligen Beugung unter
den Willen der Volksvertretung bestehe. Mit dieser Anschau-
ung ist nicht zu rechten; sie weiß nicht, daß das Maß der
Freiheit eines Volkes genau dem Maße der politischen Kraft
entspricht, welche dasselbe entwickelt, und daß, wo dieses Maß
zu gering, alle Verfassungsparagraphen und konstitutionellen
Bürgschaften nichts helfen. Eine aus Staatsbeamten und
sozial einflußlosen Personen zusammengesetzte Kammer wird
aber niemals so viel Kraft haben, wie eine, deren Mitglieder
vorzugsweise aus den gesellschaftlich unabhängigen Klassen
stammen und diese daher auch in viel wahrhafterer Weise
„hinter sich stehen" haben, als unsere jetzigen Kammern das
„Volk" — welches denn in der Regel auch — hinten stehen
bleibt.