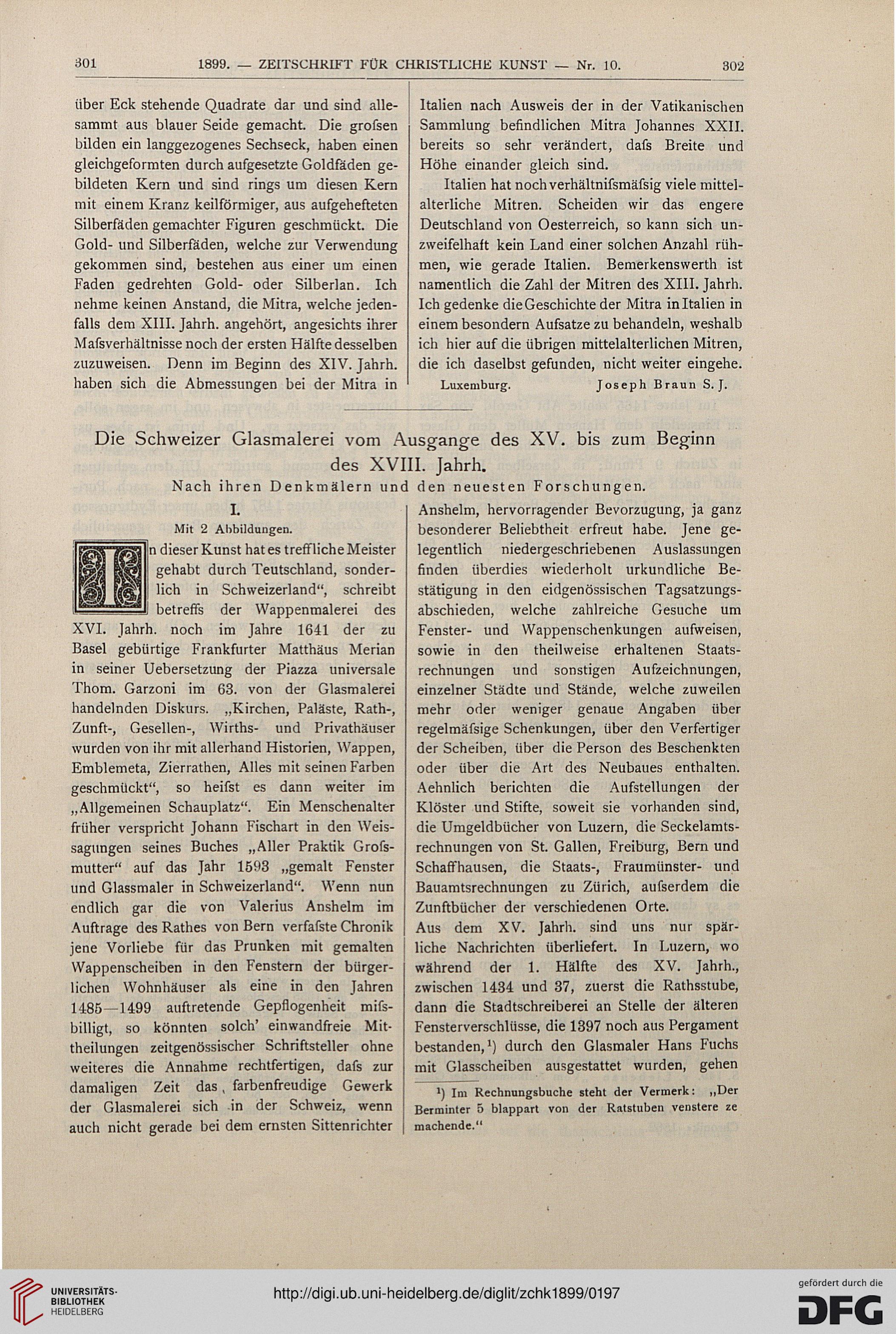301
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
302
über Eck stehende Quadrate dar und sind alle-
sammt aus blauer Seide gemacht. Die grofsen
bilden ein langgezogenes Sechseck, haben einen
gleichgeformten durch aufgesetzte Goldfäden ge-
bildeten Kern und sind rings um diesen Kern
mit einem Kranz keilförmiger, aus aufgehefteten
Silberfäden gemachter Figuren geschmückt. Die
Gold- und Silberfäden, welche zur Verwendung
gekommen sind, bestehen aus einer um einen
Faden gedrehten Gold- oder Silberlan. Ich
nehme keinen Anstand, die Mitra, welche jeden-
falls dem XIII. Jahrh. angehört, angesichts ihrer
Mafsverhältnisse noch der ersten Hälfte desselben
zuzuweisen. Denn im Beginn des XIV. Jahrh.
haben sich die Abmessungen bei der Mitra in
Italien nach Ausweis der in der Vatikanischen
Sammlung befindlichen Mitra Johannes XXII.
bereits so sehr verändert, dafs Breite und
Höhe einander gleich sind.
Italien hat nochverhältnifsmäfsig viele mittel-
alterliche Mitren. Scheiden wir das engere
Deutschland von Oesterreich, so kann sich un-
zweifelhaft kein Land einer solchen Anzahl rüh-
men, wie gerade Italien. Bemerkenswerth ist
namentlich die Zahl der Mitren des XIII. Jahrh.
Ich gedenke die Geschichte der Mitra in Italien in
einem besondern Aufsatze zu behandeln, weshalb
ich hier auf die übrigen mittelalterlichen Mitren,
die ich daselbst gefunden, nicht weiter eingehe.
Luxemburg. Joseph Braun S. J.
Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum Beginn
des XVIII. Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den neuesten Forschungen.
Mit 2 Abbildungen.
n dieser Kunst hat es treffliche Meister
gehabt durch Teutschland, sonder-
lich in Schweizerland", schreibt
betreffs der Wappenmalerei des
XVI. Jahrh. noch im Jahre 1641 der zu
Basel gebürtige Frankfurter Matthäus Merian
in seiner Uebersetzung der Piazza universale
Thom. Garzoni im 63. von der Glasmalerei
handelnden Diskurs. „Kirchen, Paläste, Rath-,
Zunft-, Gesellen-, Wirths- und Privathäuser
wurden von ihr mit allerhand Historien, Wappen,
Emblemeta, Zierrathen, Alles mit seinen Farben
geschmückt", so heifst es dann weiter im
„Allgemeinen Schauplatz". Ein Menschenalter
früher verspricht Johann Fischart in den Weis-
sagungen seines Buches „Aller Praktik Grofs-
mutter" auf das Jahr 1593 „gemalt Fenster
und Glassmaler in Schweizerland". Wenn nun
endlich gar die von Valerius Anshelm im
Auftrage des Rathes von Bern verfafste Chronik
jene Vorliebe für das Prunken mit gemalten
Wappenscheiben in den Fenstern der bürger-
lichen Wohnhäuser als eine in den Jahren
1485—1499 auftretende Gepflogenheit mifs-
billigt, so könnten solch' einwandfreie Mit-
theilungen zeitgenössischer Schriftsteller ohne
weiteres die Annahme rechtfertigen, dafs zur
damaligen Zeit das, farbenfreudige Gewerk
der Glasmalerei sich in der Schweiz, wenn
auch nicht gerade bei dem ernsten Sittenrichter
Anshelm, hervorragender Bevorzugung, ja ganz
besonderer Beliebtheit erfreut habe. Jene ge-
legentlich niedergeschriebenen Auslassungen
finden überdies wiederholt urkundliche Be-
stätigung in den eidgenössischen Tagsatzungs-
abschieden, welche zahlreiche Gesuche um
Fenster- und Wappenschenkungen aufweisen,
sowie in den theilweise erhaltenen Staats-
rechnungen und sonstigen Aufzeichnungen,
einzelner Städte und Stände, welche zuweilen
mehr oder weniger genaue Angaben über
regelmäfsige Schenkungen, über den Verfertiger
der Scheiben, über die Person des Beschenkten
oder über die Art des Neubaues enthalten.
Aehnlich berichten die Aufstellungen der
Klöster und Stifte, soweit sie vorhanden sind,
die Umgeldbücher von Luzern, die Seckelamts-
rechnungen von St. Gallen, Freiburg, Bern und
Schaffhausen, die Staats-, Fraumünster- und
Bauamtsrechnungen zu Zürich, aufserdem die
Zunftbücher der verschiedenen Orte.
Aus dem XV. Jahrh. sind uns nur spär-
liche Nachrichten überliefert. In Luzern, wo
während der 1. Hälfte des XV. Jahrh.,
zwischen 1434 und 37, zuerst die Rathsstube,
dann die Stadtschreiberei an Stelle der älteren
Fensterverschlüsse, die 1397 noch aus Pergament
bestanden,1) durch den Glasmaler Hans Fuchs
mit Glasscheiben ausgestattet wurden, gehen
J) Im Rechnungsbuche steht der Vermerk: „Der
Berminter 5 blappart von der Ratstuben venstere ze
machende."
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
302
über Eck stehende Quadrate dar und sind alle-
sammt aus blauer Seide gemacht. Die grofsen
bilden ein langgezogenes Sechseck, haben einen
gleichgeformten durch aufgesetzte Goldfäden ge-
bildeten Kern und sind rings um diesen Kern
mit einem Kranz keilförmiger, aus aufgehefteten
Silberfäden gemachter Figuren geschmückt. Die
Gold- und Silberfäden, welche zur Verwendung
gekommen sind, bestehen aus einer um einen
Faden gedrehten Gold- oder Silberlan. Ich
nehme keinen Anstand, die Mitra, welche jeden-
falls dem XIII. Jahrh. angehört, angesichts ihrer
Mafsverhältnisse noch der ersten Hälfte desselben
zuzuweisen. Denn im Beginn des XIV. Jahrh.
haben sich die Abmessungen bei der Mitra in
Italien nach Ausweis der in der Vatikanischen
Sammlung befindlichen Mitra Johannes XXII.
bereits so sehr verändert, dafs Breite und
Höhe einander gleich sind.
Italien hat nochverhältnifsmäfsig viele mittel-
alterliche Mitren. Scheiden wir das engere
Deutschland von Oesterreich, so kann sich un-
zweifelhaft kein Land einer solchen Anzahl rüh-
men, wie gerade Italien. Bemerkenswerth ist
namentlich die Zahl der Mitren des XIII. Jahrh.
Ich gedenke die Geschichte der Mitra in Italien in
einem besondern Aufsatze zu behandeln, weshalb
ich hier auf die übrigen mittelalterlichen Mitren,
die ich daselbst gefunden, nicht weiter eingehe.
Luxemburg. Joseph Braun S. J.
Die Schweizer Glasmalerei vom Ausgange des XV. bis zum Beginn
des XVIII. Jahrh.
Nach ihren Denkmälern und den neuesten Forschungen.
Mit 2 Abbildungen.
n dieser Kunst hat es treffliche Meister
gehabt durch Teutschland, sonder-
lich in Schweizerland", schreibt
betreffs der Wappenmalerei des
XVI. Jahrh. noch im Jahre 1641 der zu
Basel gebürtige Frankfurter Matthäus Merian
in seiner Uebersetzung der Piazza universale
Thom. Garzoni im 63. von der Glasmalerei
handelnden Diskurs. „Kirchen, Paläste, Rath-,
Zunft-, Gesellen-, Wirths- und Privathäuser
wurden von ihr mit allerhand Historien, Wappen,
Emblemeta, Zierrathen, Alles mit seinen Farben
geschmückt", so heifst es dann weiter im
„Allgemeinen Schauplatz". Ein Menschenalter
früher verspricht Johann Fischart in den Weis-
sagungen seines Buches „Aller Praktik Grofs-
mutter" auf das Jahr 1593 „gemalt Fenster
und Glassmaler in Schweizerland". Wenn nun
endlich gar die von Valerius Anshelm im
Auftrage des Rathes von Bern verfafste Chronik
jene Vorliebe für das Prunken mit gemalten
Wappenscheiben in den Fenstern der bürger-
lichen Wohnhäuser als eine in den Jahren
1485—1499 auftretende Gepflogenheit mifs-
billigt, so könnten solch' einwandfreie Mit-
theilungen zeitgenössischer Schriftsteller ohne
weiteres die Annahme rechtfertigen, dafs zur
damaligen Zeit das, farbenfreudige Gewerk
der Glasmalerei sich in der Schweiz, wenn
auch nicht gerade bei dem ernsten Sittenrichter
Anshelm, hervorragender Bevorzugung, ja ganz
besonderer Beliebtheit erfreut habe. Jene ge-
legentlich niedergeschriebenen Auslassungen
finden überdies wiederholt urkundliche Be-
stätigung in den eidgenössischen Tagsatzungs-
abschieden, welche zahlreiche Gesuche um
Fenster- und Wappenschenkungen aufweisen,
sowie in den theilweise erhaltenen Staats-
rechnungen und sonstigen Aufzeichnungen,
einzelner Städte und Stände, welche zuweilen
mehr oder weniger genaue Angaben über
regelmäfsige Schenkungen, über den Verfertiger
der Scheiben, über die Person des Beschenkten
oder über die Art des Neubaues enthalten.
Aehnlich berichten die Aufstellungen der
Klöster und Stifte, soweit sie vorhanden sind,
die Umgeldbücher von Luzern, die Seckelamts-
rechnungen von St. Gallen, Freiburg, Bern und
Schaffhausen, die Staats-, Fraumünster- und
Bauamtsrechnungen zu Zürich, aufserdem die
Zunftbücher der verschiedenen Orte.
Aus dem XV. Jahrh. sind uns nur spär-
liche Nachrichten überliefert. In Luzern, wo
während der 1. Hälfte des XV. Jahrh.,
zwischen 1434 und 37, zuerst die Rathsstube,
dann die Stadtschreiberei an Stelle der älteren
Fensterverschlüsse, die 1397 noch aus Pergament
bestanden,1) durch den Glasmaler Hans Fuchs
mit Glasscheiben ausgestattet wurden, gehen
J) Im Rechnungsbuche steht der Vermerk: „Der
Berminter 5 blappart von der Ratstuben venstere ze
machende."