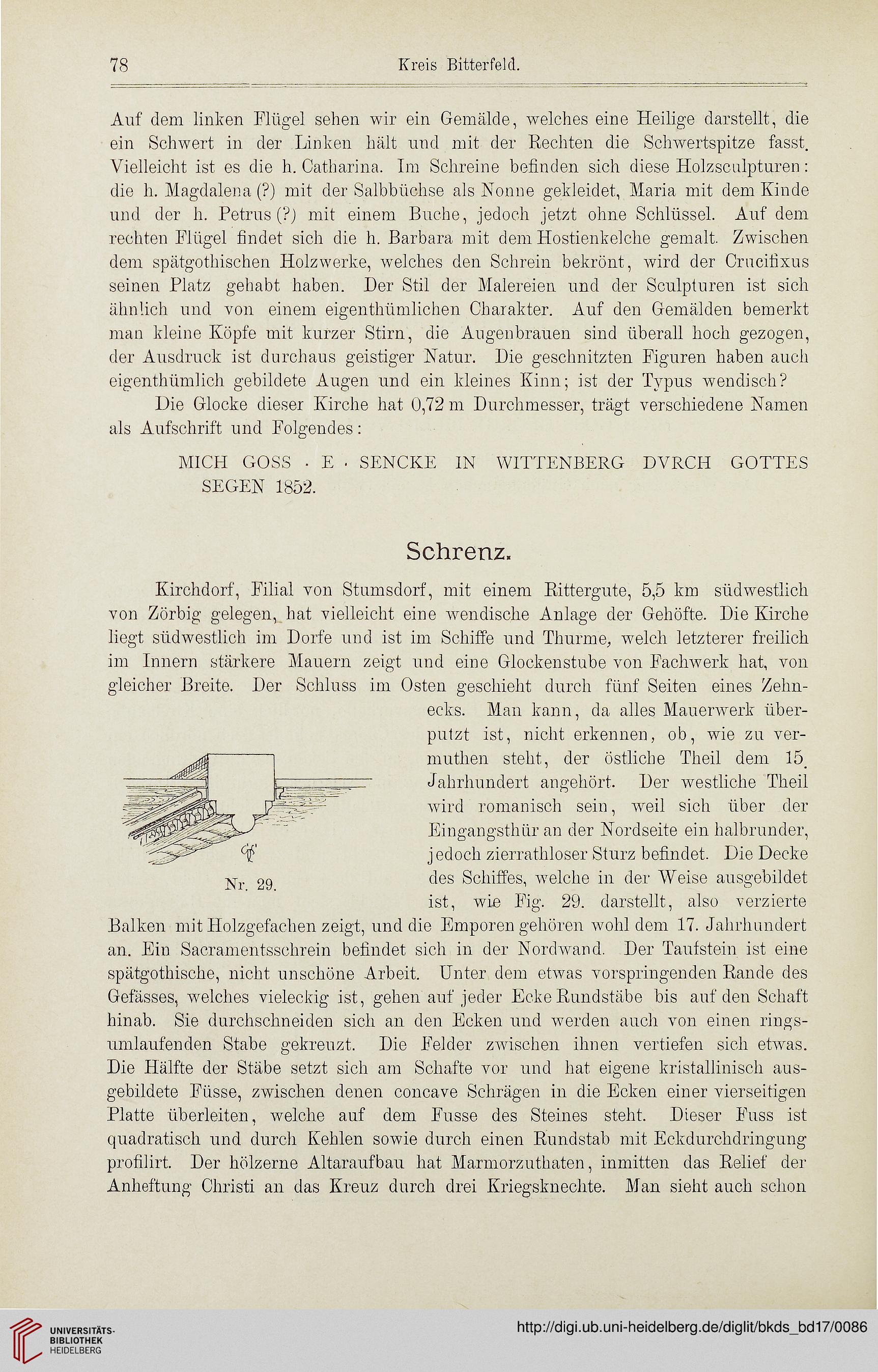78
Kreis Bitterfeid.
Auf dem linken Flügel sehen wir ein Gemälde, welches eine Heilige darstellt, die
ein Schwert in der Linken hält und mit der Rechten die Schwertspitze fasst.
Vielleicht ist es die h. Oatharina. Im Schreine befinden sich diese Holzsculpturen:
die h. Magdalena (?) mit der Salbbüchse als Nonne gekleidet, Maria mit dem Finde
und der h. Petrus (?) mit einem Buche, jedoch jetzt ohne Schlüssel. Auf dem
rechten Flügel findet sich die h. Barbara mit dem Hostienkelche gemalt. Zwischen
dem spätgothischen Holzwerke, welches den Schrein bekrönt, wird der Orucihxus
seinen Blatz gehabt haben. Der Stil der Malereien und der Sculpturen ist sich
ähnlich und von einem eigenthümlichen Charakter. Auf den Gemälden bemerkt
man kleine Köpfe mit kurzer Stirn, die Augenbrauen sind überall hoch gezogen,
der Ausdruck ist durchaus geistiger Natur. Die geschnitzten Figuren haben auch
eigenthümlich gebildete Augen und ein kleines Kinn; ist der Typus wendisch?
Die Glocke dieser Kirche hat 0,72 in Durchmesser, trägt verschiedene Namen
als Aufschrift und Folgendes:
MICH GOSS - E - SENCKE IN WITTENBERG DVRCH GOTTES
SEGEN 1852.
Schrenz.
Kirchdorf, Filial von Stumsdorf, mit einem Rittergute, 5,5 km südwestlich
von Zörbig gelegen, hat vielleicht eine wendische Anlage der Gehöfte. Die Kirche
liegt südwestlich im Dorfe und ist im Schiffe und Thurme, welch letzterer freilich
im Innern stärkere Mauern zeigt und eine Glockenstube von Fachwerk hat, von
gleicher Breite. Der Schluss im Osten geschieht durch fünf Seiten eines Zehn-
ecks. Man kann, da alles Mauerwerk über-
putzt ist, nicht erkennen, ob, wie zu ver-
mutlien steht, der östliche Theil dem 15.
Jahrhundert angehört. Der westliche Theil
ward romanisch sein, weil sich über der
Eingangsthür an der Nordseite ein halbrunder,
jedoch zierrathloser Sturz befindet. Die Decke
des Schiffes, welche in der Weise ausgebildet
ist, wie Fig. 29. darstellt, also verzierte
Balken mit Holzgefachen zeigt, und die Emporengehören wohl dem 17. Jahrhundert
an. Ein Sacramentsschrein befindet sich in der Nordwand. Der Taufstein ist eine
spätgothische, nicht unschöne Arbeit. Unter dem etwas vorspringenden Rande des
Gefässes, welches vieleckig ist, gehen auf jeder Ecke Rundstäbe bis auf den Schaft
hinab. Sie durchschneiden sich an den Ecken und werden auch von einen rings-
umlaufenden Stabe gekreuzt. Die Felder zwischen ihnen vertiefen sich etwas.
Die Hälfte der Stäbe setzt sich am Schafte vor und hat eigene kristallinisch aus-
gebildete Füsse, zwischen denen concave Schrägen in die Ecken einer vierseitigen
Platte überleiten, welche auf dem Fusse des Steines steht. Dieser Fuss ist
quadratisch und durch Kehlen sowie durch einen Rundstab mit Eckdurchdringung
profilirt. Der hölzerne Altaraufbau hat Marmorzuthaten, inmitten das Relief der
Anheftung Christi an das Kreuz durch drei Kriegsknechte. Man sieht auch schon
Kreis Bitterfeid.
Auf dem linken Flügel sehen wir ein Gemälde, welches eine Heilige darstellt, die
ein Schwert in der Linken hält und mit der Rechten die Schwertspitze fasst.
Vielleicht ist es die h. Oatharina. Im Schreine befinden sich diese Holzsculpturen:
die h. Magdalena (?) mit der Salbbüchse als Nonne gekleidet, Maria mit dem Finde
und der h. Petrus (?) mit einem Buche, jedoch jetzt ohne Schlüssel. Auf dem
rechten Flügel findet sich die h. Barbara mit dem Hostienkelche gemalt. Zwischen
dem spätgothischen Holzwerke, welches den Schrein bekrönt, wird der Orucihxus
seinen Blatz gehabt haben. Der Stil der Malereien und der Sculpturen ist sich
ähnlich und von einem eigenthümlichen Charakter. Auf den Gemälden bemerkt
man kleine Köpfe mit kurzer Stirn, die Augenbrauen sind überall hoch gezogen,
der Ausdruck ist durchaus geistiger Natur. Die geschnitzten Figuren haben auch
eigenthümlich gebildete Augen und ein kleines Kinn; ist der Typus wendisch?
Die Glocke dieser Kirche hat 0,72 in Durchmesser, trägt verschiedene Namen
als Aufschrift und Folgendes:
MICH GOSS - E - SENCKE IN WITTENBERG DVRCH GOTTES
SEGEN 1852.
Schrenz.
Kirchdorf, Filial von Stumsdorf, mit einem Rittergute, 5,5 km südwestlich
von Zörbig gelegen, hat vielleicht eine wendische Anlage der Gehöfte. Die Kirche
liegt südwestlich im Dorfe und ist im Schiffe und Thurme, welch letzterer freilich
im Innern stärkere Mauern zeigt und eine Glockenstube von Fachwerk hat, von
gleicher Breite. Der Schluss im Osten geschieht durch fünf Seiten eines Zehn-
ecks. Man kann, da alles Mauerwerk über-
putzt ist, nicht erkennen, ob, wie zu ver-
mutlien steht, der östliche Theil dem 15.
Jahrhundert angehört. Der westliche Theil
ward romanisch sein, weil sich über der
Eingangsthür an der Nordseite ein halbrunder,
jedoch zierrathloser Sturz befindet. Die Decke
des Schiffes, welche in der Weise ausgebildet
ist, wie Fig. 29. darstellt, also verzierte
Balken mit Holzgefachen zeigt, und die Emporengehören wohl dem 17. Jahrhundert
an. Ein Sacramentsschrein befindet sich in der Nordwand. Der Taufstein ist eine
spätgothische, nicht unschöne Arbeit. Unter dem etwas vorspringenden Rande des
Gefässes, welches vieleckig ist, gehen auf jeder Ecke Rundstäbe bis auf den Schaft
hinab. Sie durchschneiden sich an den Ecken und werden auch von einen rings-
umlaufenden Stabe gekreuzt. Die Felder zwischen ihnen vertiefen sich etwas.
Die Hälfte der Stäbe setzt sich am Schafte vor und hat eigene kristallinisch aus-
gebildete Füsse, zwischen denen concave Schrägen in die Ecken einer vierseitigen
Platte überleiten, welche auf dem Fusse des Steines steht. Dieser Fuss ist
quadratisch und durch Kehlen sowie durch einen Rundstab mit Eckdurchdringung
profilirt. Der hölzerne Altaraufbau hat Marmorzuthaten, inmitten das Relief der
Anheftung Christi an das Kreuz durch drei Kriegsknechte. Man sieht auch schon