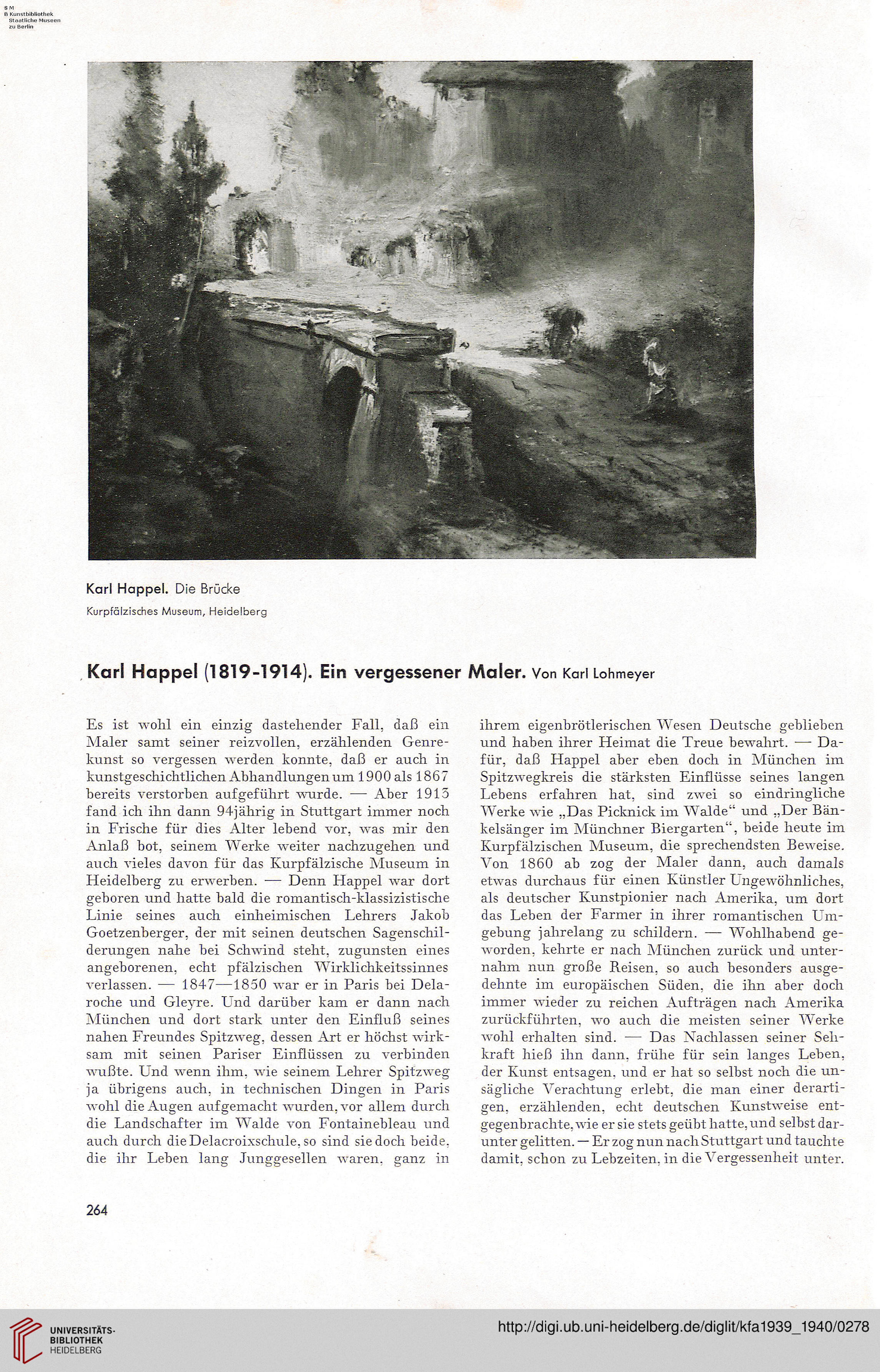Karl Happel. Die Brücke
Kurpfälzisches Museum, Heidelberg
Karl Happel (1819-1914). Ein vergessener Maler. Von Karl Lohmeyer
Es ist wohl ein einzig dastehender Fall, daß ein
Maler samt seiner reizvollen, erzählenden Genre-
kunst so vergessen werden konnte, daß er auch in
kunstgeschichtlichen Abhandlungen um 1900 als 1867
bereits verstorben aufgeführt wurde. — Aber 1915
fand ich ihn dann 94j ährig in Stuttgart immer noch
in Frische für dies Alter lebend vor, was mir den
Anlaß bot, seinem Werke weiter nachzugehen und
auch vieles davon für das Kurpfälzische Museum in
Heidelberg zu erwerben. — Denn Happel war dort
geboren und hatte bald die romantisch-klassizistische
Linie seines auch einheimischen Lehrers Jakob
Goetzenberger, der mit seinen deutschen Sagenschil-
derungen nahe bei Schwind steht, zugunsten eines
angeborenen, echt pfälzischen Wirklichkeitssinnes
verlassen. — 1847—1850 war er in Paris bei Dela-
roche und Gleyre. Und darüber kam er dann nach
München und dort stark unter den Einfluß seines
nahen Freundes Spitzweg, dessen Art er höchst wirk-
sam mit seinen Pariser Einflüssen zu verbinden
wußte. Und wenn ihm, wie seinem Lehrer Spitzweg
ja übrigens auch, in technischen Dingen in Paris
wohl die Augen aufgemacht wurden, vor allem durch
die Landschafter im Walde von Fontainebleau und
auch durch die Delacroixschule, so sind sie doch beide,
die ihr Leben lang Junggesellen waren, ganz in
ihrem eigenbrötlerischen Wesen Deutsche geblieben
und haben ihrer Heimat die Treue bewahrt. — Da-
für, daß Happel aber eben doch in München im
Spitzwegkreis die stärksten Einflüsse seines langen
Lebens erfahren hat, sind zwei so eindringliche
Werke wie „Das Picknick im Walde" und „Der Bän-
kelsänger im Münchner Biergarten", beide heute im
Kurpfälzischen Museum, die sprechendsten Beweise.
Von 1860 ab zog der Maler dann, auch damals
etwas durchaus für einen Künstler Ungewöhnliches,
als deutscher Kunstpionier nach Amerika, um dort
das Leben der Farmer in ihrer romantischen Um-
gebung jahrelang zu schildern. — Wohlhabend ge-
worden, kehrte er nach München zurück und unter-
nahm nun große Reisen, so auch besonders ausge-
dehnte im europäischen Süden, die ihn aber doch
immer wieder zu reichen Aufträgen nach Amerika
zurückführten, wo auch die meisten seiner Werke
wohl erhalten sind. — Das Nachlassen seiner Seh-
kraft hieß ihn dann, frühe für sein langes Leben,
der Kunst entsagen, und er hat so selbst noch die un-
sägliche Verachtung erlebt, die man einer derarti-
gen, erzählenden, echt deutschen Kunstweise ent-
gegenbrachte, wie er sie stets geübt hatte, und selbst dar-
unter gelitten. — Er zog nun nach Stuttgart und tauchte
damit, schon zu Lebzeiten, in die Vergessenheit unter.
264
Kurpfälzisches Museum, Heidelberg
Karl Happel (1819-1914). Ein vergessener Maler. Von Karl Lohmeyer
Es ist wohl ein einzig dastehender Fall, daß ein
Maler samt seiner reizvollen, erzählenden Genre-
kunst so vergessen werden konnte, daß er auch in
kunstgeschichtlichen Abhandlungen um 1900 als 1867
bereits verstorben aufgeführt wurde. — Aber 1915
fand ich ihn dann 94j ährig in Stuttgart immer noch
in Frische für dies Alter lebend vor, was mir den
Anlaß bot, seinem Werke weiter nachzugehen und
auch vieles davon für das Kurpfälzische Museum in
Heidelberg zu erwerben. — Denn Happel war dort
geboren und hatte bald die romantisch-klassizistische
Linie seines auch einheimischen Lehrers Jakob
Goetzenberger, der mit seinen deutschen Sagenschil-
derungen nahe bei Schwind steht, zugunsten eines
angeborenen, echt pfälzischen Wirklichkeitssinnes
verlassen. — 1847—1850 war er in Paris bei Dela-
roche und Gleyre. Und darüber kam er dann nach
München und dort stark unter den Einfluß seines
nahen Freundes Spitzweg, dessen Art er höchst wirk-
sam mit seinen Pariser Einflüssen zu verbinden
wußte. Und wenn ihm, wie seinem Lehrer Spitzweg
ja übrigens auch, in technischen Dingen in Paris
wohl die Augen aufgemacht wurden, vor allem durch
die Landschafter im Walde von Fontainebleau und
auch durch die Delacroixschule, so sind sie doch beide,
die ihr Leben lang Junggesellen waren, ganz in
ihrem eigenbrötlerischen Wesen Deutsche geblieben
und haben ihrer Heimat die Treue bewahrt. — Da-
für, daß Happel aber eben doch in München im
Spitzwegkreis die stärksten Einflüsse seines langen
Lebens erfahren hat, sind zwei so eindringliche
Werke wie „Das Picknick im Walde" und „Der Bän-
kelsänger im Münchner Biergarten", beide heute im
Kurpfälzischen Museum, die sprechendsten Beweise.
Von 1860 ab zog der Maler dann, auch damals
etwas durchaus für einen Künstler Ungewöhnliches,
als deutscher Kunstpionier nach Amerika, um dort
das Leben der Farmer in ihrer romantischen Um-
gebung jahrelang zu schildern. — Wohlhabend ge-
worden, kehrte er nach München zurück und unter-
nahm nun große Reisen, so auch besonders ausge-
dehnte im europäischen Süden, die ihn aber doch
immer wieder zu reichen Aufträgen nach Amerika
zurückführten, wo auch die meisten seiner Werke
wohl erhalten sind. — Das Nachlassen seiner Seh-
kraft hieß ihn dann, frühe für sein langes Leben,
der Kunst entsagen, und er hat so selbst noch die un-
sägliche Verachtung erlebt, die man einer derarti-
gen, erzählenden, echt deutschen Kunstweise ent-
gegenbrachte, wie er sie stets geübt hatte, und selbst dar-
unter gelitten. — Er zog nun nach Stuttgart und tauchte
damit, schon zu Lebzeiten, in die Vergessenheit unter.
264