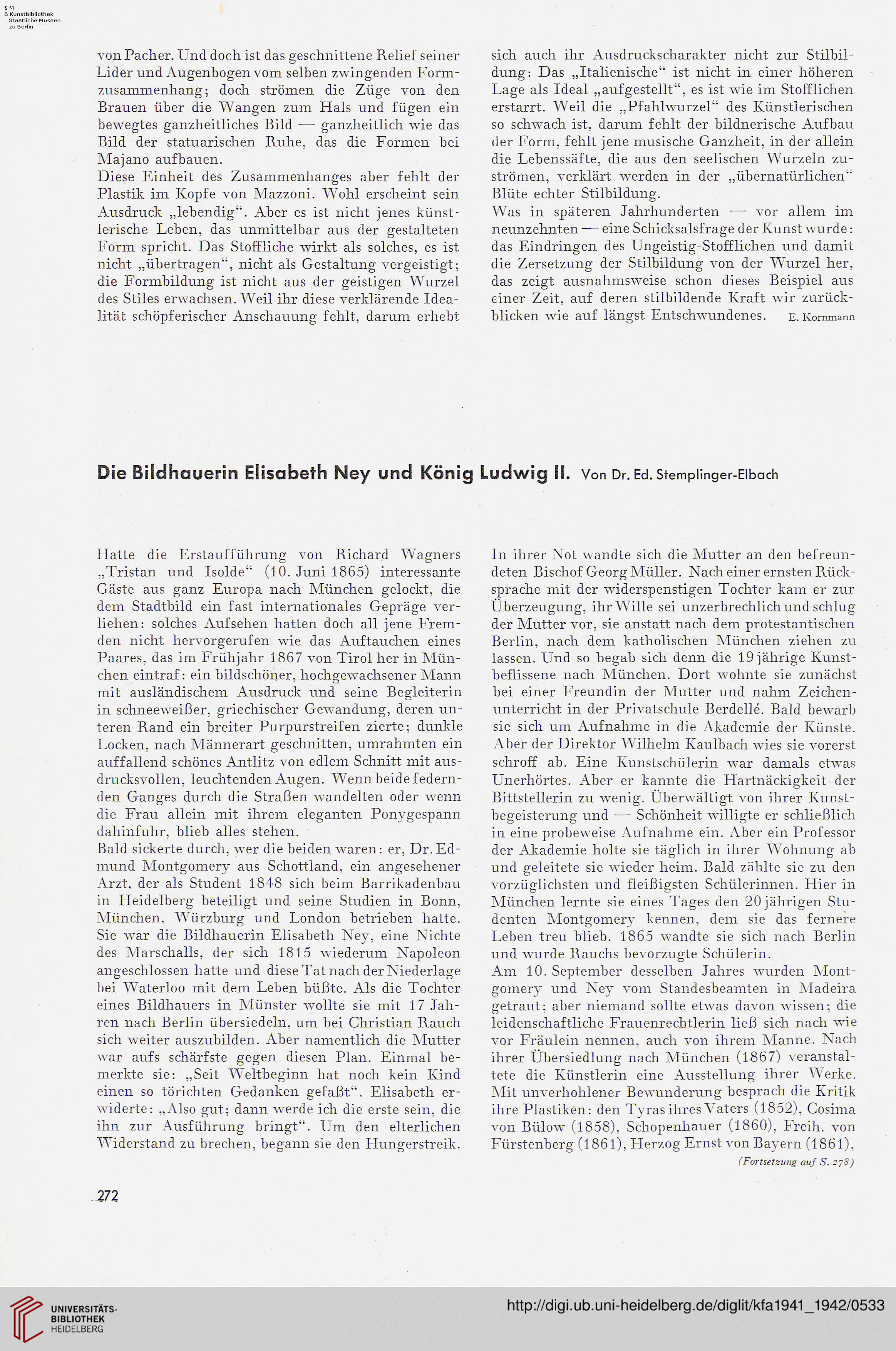vonPacher. L nd doch ist das geschnittene Relief seiner
Lider und Augenbogenvom selben zwingenden Form-
7.usammenhang; doch strömen die Züge von den
Brauen über die Wangen zum Hals und fügen ein
bewegtes ganzheitliches Bild — ganzheitlich wie das
Bild der statuarischen Ruhe, das die Formen bei
Majano aufbauen.
Diese Einheit des Zusammenhanges aber fehlt der
Plastik im Kopfe von Mazzoni. Wohl erscheint sein
Ausdruck „lebendig". Aber es ist nicht jenes künst-
lerische Leben, das unmittelbar aus der gestalteten
Form spricht. Das Stoffliche wirkt als solches, es ist
nicht „übertragen", nicht als Gestaltung vergeistigt;
die Formbildung ist nicht aus der geistigen Wurzel
des Stiles erwachsen. Weil ihr diese verklärende Idea-
lität schöpferischer Anschauung fehlt, darum erhebt
sich auch ihr Ausdruckscharakter nicht zur Stilbil-
dung: Das „Italienische" ist nicht in einer höheren
Lage als Ideal „aufgestellt", es ist wie im Stofflichen
erstarrt. Weil die „Pfahlwurzel" des Künstlerischen
so schwach ist. darum fehlt der bildnerische Aufbau
der Form, fehlt jene musische Ganzheit, in der allein
die Lebenssäfte, die aus den seelischen Wurzeln zu-
strömen, verklärt werden in der „übernatürlichen"
Blüte echter Stilbildung.
Was in späteren Jahrhunderten — vor allem im
neunzehnten — eine Schicksalsfrage der Kunst wurde:
das Eindringen des Ungeistig-Stofflichen und damit
die Zersetzung der Stilbildung von der Wurzel her,
das zeigt ausnahmsweise schon dieses Beispiel aus
einer Zeit, auf deren stilbildende Kraft wir zurück-
blicken wie auf längst Entschwundenes. e. Kornmann
Die Bildhauerin Elisabeth Ney und König Ludwig II. Von Dr. Ed. stemplinger-Eibach
Hatte die Erstaufführung von Richard Wagners
„Tristan und Isolde" (10. Juni 1865) interessante
Gäste aus ganz Europa nach München gelockt, die
dem Stadtbild ein fast internationales Gepräge ver-
liehen: solches Aufsehen hatten doch all jene Frem-
den nicht hervorgerufen wie das Auftauchen eines
Paares, das im Frühjahr 1867 von Tirol her in Mün-
chen eintraf: ein bildschöner, hochgewachsener Mann
mit ausländischem Ausdruck und seine Begleiterin
in schneeweißer, griechischer Gewandung, deren un-
teren Rand ein breiter Purpurstreifen zierte: dunkle
Locken, nach Männerart geschnitten, umrahmten ein
auffallend schönes Antlitz von edlem Schnitt mit aus-
drucksvollen, leuchtenden Augen. Wenn beide federn-
den Ganges durch die Straßen wandelten oder wenn
die Frau allein mit ihrem eleganten Ponvgespann
dahinfuhr, blieb alles stehen.
Bald sickerte durch, wer die beiden waren: er, Dr. Ed-
mund Montgomery aus Schottland, ein angesehener
Arzt, der als Student 1848 sich beim Barrikadenbau
in Heidelberg beteiligt und seine Studien in Bonn,
München. Würzburg und London betrieben hatte.
Sie war die Bildhauerin Elisabeth Ney, eine Nichte
des Marschalls, der sich 1815 wiederum Napoleon
angeschlossen hatte und diese Tat nach der Niederlage
bei Waterloo mit dem Leben büßte. Als die Tochter
eines Bildhauers in Münster wollte sie mit 17 Jah-
ren nach Berlin übersiedeln, um bei Christian Rauch
sich weiter auszubilden. Aber namentlich die Mutter
war aufs schärfste gegen diesen Plan. Einmal be-
merkte sie: „Seit Weltbeginn hat noch kein Kind
einen so törichten Gedanken gefaßt". Elisabeth er-
widerte: „Also gut: dann werde ich die erste sein, die
ihn zur Ausführung bringt". Um den elterlichen
Widerstand zu brechen, begann sie den Hungerstreik.
In ihrer Not wandte sich die Mutter an den befreun-
deten Bischof Georg Müller. Nach einer ernsten Rück-
sprache mit der widerspenstigen Tochter kam er zur
Überzeugung, ihr Wille sei unzerbrechlich und schlug
der Mutter vor, sie anstatt nach dem protestantischen
Berlin, nach dem katholischen München ziehen zu
lassen. Und so begab sich denn die 19 jährige Kunst-
beflissene nach München. Dort wohnte sie zunächst
bei einer Freundin der Mutter und nahm Zeichen-
unterricht in der Privatschule Berdelle. Bald bewarb
sie sich um Aufnahme in die Akademie der Künste.
Aber der Direktor Wilhelm Kaulbach wies sie vorerst
schroff ab. Eine Kunstschülerin war damals etwas
Unerhörtes. Aber er kannte die Hartnäckigkeit der
Bittstellerin zu wenig. Überwältigt von ihrer Kunst-
begeisterung und — Schönheit willigte er schließlich
in eine probeweise Aufnahme ein. Aber ein Professor
der Akademie holte sie täglich in ihrer Wohnung ab
und geleitete sie wieder heim. Bald zählte sie zu den
vorzüglichsten und fleißigsten Schülerinnen. Hier in
München lernte sie eines Tages den 20 jährigen Stu-
denten Montgomerv kennen, dem sie das fernere
Leben treu blieb. 1865 wandte sie sich nach Berlin
und wurde Rauchs bevorzugte Schülerin.
Am 10. September desselben Jahres wurden Mont-
gomery und Ney vom Standesbeamten in Madeira
getraut; aber niemand sollte etwas davon wissen; die
leidenschaftliche Frauenrechtlerin ließ sich nach wie
vor Fräulein nennen, auch von ihrem Manne. Nach
ihrer Übersiedlung nach München (1867) veranstal-
tete die Künstlerin eine Ausstellung ihrer Werke.
Mit unverhohlener Bewunderung besprach die Kritik
ihre Plastiken: den Tyras ihres Vaters (1852), Cosima
von Bülow (1858), Schopenhauer (1860), Freih. von
Fürstenberg (1861), Herzog Ernst von Bayern (1861).
(Fortsetzung auf S. 278)
272
Lider und Augenbogenvom selben zwingenden Form-
7.usammenhang; doch strömen die Züge von den
Brauen über die Wangen zum Hals und fügen ein
bewegtes ganzheitliches Bild — ganzheitlich wie das
Bild der statuarischen Ruhe, das die Formen bei
Majano aufbauen.
Diese Einheit des Zusammenhanges aber fehlt der
Plastik im Kopfe von Mazzoni. Wohl erscheint sein
Ausdruck „lebendig". Aber es ist nicht jenes künst-
lerische Leben, das unmittelbar aus der gestalteten
Form spricht. Das Stoffliche wirkt als solches, es ist
nicht „übertragen", nicht als Gestaltung vergeistigt;
die Formbildung ist nicht aus der geistigen Wurzel
des Stiles erwachsen. Weil ihr diese verklärende Idea-
lität schöpferischer Anschauung fehlt, darum erhebt
sich auch ihr Ausdruckscharakter nicht zur Stilbil-
dung: Das „Italienische" ist nicht in einer höheren
Lage als Ideal „aufgestellt", es ist wie im Stofflichen
erstarrt. Weil die „Pfahlwurzel" des Künstlerischen
so schwach ist. darum fehlt der bildnerische Aufbau
der Form, fehlt jene musische Ganzheit, in der allein
die Lebenssäfte, die aus den seelischen Wurzeln zu-
strömen, verklärt werden in der „übernatürlichen"
Blüte echter Stilbildung.
Was in späteren Jahrhunderten — vor allem im
neunzehnten — eine Schicksalsfrage der Kunst wurde:
das Eindringen des Ungeistig-Stofflichen und damit
die Zersetzung der Stilbildung von der Wurzel her,
das zeigt ausnahmsweise schon dieses Beispiel aus
einer Zeit, auf deren stilbildende Kraft wir zurück-
blicken wie auf längst Entschwundenes. e. Kornmann
Die Bildhauerin Elisabeth Ney und König Ludwig II. Von Dr. Ed. stemplinger-Eibach
Hatte die Erstaufführung von Richard Wagners
„Tristan und Isolde" (10. Juni 1865) interessante
Gäste aus ganz Europa nach München gelockt, die
dem Stadtbild ein fast internationales Gepräge ver-
liehen: solches Aufsehen hatten doch all jene Frem-
den nicht hervorgerufen wie das Auftauchen eines
Paares, das im Frühjahr 1867 von Tirol her in Mün-
chen eintraf: ein bildschöner, hochgewachsener Mann
mit ausländischem Ausdruck und seine Begleiterin
in schneeweißer, griechischer Gewandung, deren un-
teren Rand ein breiter Purpurstreifen zierte: dunkle
Locken, nach Männerart geschnitten, umrahmten ein
auffallend schönes Antlitz von edlem Schnitt mit aus-
drucksvollen, leuchtenden Augen. Wenn beide federn-
den Ganges durch die Straßen wandelten oder wenn
die Frau allein mit ihrem eleganten Ponvgespann
dahinfuhr, blieb alles stehen.
Bald sickerte durch, wer die beiden waren: er, Dr. Ed-
mund Montgomery aus Schottland, ein angesehener
Arzt, der als Student 1848 sich beim Barrikadenbau
in Heidelberg beteiligt und seine Studien in Bonn,
München. Würzburg und London betrieben hatte.
Sie war die Bildhauerin Elisabeth Ney, eine Nichte
des Marschalls, der sich 1815 wiederum Napoleon
angeschlossen hatte und diese Tat nach der Niederlage
bei Waterloo mit dem Leben büßte. Als die Tochter
eines Bildhauers in Münster wollte sie mit 17 Jah-
ren nach Berlin übersiedeln, um bei Christian Rauch
sich weiter auszubilden. Aber namentlich die Mutter
war aufs schärfste gegen diesen Plan. Einmal be-
merkte sie: „Seit Weltbeginn hat noch kein Kind
einen so törichten Gedanken gefaßt". Elisabeth er-
widerte: „Also gut: dann werde ich die erste sein, die
ihn zur Ausführung bringt". Um den elterlichen
Widerstand zu brechen, begann sie den Hungerstreik.
In ihrer Not wandte sich die Mutter an den befreun-
deten Bischof Georg Müller. Nach einer ernsten Rück-
sprache mit der widerspenstigen Tochter kam er zur
Überzeugung, ihr Wille sei unzerbrechlich und schlug
der Mutter vor, sie anstatt nach dem protestantischen
Berlin, nach dem katholischen München ziehen zu
lassen. Und so begab sich denn die 19 jährige Kunst-
beflissene nach München. Dort wohnte sie zunächst
bei einer Freundin der Mutter und nahm Zeichen-
unterricht in der Privatschule Berdelle. Bald bewarb
sie sich um Aufnahme in die Akademie der Künste.
Aber der Direktor Wilhelm Kaulbach wies sie vorerst
schroff ab. Eine Kunstschülerin war damals etwas
Unerhörtes. Aber er kannte die Hartnäckigkeit der
Bittstellerin zu wenig. Überwältigt von ihrer Kunst-
begeisterung und — Schönheit willigte er schließlich
in eine probeweise Aufnahme ein. Aber ein Professor
der Akademie holte sie täglich in ihrer Wohnung ab
und geleitete sie wieder heim. Bald zählte sie zu den
vorzüglichsten und fleißigsten Schülerinnen. Hier in
München lernte sie eines Tages den 20 jährigen Stu-
denten Montgomerv kennen, dem sie das fernere
Leben treu blieb. 1865 wandte sie sich nach Berlin
und wurde Rauchs bevorzugte Schülerin.
Am 10. September desselben Jahres wurden Mont-
gomery und Ney vom Standesbeamten in Madeira
getraut; aber niemand sollte etwas davon wissen; die
leidenschaftliche Frauenrechtlerin ließ sich nach wie
vor Fräulein nennen, auch von ihrem Manne. Nach
ihrer Übersiedlung nach München (1867) veranstal-
tete die Künstlerin eine Ausstellung ihrer Werke.
Mit unverhohlener Bewunderung besprach die Kritik
ihre Plastiken: den Tyras ihres Vaters (1852), Cosima
von Bülow (1858), Schopenhauer (1860), Freih. von
Fürstenberg (1861), Herzog Ernst von Bayern (1861).
(Fortsetzung auf S. 278)
272