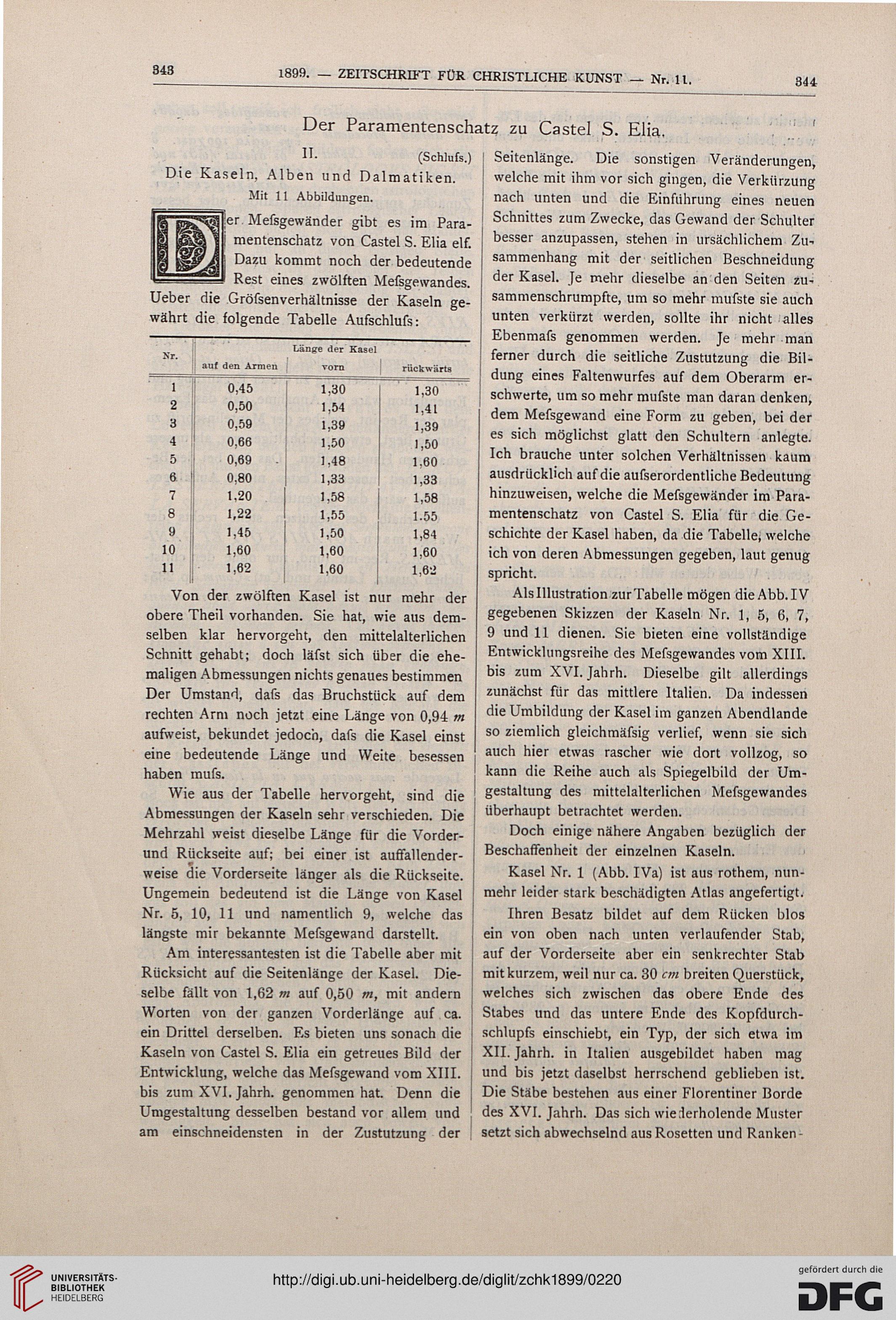843
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
844
Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia,
II. (Schlufs.)
Die Kasein, Alben und Dalmatiken.
Mit 11 Abbildungen.
'er Mefsgewänder gibt es im Para-
mentenschatz von Castel S. Elia elf.
Dazu kommt noch der bedeutende
Rest eines zwölften Mefsgewandes.
Ueber die Gröfsenverhältnisse der Kasein ge-
währt die folgende Tabelle Aufschlufs:
Länge der Kasel
auf den Armen
vorn
rückwärts
1
0,45
1,30
1,30
2
0,50
1,54
1,41
3
0,59
1,39
1,39
4
0,66
1,50
1,50
5
0,69
1,48
1,60
6
0,80
1,33
1,33
7
1,20
1,58
1,58
8
1,22
1,55
1.55
9
1,45
1,50
1,84
10
1,60
1,60
1,60
11
1,62
1,60
1,62
Von der zwölften Kasel ist nur mehr der
obere Theil vorhanden. Sie hat, wie aus dem-
selben klar hervorgeht, den mittelalterlichen
Schnitt gehabt; doch läfst sich über die ehe-
maligen Abmessungen nichts genaues bestimmen
Der Umstand, dafs das Bruchstück auf dem
rechten Arm noch jetzt eine Länge von 0,94 m
aufweist, bekundet jedoch, dafs die Kasel einst
eine bedeutende Länge und Weite besessen
haben mufs.
Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die
Abmessungen der Kasein sehr verschieden. Die
Mehrzahl weist dieselbe Länge für die Vorder-
und Rückseite auf; bei einer ist auffallender-
weise die Vorderseite länger als die Rückseite.
Ungemein bedeutend ist die Länge von Kasel
Nr. 5, 10, 11 und namentlich 9, welche das
längste mir bekannte Mefsgewand darstellt.
Am interessantesten ist die Tabelle aber mit
Rücksicht auf die Seitenlänge der Kasel. Die-
selbe fällt von 1,62 m auf 0,50 m, mit andern
Worten von der ganzen Vorderlänge auf ca.
ein Drittel derselben. Es bieten uns sonach die
Kasein von Castel S. Elia ein getreues Bild der
Entwicklung, welche das Mefsgewand vom XIII.
bis zum XVI. Jahrh. genommen hat. Denn die
Umgestaltung desselben bestand vor allem und
am einschneidensten in der Zustutzung der
Seitenlänge. Die sonstigen Veränderungen,
welche mit ihm vor sich gingen, die Verkürzung
nach unten und die Einführung eines neuen
Schnittes zum Zwecke, das Gewand der Schulter
besser anzupassen, stehen in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der seitlichen Beschneidung
der Kasel. Je mehr dieselbe an den Seiten zu-
sammenschrumpfte, um so mehr mufste sie auch
unten verkürzt werden, sollte ihr nicht alles
Ebenmafs genommen werden. Je mehr man
ferner durch die seitliche Zustutzung die Bil-
dung eines Faltenwurfes auf dem Oberarm er-
schwerte, um so mehr mufste man daran denken,
dem Mefsgewand eine Form zu geben, bei der
es sich möglichst glatt den Schultern anlegte.
Ich brauche unter solchen Verhältnissen kaum
ausdrücklich auf die aufserordentliche Bedeutung
hinzuweisen, welche die Mefsgewänder im Para-
mentenschatz von Castel S. Elia für die Ge-
schichte der Kasel haben, da die Tabelle; welche
ich von deren Abmessungen gegeben, laut genug
spricht.
Als Illustration zur Tabelle mögen die Abb. IV
gegebenen Skizzen der Kasein Nr. 1, 5, 6, 7,
9 und 11 dienen. Sie bieten eine vollständige
Entwicklungsreihe des Mefsgewandes vom XIII.
bis zum XVI. Jahrh. Dieselbe gilt allerdings
zunächst für das mittlere Italien. Da indessen
die Umbildung der Kasel im ganzen Abendlande
so ziemlich gleichmäfsig verlief, wenn sie sich
auch hier etwas rascher wie dort vollzog, so
kann die Reihe auch als Spiegelbild der Um-
gestaltung des mittelalterlichen Mefsgewandes
überhaupt betrachtet werden.
Doch einige nähere Angaben bezüglich der
Beschaffenheit der einzelnen Kasein.
Kasel Nr. 1 (Abb. IVa) ist aus rothem, nun-
mehr leider stark beschädigten Atlas angefertigt.
Ihren Besatz bildet auf dem Rücken blos
ein von oben nach unten verlaufender Stab,
auf der Vorderseite aber ein senkrechter Stab
mit kurzem, weil nur ca. 30 cm breiten Querstück,
welches sich zwischen das obere Ende des
Stabes und das untere Ende des Kopfdurch-
schlupfs einschiebt, ein Typ, der sich etwa im
XII. Jahrh. in Italien ausgebildet haben mag
und bis jetzt daselbst herrschend geblieben ist.
Die Stäbe bestehen aus einer Florentiner Borde
des XVI. Jahrh. Das sich wiederholende Muster
setzt sich abwechselnd aus Rosetten und Ranken -
1899.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 11.
844
Der Paramentenschatz zu Castel S. Elia,
II. (Schlufs.)
Die Kasein, Alben und Dalmatiken.
Mit 11 Abbildungen.
'er Mefsgewänder gibt es im Para-
mentenschatz von Castel S. Elia elf.
Dazu kommt noch der bedeutende
Rest eines zwölften Mefsgewandes.
Ueber die Gröfsenverhältnisse der Kasein ge-
währt die folgende Tabelle Aufschlufs:
Länge der Kasel
auf den Armen
vorn
rückwärts
1
0,45
1,30
1,30
2
0,50
1,54
1,41
3
0,59
1,39
1,39
4
0,66
1,50
1,50
5
0,69
1,48
1,60
6
0,80
1,33
1,33
7
1,20
1,58
1,58
8
1,22
1,55
1.55
9
1,45
1,50
1,84
10
1,60
1,60
1,60
11
1,62
1,60
1,62
Von der zwölften Kasel ist nur mehr der
obere Theil vorhanden. Sie hat, wie aus dem-
selben klar hervorgeht, den mittelalterlichen
Schnitt gehabt; doch läfst sich über die ehe-
maligen Abmessungen nichts genaues bestimmen
Der Umstand, dafs das Bruchstück auf dem
rechten Arm noch jetzt eine Länge von 0,94 m
aufweist, bekundet jedoch, dafs die Kasel einst
eine bedeutende Länge und Weite besessen
haben mufs.
Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind die
Abmessungen der Kasein sehr verschieden. Die
Mehrzahl weist dieselbe Länge für die Vorder-
und Rückseite auf; bei einer ist auffallender-
weise die Vorderseite länger als die Rückseite.
Ungemein bedeutend ist die Länge von Kasel
Nr. 5, 10, 11 und namentlich 9, welche das
längste mir bekannte Mefsgewand darstellt.
Am interessantesten ist die Tabelle aber mit
Rücksicht auf die Seitenlänge der Kasel. Die-
selbe fällt von 1,62 m auf 0,50 m, mit andern
Worten von der ganzen Vorderlänge auf ca.
ein Drittel derselben. Es bieten uns sonach die
Kasein von Castel S. Elia ein getreues Bild der
Entwicklung, welche das Mefsgewand vom XIII.
bis zum XVI. Jahrh. genommen hat. Denn die
Umgestaltung desselben bestand vor allem und
am einschneidensten in der Zustutzung der
Seitenlänge. Die sonstigen Veränderungen,
welche mit ihm vor sich gingen, die Verkürzung
nach unten und die Einführung eines neuen
Schnittes zum Zwecke, das Gewand der Schulter
besser anzupassen, stehen in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der seitlichen Beschneidung
der Kasel. Je mehr dieselbe an den Seiten zu-
sammenschrumpfte, um so mehr mufste sie auch
unten verkürzt werden, sollte ihr nicht alles
Ebenmafs genommen werden. Je mehr man
ferner durch die seitliche Zustutzung die Bil-
dung eines Faltenwurfes auf dem Oberarm er-
schwerte, um so mehr mufste man daran denken,
dem Mefsgewand eine Form zu geben, bei der
es sich möglichst glatt den Schultern anlegte.
Ich brauche unter solchen Verhältnissen kaum
ausdrücklich auf die aufserordentliche Bedeutung
hinzuweisen, welche die Mefsgewänder im Para-
mentenschatz von Castel S. Elia für die Ge-
schichte der Kasel haben, da die Tabelle; welche
ich von deren Abmessungen gegeben, laut genug
spricht.
Als Illustration zur Tabelle mögen die Abb. IV
gegebenen Skizzen der Kasein Nr. 1, 5, 6, 7,
9 und 11 dienen. Sie bieten eine vollständige
Entwicklungsreihe des Mefsgewandes vom XIII.
bis zum XVI. Jahrh. Dieselbe gilt allerdings
zunächst für das mittlere Italien. Da indessen
die Umbildung der Kasel im ganzen Abendlande
so ziemlich gleichmäfsig verlief, wenn sie sich
auch hier etwas rascher wie dort vollzog, so
kann die Reihe auch als Spiegelbild der Um-
gestaltung des mittelalterlichen Mefsgewandes
überhaupt betrachtet werden.
Doch einige nähere Angaben bezüglich der
Beschaffenheit der einzelnen Kasein.
Kasel Nr. 1 (Abb. IVa) ist aus rothem, nun-
mehr leider stark beschädigten Atlas angefertigt.
Ihren Besatz bildet auf dem Rücken blos
ein von oben nach unten verlaufender Stab,
auf der Vorderseite aber ein senkrechter Stab
mit kurzem, weil nur ca. 30 cm breiten Querstück,
welches sich zwischen das obere Ende des
Stabes und das untere Ende des Kopfdurch-
schlupfs einschiebt, ein Typ, der sich etwa im
XII. Jahrh. in Italien ausgebildet haben mag
und bis jetzt daselbst herrschend geblieben ist.
Die Stäbe bestehen aus einer Florentiner Borde
des XVI. Jahrh. Das sich wiederholende Muster
setzt sich abwechselnd aus Rosetten und Ranken -