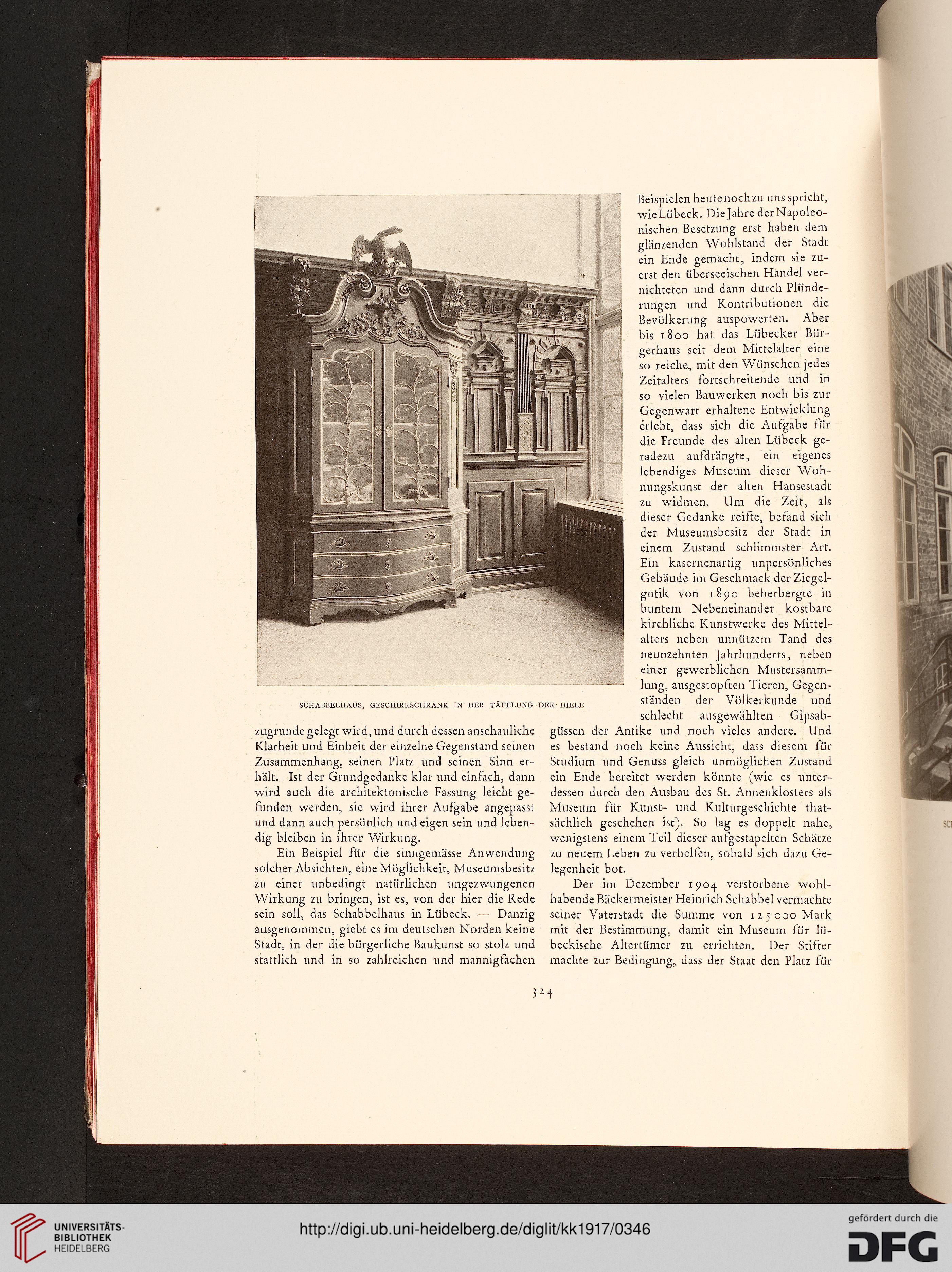SCHABBELHAUS, GESCHIRRSCHRANK IN DER TÄFELUNG -DER- DIELE
zugrunde gelegt wird, und durch dessen anschauliche
Klarheit und Einheit der einzelne Gegenstand seinen
Zusammenhang, seinen Platz und seinen Sinn er-
hält. Ist der Grundgedanke klar und einfach, dann
wird auch die architektonische Fassung leicht ge-
funden werden, sie wird ihrer Aufgabe angepasst
und dann auch persönlich und eigen sein und leben-
dig bleiben in ihrer Wirkung.
Ein Beispiel für die sinngemässe Anwendung
solcher Absichten, eine Möglichkeit, Museumsbesitz
zu einer unbedingt natürlichen ungezwungenen
Wirkung zu bringen, ist es, von der hier die Rede
sein soll, das Schabbeihaus in Lübeck. — Danzig
ausgenommen, giebt es im deutschen Norden keine
Stadt, in der die bürgerliche Baukunst so stolz und
stattlich und in so zahlreichen und mannigfachen
Beispielen heutenochzu uns spricht,
wieLübeck. Diejahre der Napoleo-
nischen Besetzung erst haben dem
glänzenden Wohlstand der Stadt
ein Ende gemacht, indem sie zu-
erst den überseeischen Handel ver-
nichteten und dann durch Plünde-
rungen und Kontributionen die
Bevölkerung auspowerten. Aber
bis 1800 hat das Lübecker Bür-
gerhaus seit dem Mittelalter eine
so reiche, mit den Wünschen jedes
Zeitalters fortschreitende und in
so vielen Bauwerken noch bis zur
Gegenwart erhaltene Entwicklung
erlebt, dass sich die Aufgabe für
die Freunde des alten Lübeck ge-
radezu aufdrängte, ein eigenes
lebendiges Museum dieser Woh-
nungskunst der alten Hansestadt
zu widmen. Um die Zeit, als
dieser Gedanke reifte, befand sich
der Museumsbesitz der Stadt in
einem Zustand schlimmster Art.
Ein kasernenartig unpersönliches
Gebäude im Geschmack der Ziegel-
gotik von 1890 beherbergte in
buntem Nebeneinander kostbare
kirchliche Kunstwerke des Mittel-
alters neben unnützem Tand des
neunzehnten Jahrhunderts, neben
einer gewerblichen Mustersamm-
lung, ausgestopften Tieren, Gegen-
ständen der Völkerkunde und
schlecht ausgewählten Gipsab-
güssen der Antike und noch vieles andere. Und
es bestand noch keine Aussicht, dass diesem für
Studium und Genuss gleich unmöglichen Zustand
ein Ende bereitet werden könnte (wie es unter-
dessen durch den Ausbau des St. Annenklosters als
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte that-
sächlich geschehen ist). So lag es doppelt nahe,
wenigstens einem Teil dieser aufgestapelten Schätze
zu neuem Leben zu verhelfen, sobald sich dazu Ge-
legenheit bot.
Der im Dezember 1904 verstorbene wohl-
habende Bäckermeister Heinrich Schabbel vermachte
seiner Vaterstadt die Summe von 125000 Mark
mit der Bestimmung, damit ein Museum für lü-
beckische Altertümer zu errichten. Der Stifter
machte zur Bedingung, dass der Staat den Platz für
lr>
50
3M
zugrunde gelegt wird, und durch dessen anschauliche
Klarheit und Einheit der einzelne Gegenstand seinen
Zusammenhang, seinen Platz und seinen Sinn er-
hält. Ist der Grundgedanke klar und einfach, dann
wird auch die architektonische Fassung leicht ge-
funden werden, sie wird ihrer Aufgabe angepasst
und dann auch persönlich und eigen sein und leben-
dig bleiben in ihrer Wirkung.
Ein Beispiel für die sinngemässe Anwendung
solcher Absichten, eine Möglichkeit, Museumsbesitz
zu einer unbedingt natürlichen ungezwungenen
Wirkung zu bringen, ist es, von der hier die Rede
sein soll, das Schabbeihaus in Lübeck. — Danzig
ausgenommen, giebt es im deutschen Norden keine
Stadt, in der die bürgerliche Baukunst so stolz und
stattlich und in so zahlreichen und mannigfachen
Beispielen heutenochzu uns spricht,
wieLübeck. Diejahre der Napoleo-
nischen Besetzung erst haben dem
glänzenden Wohlstand der Stadt
ein Ende gemacht, indem sie zu-
erst den überseeischen Handel ver-
nichteten und dann durch Plünde-
rungen und Kontributionen die
Bevölkerung auspowerten. Aber
bis 1800 hat das Lübecker Bür-
gerhaus seit dem Mittelalter eine
so reiche, mit den Wünschen jedes
Zeitalters fortschreitende und in
so vielen Bauwerken noch bis zur
Gegenwart erhaltene Entwicklung
erlebt, dass sich die Aufgabe für
die Freunde des alten Lübeck ge-
radezu aufdrängte, ein eigenes
lebendiges Museum dieser Woh-
nungskunst der alten Hansestadt
zu widmen. Um die Zeit, als
dieser Gedanke reifte, befand sich
der Museumsbesitz der Stadt in
einem Zustand schlimmster Art.
Ein kasernenartig unpersönliches
Gebäude im Geschmack der Ziegel-
gotik von 1890 beherbergte in
buntem Nebeneinander kostbare
kirchliche Kunstwerke des Mittel-
alters neben unnützem Tand des
neunzehnten Jahrhunderts, neben
einer gewerblichen Mustersamm-
lung, ausgestopften Tieren, Gegen-
ständen der Völkerkunde und
schlecht ausgewählten Gipsab-
güssen der Antike und noch vieles andere. Und
es bestand noch keine Aussicht, dass diesem für
Studium und Genuss gleich unmöglichen Zustand
ein Ende bereitet werden könnte (wie es unter-
dessen durch den Ausbau des St. Annenklosters als
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte that-
sächlich geschehen ist). So lag es doppelt nahe,
wenigstens einem Teil dieser aufgestapelten Schätze
zu neuem Leben zu verhelfen, sobald sich dazu Ge-
legenheit bot.
Der im Dezember 1904 verstorbene wohl-
habende Bäckermeister Heinrich Schabbel vermachte
seiner Vaterstadt die Summe von 125000 Mark
mit der Bestimmung, damit ein Museum für lü-
beckische Altertümer zu errichten. Der Stifter
machte zur Bedingung, dass der Staat den Platz für
lr>
50
3M