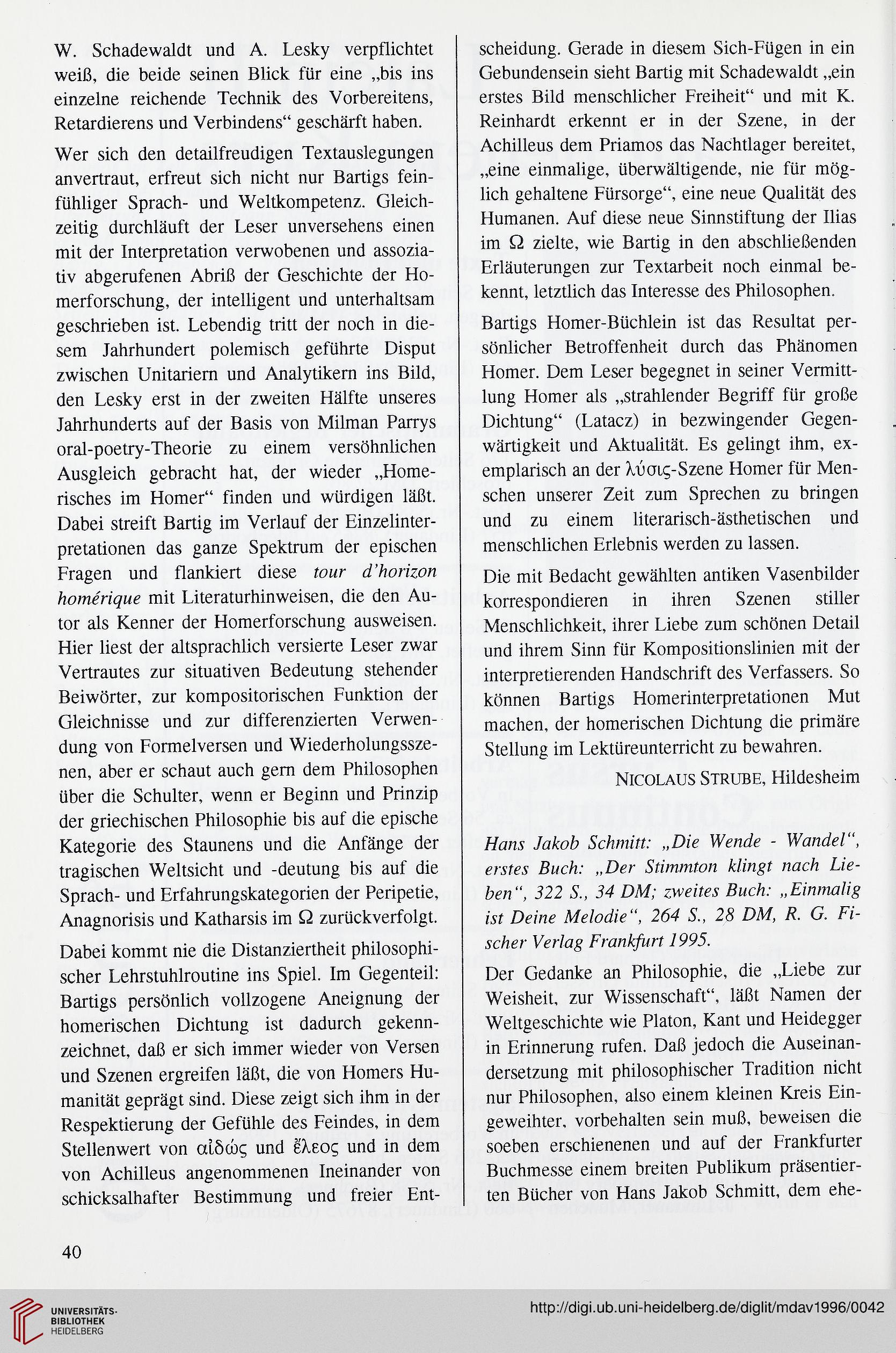W. Schadewaldt und A. Lesky verpflichtet
weiß, die beide seinen Blick für eine „bis ins
einzelne reichende Technik des Vorbereitens,
Retardierens und Verbindens" geschärft haben.
Wer sich den detailfreudigen Textauslegungen
anvertraut, erfreut sich nicht nur Bartigs fein-
fühliger Sprach- und Weltkompetenz. Gleich-
zeitig durchläuft der Leser unversehens einen
mit der Interpretation verwobenen und assozia-
tiv abgerufenen Abriß der Geschichte der Ho-
merforschung, der intelligent und unterhaltsam
geschrieben ist. Lebendig tritt der noch in die-
sem Jahrhundert polemisch geführte Disput
zwischen Unitariem und Analytikern ins Bild,
den Lesky erst in der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts auf der Basis von Milman Parrys
oral-poetry-Theorie zu einem versöhnlichen
Ausgleich gebracht hat, der wieder „Home-
risches im Homer" finden und würdigen läßt.
Dabei streift Bärtig im Verlauf der Einzelinter-
pretationen das ganze Spektrum der epischen
Fragen und flankiert diese foar <7'/?or;'zon
mit Literaturhinweisen, die den Au-
tor als Kenner der Homerforschung ausweisen.
Hier liest der altsprachlich versierte Leser zwar
Vertrautes zur situativen Bedeutung stehender
Beiwörter, zur kompositorischen Funktion der
Gleichnisse und zur differenzierten Verwen-
dung von Formelversen und Wiederholungssze-
nen, aber er schaut auch gern dem Philosophen
über die Schulter, wenn er Beginn und Prinzip
der griechischen Philosophie bis auf die epische
Kategorie des Staunens und die Anfänge der
tragischen Weitsicht und -deutung bis auf die
Sprach- und Erfahrungskategorien der Peripetie,
Anagnorisis und Katharsis im Q zurückverfolgt.
Dabei kommt nie die Distanziertheit philosophi-
scher Lehrstuhlroutine ins Spiel. Im Gegenteil:
Bartigs persönlich vollzogene Aneignung der
homerischen Dichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß er sich immer wieder von Versen
und Szenen ergreifen läßt, die von Homers Hu-
manität geprägt sind. Diese zeigt sich ihm in der
Respektierung der Gefühle des Feindes, in dem
Stellenwert von atSthg und eXeog und in dem
von Achilleus angenommenen Ineinander von
schicksalhafter Bestimmung und freier Ent-
scheidung. Gerade in diesem Sich-Fügen in ein
Gebundensein sieht Bärtig mit Schadewaldt „ein
erstes Bild menschlicher Freiheit" und mit K.
Reinhardt erkennt er in der Szene, in der
Achilleus dem Priamos das Nachtlager bereitet,
„eine einmalige, überwältigende, nie für mög-
lich gehaltene Fürsorge", eine neue Qualität des
Humanen. Auf diese neue Sinnstiftung der Ilias
im Q zielte, wie Bärtig in den abschließenden
Erläuterungen zur Textarbeit noch einmal be-
kennt. letztlich das Interesse des Philosophen.
Bartigs Homer-Büchlein ist das Resultat per-
sönlicher Betroffenheit durch das Phänomen
Homer. Dem Leser begegnet in seiner Vermitt-
lung Homer als „strahlender Begriff für große
Dichtung" (Latacz) in bezwingender Gegen-
wärtigkeit und Aktualität. Es gelingt ihm, ex-
emplarisch an der Xuotg-Szene Homer für Men-
schen unserer Zeit zum Sprechen zu bringen
und zu einem literarisch-ästhetischen und
menschlichen Erlebnis werden zu lassen.
Die mit Bedacht gewählten antiken Vasenbilder
korrespondieren in ihren Szenen stiller
Menschlichkeit, ihrer Liebe zum schönen Detail
und ihrem Sinn für Kompositionslinien mit der
interpretierenden Handschrift des Verfassers. So
können Bartigs Homerinterpretationen Mut
machen, der homerischen Dichtung die primäre
Stellung im Lektüreunterricht zu bewahren.
NICOLAUS STRUBE, Hildesheim
//a/A JaAoA Bc/unAf; „Die - JVanJc/",
Bnc/?.' „Der .Sn'wwfon A/ingt nacA D'e-
7va;", 622 &, 64 DM; zrveife^ Bac/?.* „Bmwa/ig
Ar Deine Meiociie", 264 6., 26 DM, B. G. Di-
,sei;er Vcr/ag BranA/nrr 7996.
Der Gedanke an Philosophie, die „Liebe zur
Weisheit, zur Wissenschaft", läßt Namen der
Weltgeschichte wie Platon, Kant und Heidegger
in Erinnerung rufen. Daß jedoch die Auseinan-
dersetzung mit philosophischer Tradition nicht
nur Philosophen, also einem kleinen Kreis Ein-
geweihter, Vorbehalten sein muß, beweisen die
soeben erschienenen und auf der Frankfurter
Buchmesse einem breiten Publikum präsentier-
ten Bücher von Hans Jakob Schmitt, dem ehe-
40
weiß, die beide seinen Blick für eine „bis ins
einzelne reichende Technik des Vorbereitens,
Retardierens und Verbindens" geschärft haben.
Wer sich den detailfreudigen Textauslegungen
anvertraut, erfreut sich nicht nur Bartigs fein-
fühliger Sprach- und Weltkompetenz. Gleich-
zeitig durchläuft der Leser unversehens einen
mit der Interpretation verwobenen und assozia-
tiv abgerufenen Abriß der Geschichte der Ho-
merforschung, der intelligent und unterhaltsam
geschrieben ist. Lebendig tritt der noch in die-
sem Jahrhundert polemisch geführte Disput
zwischen Unitariem und Analytikern ins Bild,
den Lesky erst in der zweiten Hälfte unseres
Jahrhunderts auf der Basis von Milman Parrys
oral-poetry-Theorie zu einem versöhnlichen
Ausgleich gebracht hat, der wieder „Home-
risches im Homer" finden und würdigen läßt.
Dabei streift Bärtig im Verlauf der Einzelinter-
pretationen das ganze Spektrum der epischen
Fragen und flankiert diese foar <7'/?or;'zon
mit Literaturhinweisen, die den Au-
tor als Kenner der Homerforschung ausweisen.
Hier liest der altsprachlich versierte Leser zwar
Vertrautes zur situativen Bedeutung stehender
Beiwörter, zur kompositorischen Funktion der
Gleichnisse und zur differenzierten Verwen-
dung von Formelversen und Wiederholungssze-
nen, aber er schaut auch gern dem Philosophen
über die Schulter, wenn er Beginn und Prinzip
der griechischen Philosophie bis auf die epische
Kategorie des Staunens und die Anfänge der
tragischen Weitsicht und -deutung bis auf die
Sprach- und Erfahrungskategorien der Peripetie,
Anagnorisis und Katharsis im Q zurückverfolgt.
Dabei kommt nie die Distanziertheit philosophi-
scher Lehrstuhlroutine ins Spiel. Im Gegenteil:
Bartigs persönlich vollzogene Aneignung der
homerischen Dichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß er sich immer wieder von Versen
und Szenen ergreifen läßt, die von Homers Hu-
manität geprägt sind. Diese zeigt sich ihm in der
Respektierung der Gefühle des Feindes, in dem
Stellenwert von atSthg und eXeog und in dem
von Achilleus angenommenen Ineinander von
schicksalhafter Bestimmung und freier Ent-
scheidung. Gerade in diesem Sich-Fügen in ein
Gebundensein sieht Bärtig mit Schadewaldt „ein
erstes Bild menschlicher Freiheit" und mit K.
Reinhardt erkennt er in der Szene, in der
Achilleus dem Priamos das Nachtlager bereitet,
„eine einmalige, überwältigende, nie für mög-
lich gehaltene Fürsorge", eine neue Qualität des
Humanen. Auf diese neue Sinnstiftung der Ilias
im Q zielte, wie Bärtig in den abschließenden
Erläuterungen zur Textarbeit noch einmal be-
kennt. letztlich das Interesse des Philosophen.
Bartigs Homer-Büchlein ist das Resultat per-
sönlicher Betroffenheit durch das Phänomen
Homer. Dem Leser begegnet in seiner Vermitt-
lung Homer als „strahlender Begriff für große
Dichtung" (Latacz) in bezwingender Gegen-
wärtigkeit und Aktualität. Es gelingt ihm, ex-
emplarisch an der Xuotg-Szene Homer für Men-
schen unserer Zeit zum Sprechen zu bringen
und zu einem literarisch-ästhetischen und
menschlichen Erlebnis werden zu lassen.
Die mit Bedacht gewählten antiken Vasenbilder
korrespondieren in ihren Szenen stiller
Menschlichkeit, ihrer Liebe zum schönen Detail
und ihrem Sinn für Kompositionslinien mit der
interpretierenden Handschrift des Verfassers. So
können Bartigs Homerinterpretationen Mut
machen, der homerischen Dichtung die primäre
Stellung im Lektüreunterricht zu bewahren.
NICOLAUS STRUBE, Hildesheim
//a/A JaAoA Bc/unAf; „Die - JVanJc/",
Bnc/?.' „Der .Sn'wwfon A/ingt nacA D'e-
7va;", 622 &, 64 DM; zrveife^ Bac/?.* „Bmwa/ig
Ar Deine Meiociie", 264 6., 26 DM, B. G. Di-
,sei;er Vcr/ag BranA/nrr 7996.
Der Gedanke an Philosophie, die „Liebe zur
Weisheit, zur Wissenschaft", läßt Namen der
Weltgeschichte wie Platon, Kant und Heidegger
in Erinnerung rufen. Daß jedoch die Auseinan-
dersetzung mit philosophischer Tradition nicht
nur Philosophen, also einem kleinen Kreis Ein-
geweihter, Vorbehalten sein muß, beweisen die
soeben erschienenen und auf der Frankfurter
Buchmesse einem breiten Publikum präsentier-
ten Bücher von Hans Jakob Schmitt, dem ehe-
40