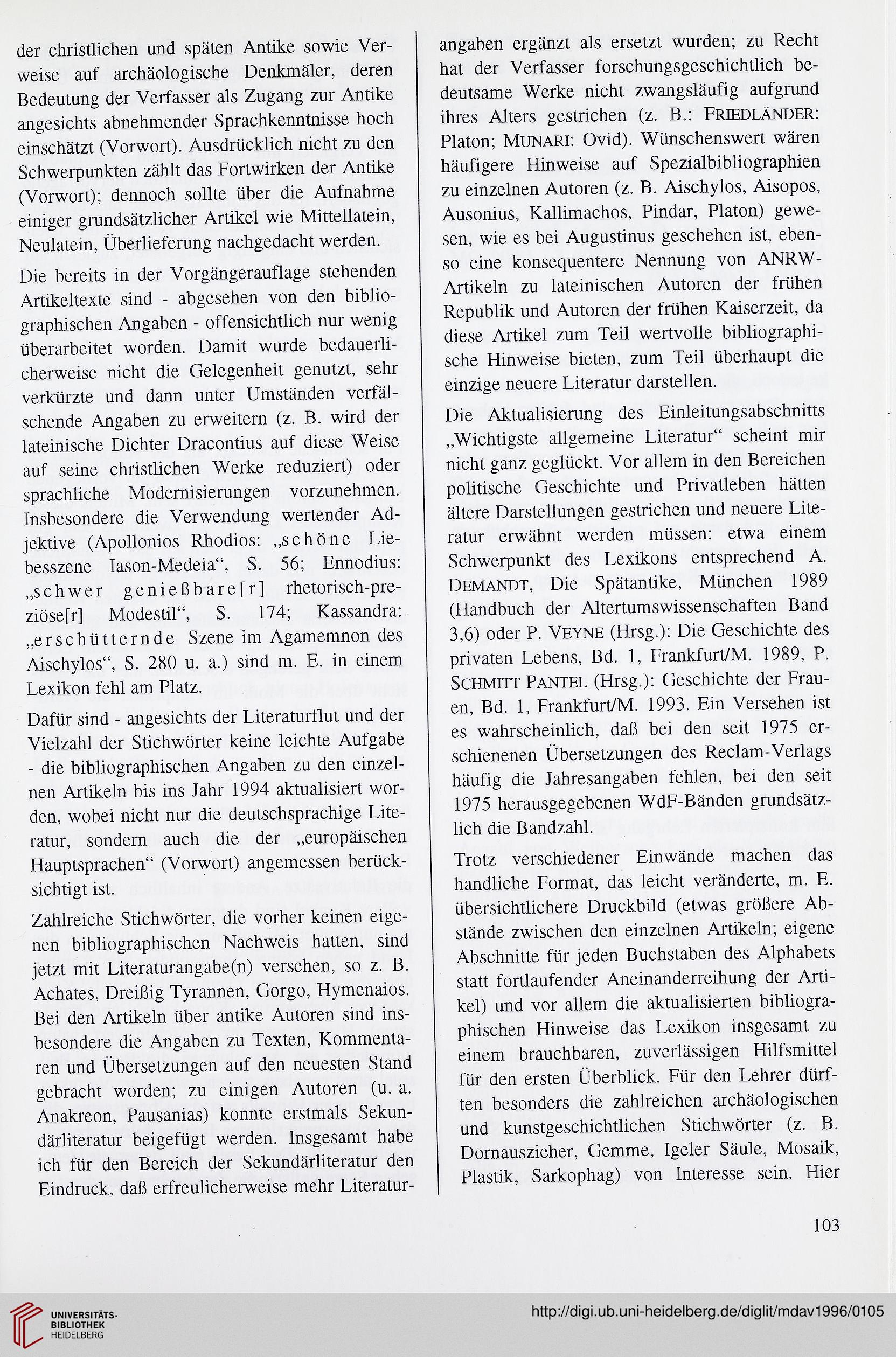der christlichen und späten Antike sowie Ver-
weise auf archäologische Denkmäler, deren
Bedeutung der Verfasser als Zugang zur Antike
angesichts abnehmender Sprachkenntnisse hoch
einschätzt (Vorwort). Ausdrücklich nicht zu den
Schwerpunkten zählt das Fortwirken der Antike
(Vorwort); dennoch sollte über die Aufnahme
einiger grundsätzlicher Artikel wie Mittellatein,
Neulatein, Überlieferung nachgedacht werden.
Die bereits in der Vorgängerauflage stehenden
Artikeltexte sind - abgesehen von den biblio-
graphischen Angaben - offensichtlich nur wenig
überarbeitet worden. Damit wurde bedauerli-
cherweise nicht die Gelegenheit genutzt, sehr
verkürzte und dann unter Umständen verfäl-
schende Angaben zu erweitern (z. B. wird der
lateinische Dichter Dracontius auf diese Weise
auf seine christlichen Werke reduziert) oder
sprachliche Modernisierungen vorzunehmen.
Insbesondere die Verwendung wertender Ad-
jektive (Apollonios Rhodios: „schöne Lie-
besszene Iason-Medeia", S. 56; Ennodius:
„schwer genießbare[r] rhetorisch-pre-
ziöse[r] Modestil", S. 174; Kassandra:
„erschütternde Szene im Agamemnon des
Aischylos", S. 280 u. a.) sind m. E. in einem
Lexikon fehl am Platz.
Dafür sind - angesichts der Literaturflut und der
Vielzahl der Stichwörter keine leichte Aufgabe
- die bibliographischen Angaben zu den einzel-
nen Artikeln bis ins Jahr 1994 aktualisiert wor-
den, wobei nicht nur die deutschsprachige Lite-
ratur, sondern auch die der „europäischen
Hauptsprachen" (Vorwort) angemessen berück-
sichtigt ist.
Zahlreiche Stichwörter, die vorher keinen eige-
nen bibliographischen Nachweis hatten, sind
jetzt mit Literaturangabe(n) versehen, so z. B.
Achates, Dreißig Tyrannen, Gorgo, Hymenaios.
Bei den Artikeln über antike Autoren sind ins-
besondere die Angaben zu Texten, Kommenta-
ren und Übersetzungen auf den neuesten Stand
gebracht worden; zu einigen Autoren (u. a.
Anakreon, Pausanias) konnte erstmals Sekun-
därliteratur beigefügt werden. Insgesamt habe
ich für den Bereich der Sekundärliteratur den
Eindruck, daß erfreulicherweise mehr Literatur-
angaben ergänzt als ersetzt wurden; zu Recht
hat der Verfasser forschungsgeschichtlich be-
deutsame Werke nicht zwangsläufig aufgrund
ihres Alters gestrichen (z. B.: FRIEDLÄNDER:
Platon; MUNARl: Ovid). Wünschenswert wären
häufigere Hinweise auf Spezialbibliographien
zu einzelnen Autoren (z. B. Aischylos, Aisopos,
Ausonius, Kallimachos, Pindar, Platon) gewe-
sen, wie es bei Augustinus geschehen ist, eben-
so eine konsequentere Nennung von ANRW-
Artikeln zu lateinischen Autoren der frühen
Republik und Autoren der frühen Kaiserzeit, da
diese Artikel zum Teil wertvolle bibliographi-
sche Hinweise bieten, zum Teil überhaupt die
einzige neuere Literatur darstellen.
Die Aktualisierung des Einleitungsabschnitts
„Wichtigste allgemeine Literatur" scheint mir
nicht ganz geglückt. Vor allem in den Bereichen
politische Geschichte und Privatleben hätten
ältere Darstellungen gestrichen und neuere Lite-
ratur erwähnt werden müssen: etwa einem
Schwerpunkt des Lexikons entsprechend A.
DEMANDT, Die Spätantike, München 1989
(Handbuch der Altertumswissenschaften Band
3,6) oder P. VEYNE (Hrsg.): Die Geschichte des
privaten Lebens, Bd. 1, Frankfurt/M. 1989, P.
SCHMITT PANTEL (Hrsg.): Geschichte der Frau-
en, Bd. 1, Frankfurt/M. 1993. Ein Versehen ist
es wahrscheinlich, daß bei den seit 1975 er-
schienenen Übersetzungen des Reclam-Verlags
häufig die Jahresangaben fehlen, bei den seit
1975 herausgegebenen WdF-Bänden grundsätz-
lich die Bandzahl.
Trotz verschiedener Einwände machen das
handliche Format, das leicht veränderte, m. E.
übersichtlichere Druckbild (etwas größere Ab-
stände zwischen den einzelnen Artikeln; eigene
Abschnitte für jeden Buchstaben des Alphabets
statt fortlaufender Aneinanderreihung der Arti-
kel) und vor allem die aktualisierten bibliogra-
phischen Hinweise das Lexikon insgesamt zu
einem brauchbaren, zuverlässigen Hilfsmittel
für den ersten Überblick. Für den Lehrer dürf-
ten besonders die zahlreichen archäologischen
und kunstgeschichtlichen Stichwörter (z. B.
Dornauszieher, Gemme, Igeler Säule, Mosaik,
Plastik, Sarkophag) von Interesse sein. Hier
103
weise auf archäologische Denkmäler, deren
Bedeutung der Verfasser als Zugang zur Antike
angesichts abnehmender Sprachkenntnisse hoch
einschätzt (Vorwort). Ausdrücklich nicht zu den
Schwerpunkten zählt das Fortwirken der Antike
(Vorwort); dennoch sollte über die Aufnahme
einiger grundsätzlicher Artikel wie Mittellatein,
Neulatein, Überlieferung nachgedacht werden.
Die bereits in der Vorgängerauflage stehenden
Artikeltexte sind - abgesehen von den biblio-
graphischen Angaben - offensichtlich nur wenig
überarbeitet worden. Damit wurde bedauerli-
cherweise nicht die Gelegenheit genutzt, sehr
verkürzte und dann unter Umständen verfäl-
schende Angaben zu erweitern (z. B. wird der
lateinische Dichter Dracontius auf diese Weise
auf seine christlichen Werke reduziert) oder
sprachliche Modernisierungen vorzunehmen.
Insbesondere die Verwendung wertender Ad-
jektive (Apollonios Rhodios: „schöne Lie-
besszene Iason-Medeia", S. 56; Ennodius:
„schwer genießbare[r] rhetorisch-pre-
ziöse[r] Modestil", S. 174; Kassandra:
„erschütternde Szene im Agamemnon des
Aischylos", S. 280 u. a.) sind m. E. in einem
Lexikon fehl am Platz.
Dafür sind - angesichts der Literaturflut und der
Vielzahl der Stichwörter keine leichte Aufgabe
- die bibliographischen Angaben zu den einzel-
nen Artikeln bis ins Jahr 1994 aktualisiert wor-
den, wobei nicht nur die deutschsprachige Lite-
ratur, sondern auch die der „europäischen
Hauptsprachen" (Vorwort) angemessen berück-
sichtigt ist.
Zahlreiche Stichwörter, die vorher keinen eige-
nen bibliographischen Nachweis hatten, sind
jetzt mit Literaturangabe(n) versehen, so z. B.
Achates, Dreißig Tyrannen, Gorgo, Hymenaios.
Bei den Artikeln über antike Autoren sind ins-
besondere die Angaben zu Texten, Kommenta-
ren und Übersetzungen auf den neuesten Stand
gebracht worden; zu einigen Autoren (u. a.
Anakreon, Pausanias) konnte erstmals Sekun-
därliteratur beigefügt werden. Insgesamt habe
ich für den Bereich der Sekundärliteratur den
Eindruck, daß erfreulicherweise mehr Literatur-
angaben ergänzt als ersetzt wurden; zu Recht
hat der Verfasser forschungsgeschichtlich be-
deutsame Werke nicht zwangsläufig aufgrund
ihres Alters gestrichen (z. B.: FRIEDLÄNDER:
Platon; MUNARl: Ovid). Wünschenswert wären
häufigere Hinweise auf Spezialbibliographien
zu einzelnen Autoren (z. B. Aischylos, Aisopos,
Ausonius, Kallimachos, Pindar, Platon) gewe-
sen, wie es bei Augustinus geschehen ist, eben-
so eine konsequentere Nennung von ANRW-
Artikeln zu lateinischen Autoren der frühen
Republik und Autoren der frühen Kaiserzeit, da
diese Artikel zum Teil wertvolle bibliographi-
sche Hinweise bieten, zum Teil überhaupt die
einzige neuere Literatur darstellen.
Die Aktualisierung des Einleitungsabschnitts
„Wichtigste allgemeine Literatur" scheint mir
nicht ganz geglückt. Vor allem in den Bereichen
politische Geschichte und Privatleben hätten
ältere Darstellungen gestrichen und neuere Lite-
ratur erwähnt werden müssen: etwa einem
Schwerpunkt des Lexikons entsprechend A.
DEMANDT, Die Spätantike, München 1989
(Handbuch der Altertumswissenschaften Band
3,6) oder P. VEYNE (Hrsg.): Die Geschichte des
privaten Lebens, Bd. 1, Frankfurt/M. 1989, P.
SCHMITT PANTEL (Hrsg.): Geschichte der Frau-
en, Bd. 1, Frankfurt/M. 1993. Ein Versehen ist
es wahrscheinlich, daß bei den seit 1975 er-
schienenen Übersetzungen des Reclam-Verlags
häufig die Jahresangaben fehlen, bei den seit
1975 herausgegebenen WdF-Bänden grundsätz-
lich die Bandzahl.
Trotz verschiedener Einwände machen das
handliche Format, das leicht veränderte, m. E.
übersichtlichere Druckbild (etwas größere Ab-
stände zwischen den einzelnen Artikeln; eigene
Abschnitte für jeden Buchstaben des Alphabets
statt fortlaufender Aneinanderreihung der Arti-
kel) und vor allem die aktualisierten bibliogra-
phischen Hinweise das Lexikon insgesamt zu
einem brauchbaren, zuverlässigen Hilfsmittel
für den ersten Überblick. Für den Lehrer dürf-
ten besonders die zahlreichen archäologischen
und kunstgeschichtlichen Stichwörter (z. B.
Dornauszieher, Gemme, Igeler Säule, Mosaik,
Plastik, Sarkophag) von Interesse sein. Hier
103