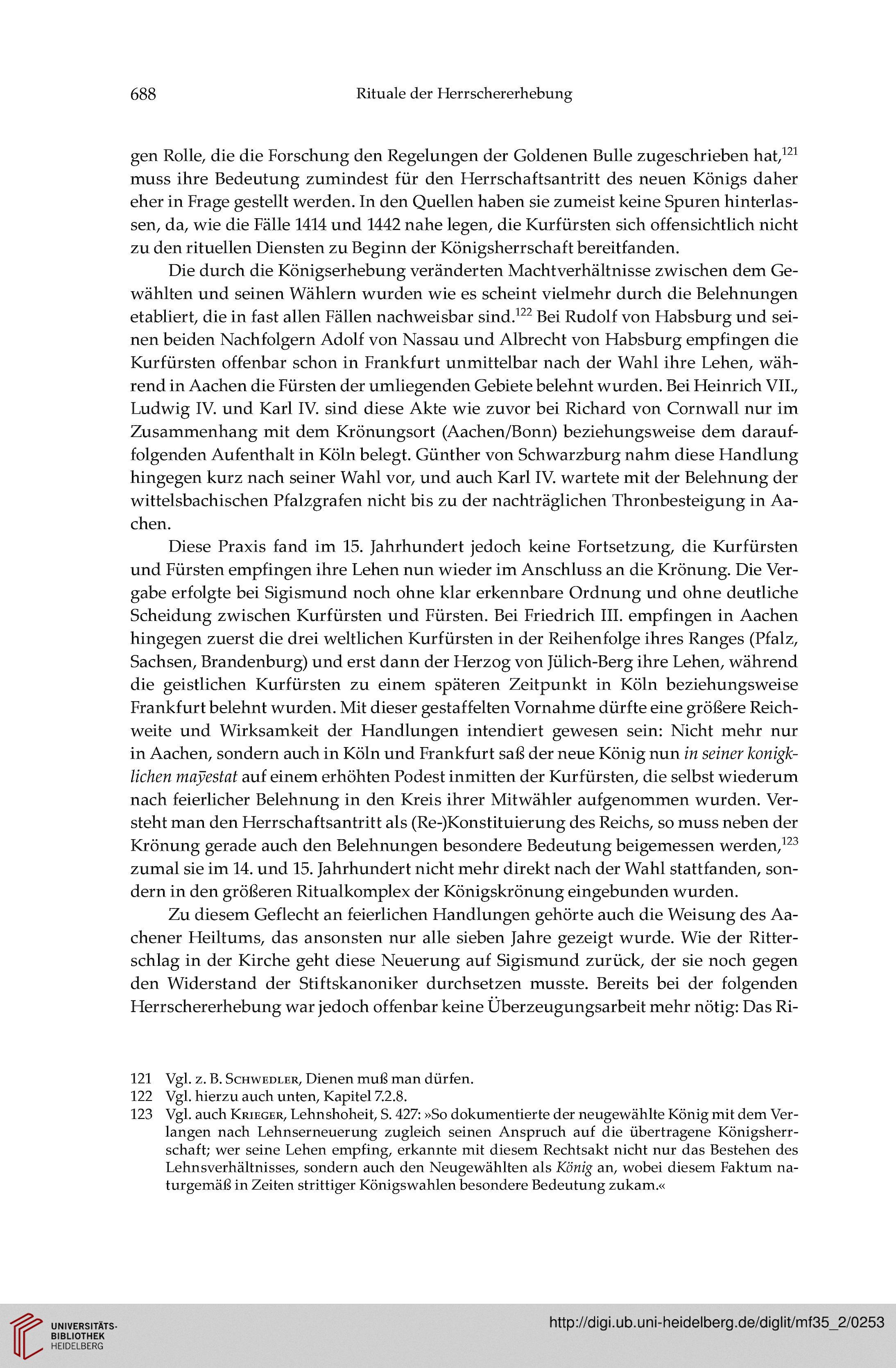688
Rituale der Herrschererhebung
gen Rolle, die die Forschung den Regelungen der Goldenen Bulle zugeschrieben hatü'
muss ihre Bedeutung zumindest für den Herrschaftsantritt des neuen Königs daher
eher in Frage gestellt werden. In den Quellen haben sie zumeist keine Spuren hinterlas-
sen, da, wie die Fälle 1414 und 1442 nahe legen, die Kurfürsten sich offensichtlich nicht
zu den rituellen Diensten zu Beginn der Königsherrschaft bereitfanden.
Die durch die Königserhebung veränderten Machtverhältnisse zwischen dem Ge-
wählten und seinen Wählern wurden wie es scheint vielmehr durch die Belehnungen
etabliert, die in fast allen Fällen nachweisbar sind.'^ Bei Rudolf von Habsburg und sei-
nen beiden Nachfolgern Adolf von Nassau und Albrecht von Habsburg empfingen die
Kurfürsten offenbar schon in Frankfurt unmittelbar nach der Wahl ihre Lehen, wäh-
rend in Aachen die Fürsten der umliegenden Gebiete belehnt wurden. Bei Heinrich VII.,
Ludwig IV. und Karl IV. sind diese Akte wie zuvor bei Richard von Cornwall nur im
Zusammenhang mit dem Krönungsort (Aachen/Bonn) beziehungsweise dem darauf-
folgenden Aufenthalt in Köln belegt. Günther von Schwarzburg nahm diese Handlung
hingegen kurz nach seiner Wahl vor, und auch Karl IV. wartete mit der Belehnung der
wittelsbachischen Pfalzgrafen nicht bis zu der nachträglichen Thronbesteigung in Aa-
chen.
Diese Praxis fand im 15. Jahrhundert jedoch keine Fortsetzung, die Kurfürsten
und Fürsten empfingen ihre Lehen nun wieder im Anschluss an die Krönung. Die Ver-
gabe erfolgte bei Sigismund noch ohne klar erkennbare Ordnung und ohne deutliche
Scheidung zwischen Kurfürsten und Fürsten. Bei Friedrich III. empfingen in Aachen
hingegen zuerst die drei weltlichen Kurfürsten in der Reihenfolge ihres Ranges (Pfalz,
Sachsen, Brandenburg) und erst dann der Herzog von Jülich-Berg ihre Lehen, während
die geistlichen Kurfürsten zu einem späteren Zeitpunkt in Köln beziehungsweise
Frankfurt belehnt wurden. Mit dieser gestaffelten Vornahme dürfte eine größere Reich-
weite und Wirksamkeit der Handlungen intendiert gewesen sein: Nicht mehr nur
in Aachen, sondern auch in Köln und Frankfurt saß der neue König nun in seiner iconigic-
iici?en nMyesfaf auf einem erhöhten Podest inmitten der Kurfürsten, die selbst wiederum
nach feierlicher Belehnung in den Kreis ihrer Mitwähler aufgenommen wurden. Ver-
steht man den Herrschaftsantritt als (Re-)Konstituierung des Reichs, so muss neben der
Krönung gerade auch den Belehnungen besondere Bedeutung beigemessen werden,'^
zumal sie im 14. und 15. Jahrhundert nicht mehr direkt nach der Wahl stattfanden, son-
dern in den größeren Ritualkomplex der Königskrönung eingebunden wurden.
Zu diesem Geflecht an feierlichen Handlungen gehörte auch die Weisung des Aa-
chener Heiltums, das ansonsten nur alle sieben Jahre gezeigt wurde. Wie der Ritter-
schlag in der Kirche geht diese Neuerung auf Sigismund zurück, der sie noch gegen
den Widerstand der Stiftskanoniker durchsetzen musste. Bereits bei der folgenden
Herrschererhebung war jedoch offenbar keine Überzeugungsarbeit mehr nötig: Das Ri-
121 Vgl. z. B. ScHWEDLER, Dienen muß man dürfen.
122 Vgl. hierzu auch unten, Kapitel 7.2.8.
123 Vgl. auch KRIEGER, Lehnshoheit, S. 427: »So dokumentierte der neugewählte König mit dem Ver-
langen nach Lehnserneuerung zugleich seinen Anspruch auf die übertragene Königsherr-
schaft; wer seine Lehen empfing, erkannte mit diesem Rechtsakt nicht nur das Bestehen des
Lehnsverhältnisses, sondern auch den Neugewählten als König an, wobei diesem Faktum na-
turgemäß in Zeiten strittiger Königswahlen besondere Bedeutung zukam.«
Rituale der Herrschererhebung
gen Rolle, die die Forschung den Regelungen der Goldenen Bulle zugeschrieben hatü'
muss ihre Bedeutung zumindest für den Herrschaftsantritt des neuen Königs daher
eher in Frage gestellt werden. In den Quellen haben sie zumeist keine Spuren hinterlas-
sen, da, wie die Fälle 1414 und 1442 nahe legen, die Kurfürsten sich offensichtlich nicht
zu den rituellen Diensten zu Beginn der Königsherrschaft bereitfanden.
Die durch die Königserhebung veränderten Machtverhältnisse zwischen dem Ge-
wählten und seinen Wählern wurden wie es scheint vielmehr durch die Belehnungen
etabliert, die in fast allen Fällen nachweisbar sind.'^ Bei Rudolf von Habsburg und sei-
nen beiden Nachfolgern Adolf von Nassau und Albrecht von Habsburg empfingen die
Kurfürsten offenbar schon in Frankfurt unmittelbar nach der Wahl ihre Lehen, wäh-
rend in Aachen die Fürsten der umliegenden Gebiete belehnt wurden. Bei Heinrich VII.,
Ludwig IV. und Karl IV. sind diese Akte wie zuvor bei Richard von Cornwall nur im
Zusammenhang mit dem Krönungsort (Aachen/Bonn) beziehungsweise dem darauf-
folgenden Aufenthalt in Köln belegt. Günther von Schwarzburg nahm diese Handlung
hingegen kurz nach seiner Wahl vor, und auch Karl IV. wartete mit der Belehnung der
wittelsbachischen Pfalzgrafen nicht bis zu der nachträglichen Thronbesteigung in Aa-
chen.
Diese Praxis fand im 15. Jahrhundert jedoch keine Fortsetzung, die Kurfürsten
und Fürsten empfingen ihre Lehen nun wieder im Anschluss an die Krönung. Die Ver-
gabe erfolgte bei Sigismund noch ohne klar erkennbare Ordnung und ohne deutliche
Scheidung zwischen Kurfürsten und Fürsten. Bei Friedrich III. empfingen in Aachen
hingegen zuerst die drei weltlichen Kurfürsten in der Reihenfolge ihres Ranges (Pfalz,
Sachsen, Brandenburg) und erst dann der Herzog von Jülich-Berg ihre Lehen, während
die geistlichen Kurfürsten zu einem späteren Zeitpunkt in Köln beziehungsweise
Frankfurt belehnt wurden. Mit dieser gestaffelten Vornahme dürfte eine größere Reich-
weite und Wirksamkeit der Handlungen intendiert gewesen sein: Nicht mehr nur
in Aachen, sondern auch in Köln und Frankfurt saß der neue König nun in seiner iconigic-
iici?en nMyesfaf auf einem erhöhten Podest inmitten der Kurfürsten, die selbst wiederum
nach feierlicher Belehnung in den Kreis ihrer Mitwähler aufgenommen wurden. Ver-
steht man den Herrschaftsantritt als (Re-)Konstituierung des Reichs, so muss neben der
Krönung gerade auch den Belehnungen besondere Bedeutung beigemessen werden,'^
zumal sie im 14. und 15. Jahrhundert nicht mehr direkt nach der Wahl stattfanden, son-
dern in den größeren Ritualkomplex der Königskrönung eingebunden wurden.
Zu diesem Geflecht an feierlichen Handlungen gehörte auch die Weisung des Aa-
chener Heiltums, das ansonsten nur alle sieben Jahre gezeigt wurde. Wie der Ritter-
schlag in der Kirche geht diese Neuerung auf Sigismund zurück, der sie noch gegen
den Widerstand der Stiftskanoniker durchsetzen musste. Bereits bei der folgenden
Herrschererhebung war jedoch offenbar keine Überzeugungsarbeit mehr nötig: Das Ri-
121 Vgl. z. B. ScHWEDLER, Dienen muß man dürfen.
122 Vgl. hierzu auch unten, Kapitel 7.2.8.
123 Vgl. auch KRIEGER, Lehnshoheit, S. 427: »So dokumentierte der neugewählte König mit dem Ver-
langen nach Lehnserneuerung zugleich seinen Anspruch auf die übertragene Königsherr-
schaft; wer seine Lehen empfing, erkannte mit diesem Rechtsakt nicht nur das Bestehen des
Lehnsverhältnisses, sondern auch den Neugewählten als König an, wobei diesem Faktum na-
turgemäß in Zeiten strittiger Königswahlen besondere Bedeutung zukam.«