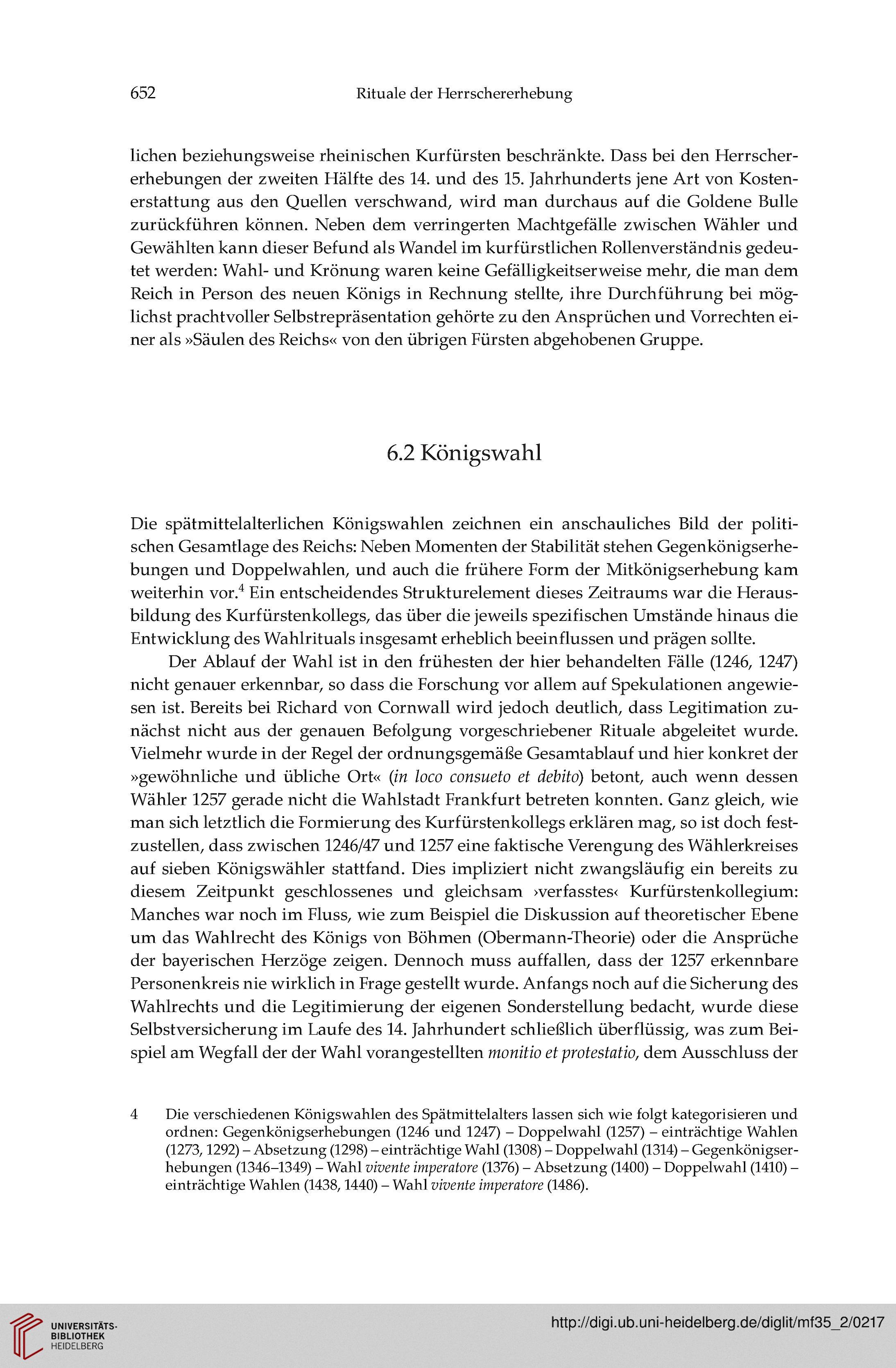652
Rituale der Herrschererhebung
liehen beziehungsweise rheinischen Kurfürsten beschränkte. Dass bei den Herrscher-
erhebungen der zweiten Hälfte des 14. und des 15. Jahrhunderts jene Art von Kosten-
erstattung aus den Quellen verschwand, wird man durchaus auf die Goldene Bulle
zurückführen können. Neben dem verringerten Machtgefälle zwischen Wähler und
Gewählten kann dieser Befund als Wandel im kurfürstlichen Rollenverständnis gedeu-
tet werden: Wahl- und Krönung waren keine Gefälligkeitserweise mehr, die man dem
Reich in Person des neuen Königs in Rechnung stellte, ihre Durchführung bei mög-
lichst prachtvoller Selbstrepräsentation gehörte zu den Ansprüchen und Vorrechten ei-
ner als »Säulen des Reichs« von den übrigen Fürsten abgehobenen Gruppe.
6.2 Königswahl
Die spätmittelalterlichen Königswahlen zeichnen ein anschauliches Bild der politi-
schen Gesamtlage des Reichs: Neben Momenten der Stabilität stehen Gegenkönigserhe-
bungen und Doppelwahlen, und auch die frühere Form der Mitkönigserhebung kam
weiterhin vord Ein entscheidendes Strukturelement dieses Zeitraums war die Heraus-
bildung des Kurfürstenkollegs, das über die jeweils spezifischen Umstände hinaus die
Entwicklung des Wahlrituals insgesamt erheblich beeinflussen und prägen sollte.
Der Ablauf der Wahl ist in den frühesten der hier behandelten Fälle (1246, 1247)
nicht genauer erkennbar, so dass die Forschung vor allem auf Spekulationen angewie-
sen ist. Bereits bei Richard von Cornwall wird jedoch deutlich, dass Legitimation zu-
nächst nicht aus der genauen Befolgung vorgeschriebener Rituale abgeleitet wurde.
Vielmehr wurde in der Regel der ordnungsgemäße Gesamtablauf und hier konkret der
»gewöhnliche und übliche Ort« (in loco consnoto et dohito) betont, auch wenn dessen
Wähler 1257 gerade nicht die Wahlstadt Frankfurt betreten konnten. Ganz gleich, wie
man sich letztlich die Formierung des Kurfürstenkollegs erklären mag, so ist doch fest-
zustellen, dass zwischen 1246/47 und 1257 eine faktische Verengung des Wählerkreises
auf sieben Königswähler stattfand. Dies impliziert nicht zwangsläufig ein bereits zu
diesem Zeitpunkt geschlossenes und gleichsam >verfasstes< Kurfürstenkollegium:
Manches war noch im Fluss, wie zum Beispiel die Diskussion auf theoretischer Ebene
um das Wahlrecht des Königs von Böhmen (Obermann-Theorie) oder die Ansprüche
der bayerischen Herzoge zeigen. Dennoch muss auffallen, dass der 1257 erkennbare
Personenkreis nie wirklich in Frage gestellt wurde. Anfangs noch auf die Sicherung des
Wahlrechts und die Legitimierung der eigenen Sonderstellung bedacht, wurde diese
Selbstversicherung im Laufe des 14. Jahrhundert schließlich überflüssig, was zum Bei-
spiel am Wegfall der der Wahl vorangestellten monitio et protestatio, dem Ausschluss der
4 Die verschiedenen Königswahlen des Spätmittelalters lassen sich wie folgt kategorisieren und
ordnen: Gegenkönigserhebungen (1246 und 1247) - Doppelwahl (1257) - einträchtige Wahlen
(1273,1292) - Absetzung (1298) - einträchtige Wahl (1308) - Doppelwahl (1314) - Gegenkönigser-
hebungen (1346-1349) - Wahl u/A'ak' z'mprratorr (1376) - Absetzung (1400) - Doppelwahl (1410) -
einträchtige Wahlen (1438,1440) - Wahl u/A'ak' z'mperatorr (1486).
Rituale der Herrschererhebung
liehen beziehungsweise rheinischen Kurfürsten beschränkte. Dass bei den Herrscher-
erhebungen der zweiten Hälfte des 14. und des 15. Jahrhunderts jene Art von Kosten-
erstattung aus den Quellen verschwand, wird man durchaus auf die Goldene Bulle
zurückführen können. Neben dem verringerten Machtgefälle zwischen Wähler und
Gewählten kann dieser Befund als Wandel im kurfürstlichen Rollenverständnis gedeu-
tet werden: Wahl- und Krönung waren keine Gefälligkeitserweise mehr, die man dem
Reich in Person des neuen Königs in Rechnung stellte, ihre Durchführung bei mög-
lichst prachtvoller Selbstrepräsentation gehörte zu den Ansprüchen und Vorrechten ei-
ner als »Säulen des Reichs« von den übrigen Fürsten abgehobenen Gruppe.
6.2 Königswahl
Die spätmittelalterlichen Königswahlen zeichnen ein anschauliches Bild der politi-
schen Gesamtlage des Reichs: Neben Momenten der Stabilität stehen Gegenkönigserhe-
bungen und Doppelwahlen, und auch die frühere Form der Mitkönigserhebung kam
weiterhin vord Ein entscheidendes Strukturelement dieses Zeitraums war die Heraus-
bildung des Kurfürstenkollegs, das über die jeweils spezifischen Umstände hinaus die
Entwicklung des Wahlrituals insgesamt erheblich beeinflussen und prägen sollte.
Der Ablauf der Wahl ist in den frühesten der hier behandelten Fälle (1246, 1247)
nicht genauer erkennbar, so dass die Forschung vor allem auf Spekulationen angewie-
sen ist. Bereits bei Richard von Cornwall wird jedoch deutlich, dass Legitimation zu-
nächst nicht aus der genauen Befolgung vorgeschriebener Rituale abgeleitet wurde.
Vielmehr wurde in der Regel der ordnungsgemäße Gesamtablauf und hier konkret der
»gewöhnliche und übliche Ort« (in loco consnoto et dohito) betont, auch wenn dessen
Wähler 1257 gerade nicht die Wahlstadt Frankfurt betreten konnten. Ganz gleich, wie
man sich letztlich die Formierung des Kurfürstenkollegs erklären mag, so ist doch fest-
zustellen, dass zwischen 1246/47 und 1257 eine faktische Verengung des Wählerkreises
auf sieben Königswähler stattfand. Dies impliziert nicht zwangsläufig ein bereits zu
diesem Zeitpunkt geschlossenes und gleichsam >verfasstes< Kurfürstenkollegium:
Manches war noch im Fluss, wie zum Beispiel die Diskussion auf theoretischer Ebene
um das Wahlrecht des Königs von Böhmen (Obermann-Theorie) oder die Ansprüche
der bayerischen Herzoge zeigen. Dennoch muss auffallen, dass der 1257 erkennbare
Personenkreis nie wirklich in Frage gestellt wurde. Anfangs noch auf die Sicherung des
Wahlrechts und die Legitimierung der eigenen Sonderstellung bedacht, wurde diese
Selbstversicherung im Laufe des 14. Jahrhundert schließlich überflüssig, was zum Bei-
spiel am Wegfall der der Wahl vorangestellten monitio et protestatio, dem Ausschluss der
4 Die verschiedenen Königswahlen des Spätmittelalters lassen sich wie folgt kategorisieren und
ordnen: Gegenkönigserhebungen (1246 und 1247) - Doppelwahl (1257) - einträchtige Wahlen
(1273,1292) - Absetzung (1298) - einträchtige Wahl (1308) - Doppelwahl (1314) - Gegenkönigser-
hebungen (1346-1349) - Wahl u/A'ak' z'mprratorr (1376) - Absetzung (1400) - Doppelwahl (1410) -
einträchtige Wahlen (1438,1440) - Wahl u/A'ak' z'mperatorr (1486).