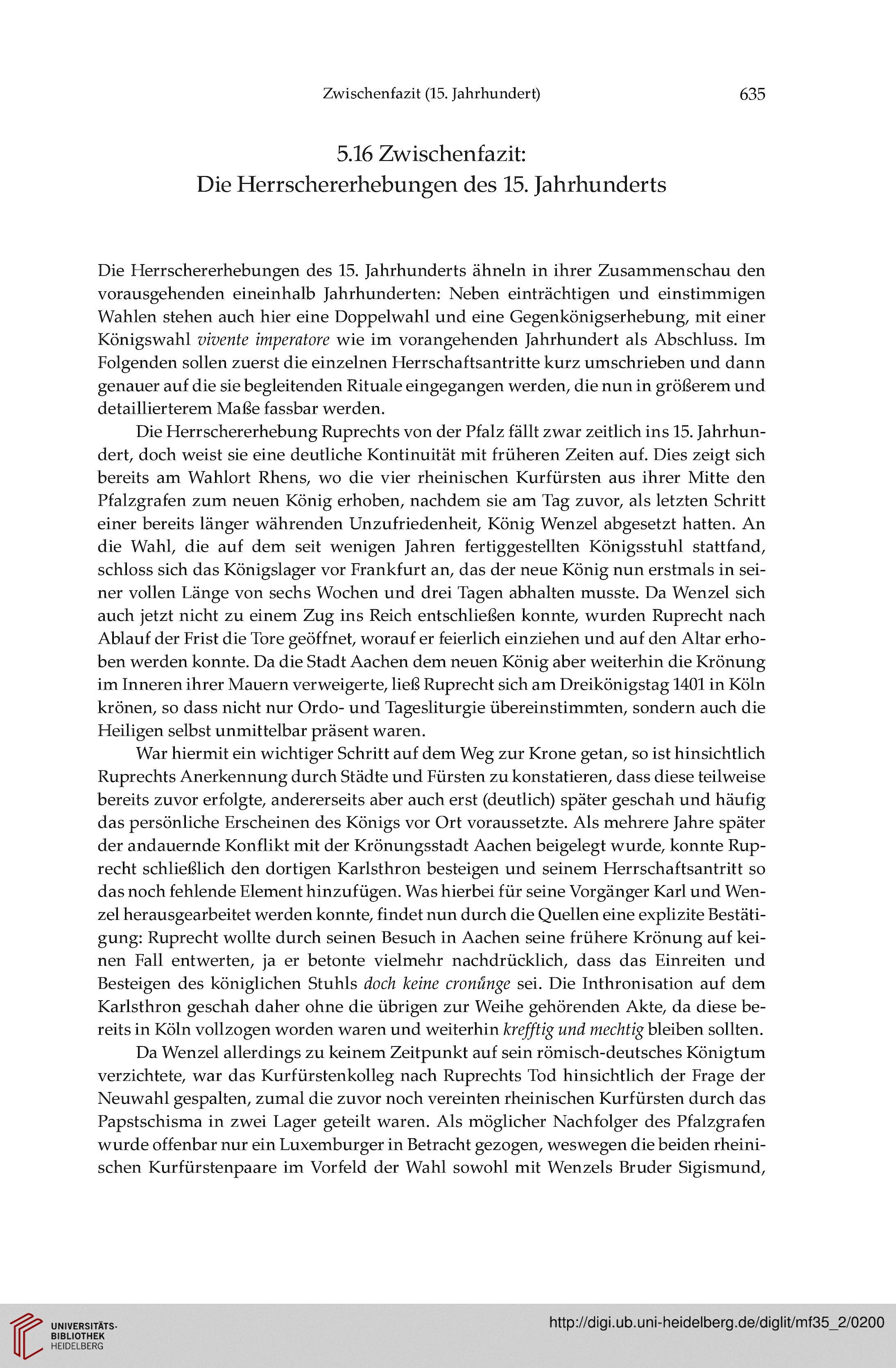Zwischenfazit (15. Jahrhundert)
635
5.16 Zwischenfazit:
Die Herrschererhebungen des 15. Jahrhunderts
Die Herrschererhebungen des 15. Jahrhunderts ähneln in ihrer Zusammenschau den
vorausgehenden eineinhalb Jahrhunderten: Neben einträchtigen und einstimmigen
Wahlen stehen auch hier eine Doppelwahl und eine Gegenkönigserhebung, mit einer
Königswahl uzuenfe zmpenüore wie im vorangehenden Jahrhundert als Abschluss. Im
Folgenden sollen zuerst die einzelnen Herrschaftsantritte kurz umschrieben und dann
genauer auf die sie begleitenden Rituale eingegangen werden, die nun in größerem und
detaillierterem Maße fassbar werden.
Die Herrschererhebung Ruprechts von der Pfalz fällt zwar zeitlich ins 15. Jahrhun-
dert, doch weist sie eine deutliche Kontinuität mit früheren Zeiten auf. Dies zeigt sich
bereits am Wahlort Rhens, wo die vier rheinischen Kurfürsten aus ihrer Mitte den
Pfalzgrafen zum neuen König erhoben, nachdem sie am Tag zuvor, als letzten Schritt
einer bereits länger währenden Unzufriedenheit, König Wenzel abgesetzt hatten. An
die Wahl, die auf dem seit wenigen Jahren fertiggestellten Königsstuhl stattfand,
schloss sich das Königslager vor Frankfurt an, das der neue König nun erstmals in sei-
ner vollen Länge von sechs Wochen und drei Tagen abhalten musste. Da Wenzel sich
auch jetzt nicht zu einem Zug ins Reich entschließen konnte, wurden Ruprecht nach
Ablauf der Frist die Tore geöffnet, worauf er feierlich einziehen und auf den Altar erho-
ben werden konnte. Da die Stadt Aachen dem neuen König aber weiterhin die Krönung
im Inneren ihrer Mauern verweigerte, ließ Ruprecht sich am Dreikönigstag 1401 in Köln
krönen, so dass nicht nur Ordo- und Tagesliturgie übereinstimmten, sondern auch die
Heiligen selbst unmittelbar präsent waren.
War hiermit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Krone getan, so ist hinsichtlich
Ruprechts Anerkennung durch Städte und Fürsten zu konstatieren, dass diese teilweise
bereits zuvor erfolgte, andererseits aber auch erst (deutlich) später geschah und häufig
das persönliche Erscheinen des Königs vor Ort voraussetzte. Als mehrere Jahre später
der andauernde Konflikt mit der Krönungsstadt Aachen beigelegt wurde, konnte Rup-
recht schließlich den dortigen Karlsthron besteigen und seinem Herrschaftsantritt so
das noch fehlende Element hinzufügen. Was hierbei für seine Vorgänger Karl und Wen-
zel herausgearbeitet werden konnte, findet nun durch die Quellen eine explizite Bestäti-
gung: Ruprecht wollte durch seinen Besuch in Aachen seine frühere Krönung auf kei-
nen Fall entwerten, ja er betonte vielmehr nachdrücklich, dass das Einreiten und
Besteigen des königlichen Stuhls docd /(eine crondny sei. Die Inthronisation auf dem
Karlsthron geschah daher ohne die übrigen zur Weihe gehörenden Akte, da diese be-
reits in Köln vollzogen worden waren und weiterhin Mnd mecdfzg bleiben sollten.
Da Wenzel allerdings zu keinem Zeitpunkt auf sein römisch-deutsches Königtum
verzichtete, war das Kurfürstenkolleg nach Ruprechts Tod hinsichtlich der Frage der
Neuwahl gespalten, zumal die zuvor noch vereinten rheinischen Kurfürsten durch das
Papstschisma in zwei Lager geteilt waren. Als möglicher Nachfolger des Pfalzgrafen
wurde offenbar nur ein Luxemburger in Betracht gezogen, weswegen die beiden rheini-
schen Kurfürstenpaare im Vorfeld der Wahl sowohl mit Wenzels Bruder Sigismund,
635
5.16 Zwischenfazit:
Die Herrschererhebungen des 15. Jahrhunderts
Die Herrschererhebungen des 15. Jahrhunderts ähneln in ihrer Zusammenschau den
vorausgehenden eineinhalb Jahrhunderten: Neben einträchtigen und einstimmigen
Wahlen stehen auch hier eine Doppelwahl und eine Gegenkönigserhebung, mit einer
Königswahl uzuenfe zmpenüore wie im vorangehenden Jahrhundert als Abschluss. Im
Folgenden sollen zuerst die einzelnen Herrschaftsantritte kurz umschrieben und dann
genauer auf die sie begleitenden Rituale eingegangen werden, die nun in größerem und
detaillierterem Maße fassbar werden.
Die Herrschererhebung Ruprechts von der Pfalz fällt zwar zeitlich ins 15. Jahrhun-
dert, doch weist sie eine deutliche Kontinuität mit früheren Zeiten auf. Dies zeigt sich
bereits am Wahlort Rhens, wo die vier rheinischen Kurfürsten aus ihrer Mitte den
Pfalzgrafen zum neuen König erhoben, nachdem sie am Tag zuvor, als letzten Schritt
einer bereits länger währenden Unzufriedenheit, König Wenzel abgesetzt hatten. An
die Wahl, die auf dem seit wenigen Jahren fertiggestellten Königsstuhl stattfand,
schloss sich das Königslager vor Frankfurt an, das der neue König nun erstmals in sei-
ner vollen Länge von sechs Wochen und drei Tagen abhalten musste. Da Wenzel sich
auch jetzt nicht zu einem Zug ins Reich entschließen konnte, wurden Ruprecht nach
Ablauf der Frist die Tore geöffnet, worauf er feierlich einziehen und auf den Altar erho-
ben werden konnte. Da die Stadt Aachen dem neuen König aber weiterhin die Krönung
im Inneren ihrer Mauern verweigerte, ließ Ruprecht sich am Dreikönigstag 1401 in Köln
krönen, so dass nicht nur Ordo- und Tagesliturgie übereinstimmten, sondern auch die
Heiligen selbst unmittelbar präsent waren.
War hiermit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Krone getan, so ist hinsichtlich
Ruprechts Anerkennung durch Städte und Fürsten zu konstatieren, dass diese teilweise
bereits zuvor erfolgte, andererseits aber auch erst (deutlich) später geschah und häufig
das persönliche Erscheinen des Königs vor Ort voraussetzte. Als mehrere Jahre später
der andauernde Konflikt mit der Krönungsstadt Aachen beigelegt wurde, konnte Rup-
recht schließlich den dortigen Karlsthron besteigen und seinem Herrschaftsantritt so
das noch fehlende Element hinzufügen. Was hierbei für seine Vorgänger Karl und Wen-
zel herausgearbeitet werden konnte, findet nun durch die Quellen eine explizite Bestäti-
gung: Ruprecht wollte durch seinen Besuch in Aachen seine frühere Krönung auf kei-
nen Fall entwerten, ja er betonte vielmehr nachdrücklich, dass das Einreiten und
Besteigen des königlichen Stuhls docd /(eine crondny sei. Die Inthronisation auf dem
Karlsthron geschah daher ohne die übrigen zur Weihe gehörenden Akte, da diese be-
reits in Köln vollzogen worden waren und weiterhin Mnd mecdfzg bleiben sollten.
Da Wenzel allerdings zu keinem Zeitpunkt auf sein römisch-deutsches Königtum
verzichtete, war das Kurfürstenkolleg nach Ruprechts Tod hinsichtlich der Frage der
Neuwahl gespalten, zumal die zuvor noch vereinten rheinischen Kurfürsten durch das
Papstschisma in zwei Lager geteilt waren. Als möglicher Nachfolger des Pfalzgrafen
wurde offenbar nur ein Luxemburger in Betracht gezogen, weswegen die beiden rheini-
schen Kurfürstenpaare im Vorfeld der Wahl sowohl mit Wenzels Bruder Sigismund,