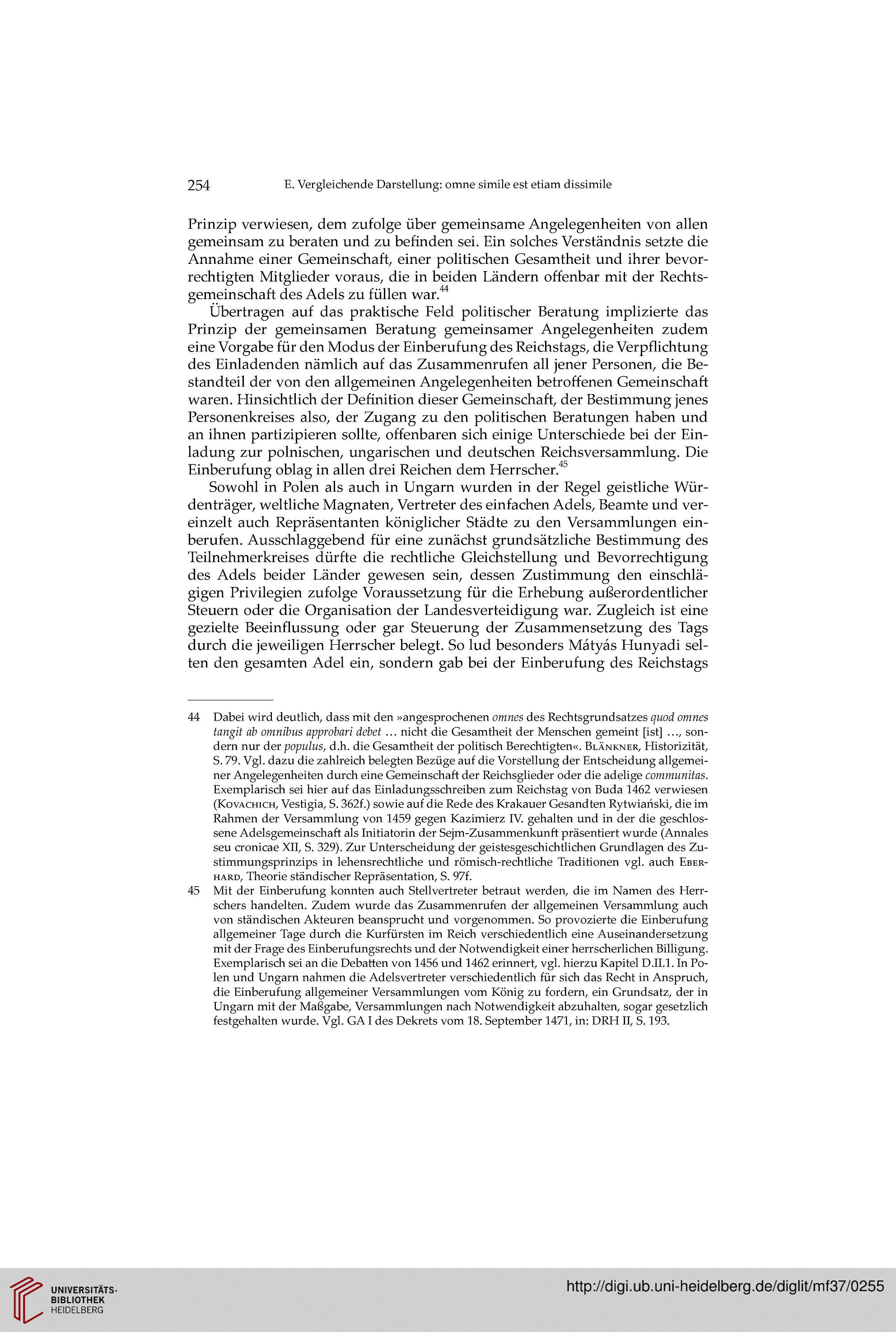254
E. Vergleichende Darstellung: omne simile est etiam dissimile
Prinzip verwiesen, dem zufolge über gemeinsame Angelegenheiten von allen
gemeinsam zu beraten und zu befinden sei. Ein solches Verständnis setzte die
Annahme einer Gemeinschaft, einer politischen Gesamtheit und ihrer bevor-
rechtigten Mitglieder voraus, die in beiden Ländern offenbar mit der Rechts-
gemeinschaft des Adels zu füllen war.^
Übertragen auf das praktische Feld politischer Beratung implizierte das
Prinzip der gemeinsamen Beratung gemeinsamer Angelegenheiten zudem
eine Vorgabe für den Modus der Einberufung des Reichstags, die Verpflichtung
des Einladenden nämlich auf das Zusammenrufen all jener Personen, die Be-
standteil der von den allgemeinen Angelegenheiten betroffenen Gemeinschaft
waren. Hinsichtlich der Definition dieser Gemeinschaft, der Bestimmung jenes
Personenkreises also, der Zugang zu den politischen Beratungen haben und
an ihnen partizipieren sollte, offenbaren sich einige Unterschiede bei der Ein-
ladung zur polnischen, ungarischen und deutschen Reichsversammlung. Die
Einberufung oblag in allen drei Reichen dem Herrscher.^
Sowohl in Polen als auch in Ungarn wurden in der Regel geistliche Wür-
denträger, weltliche Magnaten, Vertreter des einfachen Adels, Beamte und ver-
einzelt auch Repräsentanten königlicher Städte zu den Versammlungen ein-
berufen. Ausschlaggebend für eine zunächst grundsätzliche Bestimmung des
Teilnehmerkreises dürfte die rechtliche Gleichstellung und Bevorrechtigung
des Adels beider Länder gewesen sein, dessen Zustimmung den einschlä-
gigen Privilegien zufolge Voraussetzung für die Erhebung außerordentlicher
Steuern oder die Organisation der Landesverteidigung war. Zugleich ist eine
gezielte Beeinflussung oder gar Steuerung der Zusammensetzung des Tags
durch die jeweiligen Herrscher belegt. So lud besonders Mätyäs Hunyadi sel-
ten den gesamten Adel ein, sondern gab bei der Einberufung des Reichstags
44 Dabei wird deutlich, dass mit den »angesprochenen des Rechtsgrundsatzes owincs
fHMgh OmMS approiwr; ... nicht die Gesamtheit der Menschen gemeint [ist] ..., son-
dern nur der poprdMS, d.h. die Gesamtheit der politisch Berechtigten«. BLÄNKNER, Historizität,
S. 79. Vgl. dazu die zahlreich belegten Bezüge auf die Vorstellung der Entscheidung allgemei-
ner Angelegenheiten durch eine Gemeinschaft der Reichsglieder oder die adelige cowwMMhas.
Exemplarisch sei hier auf das Einladungsschreiben zum Reichstag von Buda 1462 verwiesen
(KovACHicH, Vestigia, S. 362f.) sowie auf die Rede des Krakauer Gesandten Rytwianski, die im
Rahmen der Versammlung von 1459 gegen Kazimierz IV. gehalten und in der die geschlos-
sene Adelsgemeinschaft als Initiatorin der Sejm-Zusammenkunft präsentiert wurde (Annales
seu cronicae XII, S. 329). Zur Unterscheidung der geistesgeschichtlichen Grundlagen des Zu-
stimmungsprinzips in lehensrechtliche und römisch-rechtliche Traditionen vgl. auch EBER-
HARD, Theorie ständischer Repräsentation, S. 97f.
45 Mit der Einberufung konnten auch Stellvertreter betraut werden, die im Namen des Herr-
schers handelten. Zudem wurde das Zusammenrufen der allgemeinen Versammlung auch
von ständischen Akteuren beansprucht und vorgenommen. So provozierte die Einberufung
allgemeiner Tage durch die Kurfürsten im Reich verschiedentlich eine Auseinandersetzung
mit der Frage des Einberufungsrechts und der Notwendigkeit einer herrscherlichen Billigung.
Exemplarisch sei an die Debatten von 1456 und 1462 erinnert, vgl. hierzu Kapitel D.11.1. In Po-
len und Ungarn nahmen die Adelsvertreter verschiedentlich für sich das Recht in Anspruch,
die Einberufung allgemeiner Versammlungen vom König zu fordern, ein Grundsatz, der in
Ungarn mit der Maßgabe, Versammlungen nach Notwendigkeit abzuhalten, sogar gesetzlich
festgehalten wurde. Vgl. GA I des Dekrets vom 18. September 1471, in: DRH II, S. 193.
E. Vergleichende Darstellung: omne simile est etiam dissimile
Prinzip verwiesen, dem zufolge über gemeinsame Angelegenheiten von allen
gemeinsam zu beraten und zu befinden sei. Ein solches Verständnis setzte die
Annahme einer Gemeinschaft, einer politischen Gesamtheit und ihrer bevor-
rechtigten Mitglieder voraus, die in beiden Ländern offenbar mit der Rechts-
gemeinschaft des Adels zu füllen war.^
Übertragen auf das praktische Feld politischer Beratung implizierte das
Prinzip der gemeinsamen Beratung gemeinsamer Angelegenheiten zudem
eine Vorgabe für den Modus der Einberufung des Reichstags, die Verpflichtung
des Einladenden nämlich auf das Zusammenrufen all jener Personen, die Be-
standteil der von den allgemeinen Angelegenheiten betroffenen Gemeinschaft
waren. Hinsichtlich der Definition dieser Gemeinschaft, der Bestimmung jenes
Personenkreises also, der Zugang zu den politischen Beratungen haben und
an ihnen partizipieren sollte, offenbaren sich einige Unterschiede bei der Ein-
ladung zur polnischen, ungarischen und deutschen Reichsversammlung. Die
Einberufung oblag in allen drei Reichen dem Herrscher.^
Sowohl in Polen als auch in Ungarn wurden in der Regel geistliche Wür-
denträger, weltliche Magnaten, Vertreter des einfachen Adels, Beamte und ver-
einzelt auch Repräsentanten königlicher Städte zu den Versammlungen ein-
berufen. Ausschlaggebend für eine zunächst grundsätzliche Bestimmung des
Teilnehmerkreises dürfte die rechtliche Gleichstellung und Bevorrechtigung
des Adels beider Länder gewesen sein, dessen Zustimmung den einschlä-
gigen Privilegien zufolge Voraussetzung für die Erhebung außerordentlicher
Steuern oder die Organisation der Landesverteidigung war. Zugleich ist eine
gezielte Beeinflussung oder gar Steuerung der Zusammensetzung des Tags
durch die jeweiligen Herrscher belegt. So lud besonders Mätyäs Hunyadi sel-
ten den gesamten Adel ein, sondern gab bei der Einberufung des Reichstags
44 Dabei wird deutlich, dass mit den »angesprochenen des Rechtsgrundsatzes owincs
fHMgh OmMS approiwr; ... nicht die Gesamtheit der Menschen gemeint [ist] ..., son-
dern nur der poprdMS, d.h. die Gesamtheit der politisch Berechtigten«. BLÄNKNER, Historizität,
S. 79. Vgl. dazu die zahlreich belegten Bezüge auf die Vorstellung der Entscheidung allgemei-
ner Angelegenheiten durch eine Gemeinschaft der Reichsglieder oder die adelige cowwMMhas.
Exemplarisch sei hier auf das Einladungsschreiben zum Reichstag von Buda 1462 verwiesen
(KovACHicH, Vestigia, S. 362f.) sowie auf die Rede des Krakauer Gesandten Rytwianski, die im
Rahmen der Versammlung von 1459 gegen Kazimierz IV. gehalten und in der die geschlos-
sene Adelsgemeinschaft als Initiatorin der Sejm-Zusammenkunft präsentiert wurde (Annales
seu cronicae XII, S. 329). Zur Unterscheidung der geistesgeschichtlichen Grundlagen des Zu-
stimmungsprinzips in lehensrechtliche und römisch-rechtliche Traditionen vgl. auch EBER-
HARD, Theorie ständischer Repräsentation, S. 97f.
45 Mit der Einberufung konnten auch Stellvertreter betraut werden, die im Namen des Herr-
schers handelten. Zudem wurde das Zusammenrufen der allgemeinen Versammlung auch
von ständischen Akteuren beansprucht und vorgenommen. So provozierte die Einberufung
allgemeiner Tage durch die Kurfürsten im Reich verschiedentlich eine Auseinandersetzung
mit der Frage des Einberufungsrechts und der Notwendigkeit einer herrscherlichen Billigung.
Exemplarisch sei an die Debatten von 1456 und 1462 erinnert, vgl. hierzu Kapitel D.11.1. In Po-
len und Ungarn nahmen die Adelsvertreter verschiedentlich für sich das Recht in Anspruch,
die Einberufung allgemeiner Versammlungen vom König zu fordern, ein Grundsatz, der in
Ungarn mit der Maßgabe, Versammlungen nach Notwendigkeit abzuhalten, sogar gesetzlich
festgehalten wurde. Vgl. GA I des Dekrets vom 18. September 1471, in: DRH II, S. 193.