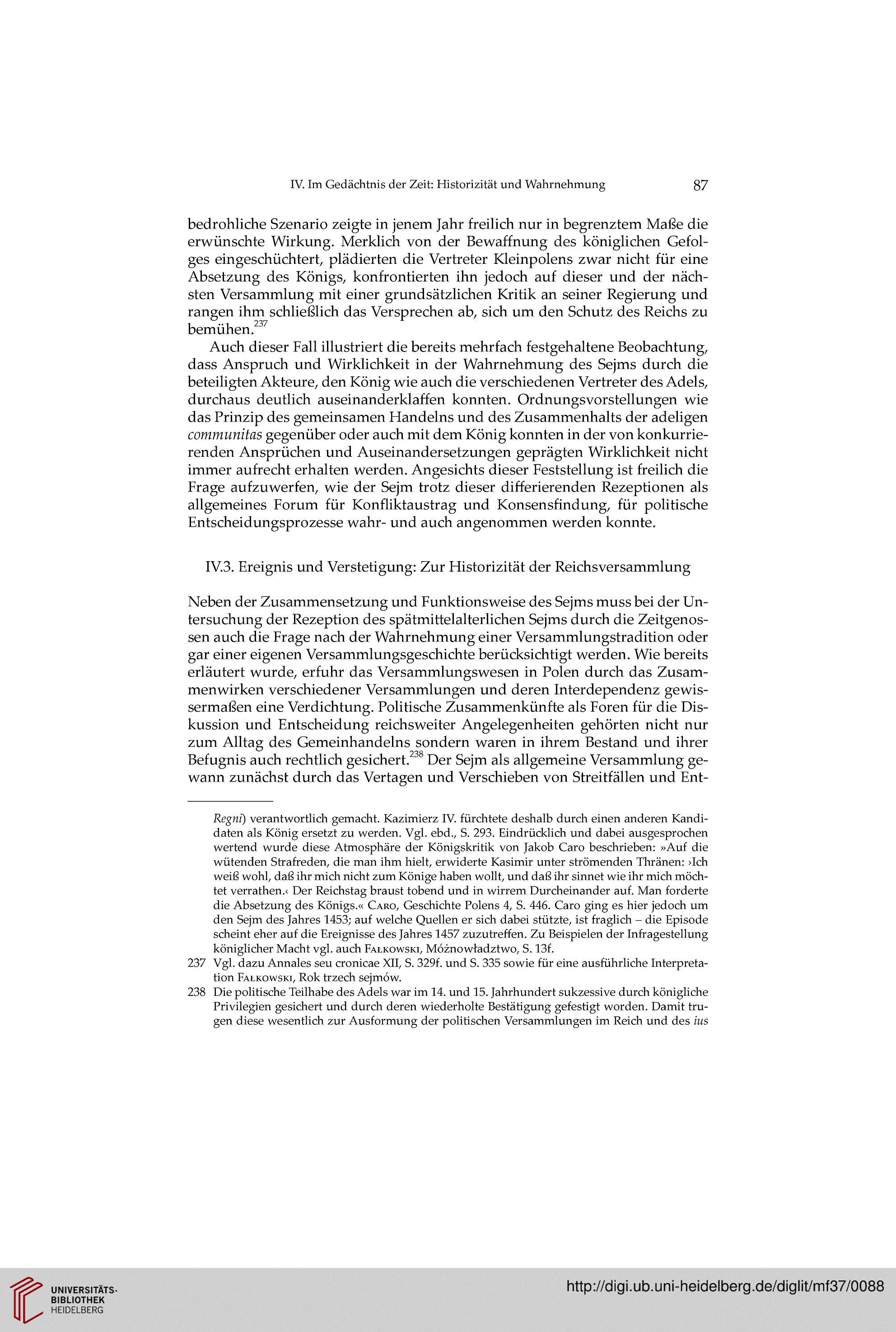IV. Im Gedächtnis der Zeit: Historizität und Wahrnehmung
87
bedrohliche Szenario zeigte in jenem Jahr freilich nur in begrenztem Maße die
erwünschte Wirkung. Merklich von der Bewaffnung des königlichen Gefol-
ges eingeschüchtert, plädierten die Vertreter Kleinpolens zwar nicht für eine
Absetzung des Königs, konfrontierten ihn jedoch auf dieser und der näch-
sten Versammlung mit einer grundsätzlichen Kritik an seiner Regierung und
rangen ihm schließlich das Versprechen ab, sich um den Schutz des Reichs zu
bemühen.^
Auch dieser Fall illustriert die bereits mehrfach festgehaltene Beobachtung,
dass Anspruch und Wirklichkeit in der Wahrnehmung des Sejms durch die
beteiligten Akteure, den König wie auch die verschiedenen Vertreter des Adels,
durchaus deutlich auseinanderklaffen konnten. OrdnungsVorstellungen wie
das Prinzip des gemeinsamen Handelns und des Zusammenhalts der adeligen
commMmhzs gegenüber oder auch mit dem König konnten in der von konkurrie-
renden Ansprüchen und Auseinandersetzungen geprägten Wirklichkeit nicht
immer aufrecht erhalten werden. Angesichts dieser Feststellung ist freilich die
Frage aufzuwerfen, wie der Sejm trotz dieser differierenden Rezeptionen als
allgemeines Forum für Konfhktaustrag und Konsensfindung, für politische
Entscheidungsprozesse wahr- und auch angenommen werden konnte.
IV.3. Ereignis und Verstetigung: Zur Historizität der Reichsversammlung
Neben der Zusammensetzung und Funktionsweise des Sejms muss bei der Un-
tersuchung der Rezeption des spätmittelalterlichen Sejms durch die Zeitgenos-
sen auch die Frage nach der Wahrnehmung einer Versammlungstradition oder
gar einer eigenen Versammlungsgeschichte berücksichtigt werden. Wie bereits
erläutert wurde, erfuhr das Versammlungswesen in Polen durch das Zusam-
menwirken verschiedener Versammlungen und deren Interdependenz gewis-
sermaßen eine Verdichtung. Politische Zusammenkünfte als Foren für die Dis-
kussion und Entscheidung reichsweiter Angelegenheiten gehörten nicht nur
zum Alltag des Gemeinhandelns sondern waren in ihrem Bestand und ihrer
Befugnis auch rechtlich gesichert.^ Der Sejm als allgemeine Versammlung ge-
wann zunächst durch das Vertagen und Verschieben von Streitfällen und Ent-
Rcgm') verantwortlich gemacht. Kazimierz IV. fürchtete deshalb durch einen anderen Kandi-
daten als König ersetzt zu werden. Vgl. ebd., S. 293. Eindrücklich und dabei ausgesprochen
wertend wurde diese Atmosphäre der Königskritik von Jakob Caro beschrieben: »Auf die
wütenden Strafreden, die man ihm hielt, erwiderte Kasimir unter strömenden Thränen: >Ich
weiß wohl, daß ihr mich nicht zum Könige haben wollt, und daß ihr sinnet wie ihr mich möch-
tet verrathen.< Der Reichstag braust tobend und in wirrem Durcheinander auf. Man forderte
die Absetzung des Königs.« CARO, Geschichte Polens 4, S. 446. Caro ging es hier jedoch um
den Sejm des Jahres 1453; auf welche Quellen er sich dabei stützte, ist fraglich - die Episode
scheint eher auf die Ereignisse des Jahres 1457 zuzutreffen. Zu Beispielen der Infragestellung
königlicher Macht vgl. auch FALKOwsKi, Möznowladztwo, S. 13f.
237 Vgl. dazu Annales seu cronicae XII, S. 329f. und S. 335 sowie für eine ausführliche Interpreta-
tion FALKOwsKi, Rok trzech sejmöw.
238 Die politische Teilhabe des Adels war im 14. und 15. Jahrhundert sukzessive durch königliche
Privilegien gesichert und durch deren wiederholte Bestätigung gefestigt worden. Damit tru-
gen diese wesentlich zur Ausformung der politischen Versammlungen im Reich und des ins
87
bedrohliche Szenario zeigte in jenem Jahr freilich nur in begrenztem Maße die
erwünschte Wirkung. Merklich von der Bewaffnung des königlichen Gefol-
ges eingeschüchtert, plädierten die Vertreter Kleinpolens zwar nicht für eine
Absetzung des Königs, konfrontierten ihn jedoch auf dieser und der näch-
sten Versammlung mit einer grundsätzlichen Kritik an seiner Regierung und
rangen ihm schließlich das Versprechen ab, sich um den Schutz des Reichs zu
bemühen.^
Auch dieser Fall illustriert die bereits mehrfach festgehaltene Beobachtung,
dass Anspruch und Wirklichkeit in der Wahrnehmung des Sejms durch die
beteiligten Akteure, den König wie auch die verschiedenen Vertreter des Adels,
durchaus deutlich auseinanderklaffen konnten. OrdnungsVorstellungen wie
das Prinzip des gemeinsamen Handelns und des Zusammenhalts der adeligen
commMmhzs gegenüber oder auch mit dem König konnten in der von konkurrie-
renden Ansprüchen und Auseinandersetzungen geprägten Wirklichkeit nicht
immer aufrecht erhalten werden. Angesichts dieser Feststellung ist freilich die
Frage aufzuwerfen, wie der Sejm trotz dieser differierenden Rezeptionen als
allgemeines Forum für Konfhktaustrag und Konsensfindung, für politische
Entscheidungsprozesse wahr- und auch angenommen werden konnte.
IV.3. Ereignis und Verstetigung: Zur Historizität der Reichsversammlung
Neben der Zusammensetzung und Funktionsweise des Sejms muss bei der Un-
tersuchung der Rezeption des spätmittelalterlichen Sejms durch die Zeitgenos-
sen auch die Frage nach der Wahrnehmung einer Versammlungstradition oder
gar einer eigenen Versammlungsgeschichte berücksichtigt werden. Wie bereits
erläutert wurde, erfuhr das Versammlungswesen in Polen durch das Zusam-
menwirken verschiedener Versammlungen und deren Interdependenz gewis-
sermaßen eine Verdichtung. Politische Zusammenkünfte als Foren für die Dis-
kussion und Entscheidung reichsweiter Angelegenheiten gehörten nicht nur
zum Alltag des Gemeinhandelns sondern waren in ihrem Bestand und ihrer
Befugnis auch rechtlich gesichert.^ Der Sejm als allgemeine Versammlung ge-
wann zunächst durch das Vertagen und Verschieben von Streitfällen und Ent-
Rcgm') verantwortlich gemacht. Kazimierz IV. fürchtete deshalb durch einen anderen Kandi-
daten als König ersetzt zu werden. Vgl. ebd., S. 293. Eindrücklich und dabei ausgesprochen
wertend wurde diese Atmosphäre der Königskritik von Jakob Caro beschrieben: »Auf die
wütenden Strafreden, die man ihm hielt, erwiderte Kasimir unter strömenden Thränen: >Ich
weiß wohl, daß ihr mich nicht zum Könige haben wollt, und daß ihr sinnet wie ihr mich möch-
tet verrathen.< Der Reichstag braust tobend und in wirrem Durcheinander auf. Man forderte
die Absetzung des Königs.« CARO, Geschichte Polens 4, S. 446. Caro ging es hier jedoch um
den Sejm des Jahres 1453; auf welche Quellen er sich dabei stützte, ist fraglich - die Episode
scheint eher auf die Ereignisse des Jahres 1457 zuzutreffen. Zu Beispielen der Infragestellung
königlicher Macht vgl. auch FALKOwsKi, Möznowladztwo, S. 13f.
237 Vgl. dazu Annales seu cronicae XII, S. 329f. und S. 335 sowie für eine ausführliche Interpreta-
tion FALKOwsKi, Rok trzech sejmöw.
238 Die politische Teilhabe des Adels war im 14. und 15. Jahrhundert sukzessive durch königliche
Privilegien gesichert und durch deren wiederholte Bestätigung gefestigt worden. Damit tru-
gen diese wesentlich zur Ausformung der politischen Versammlungen im Reich und des ins