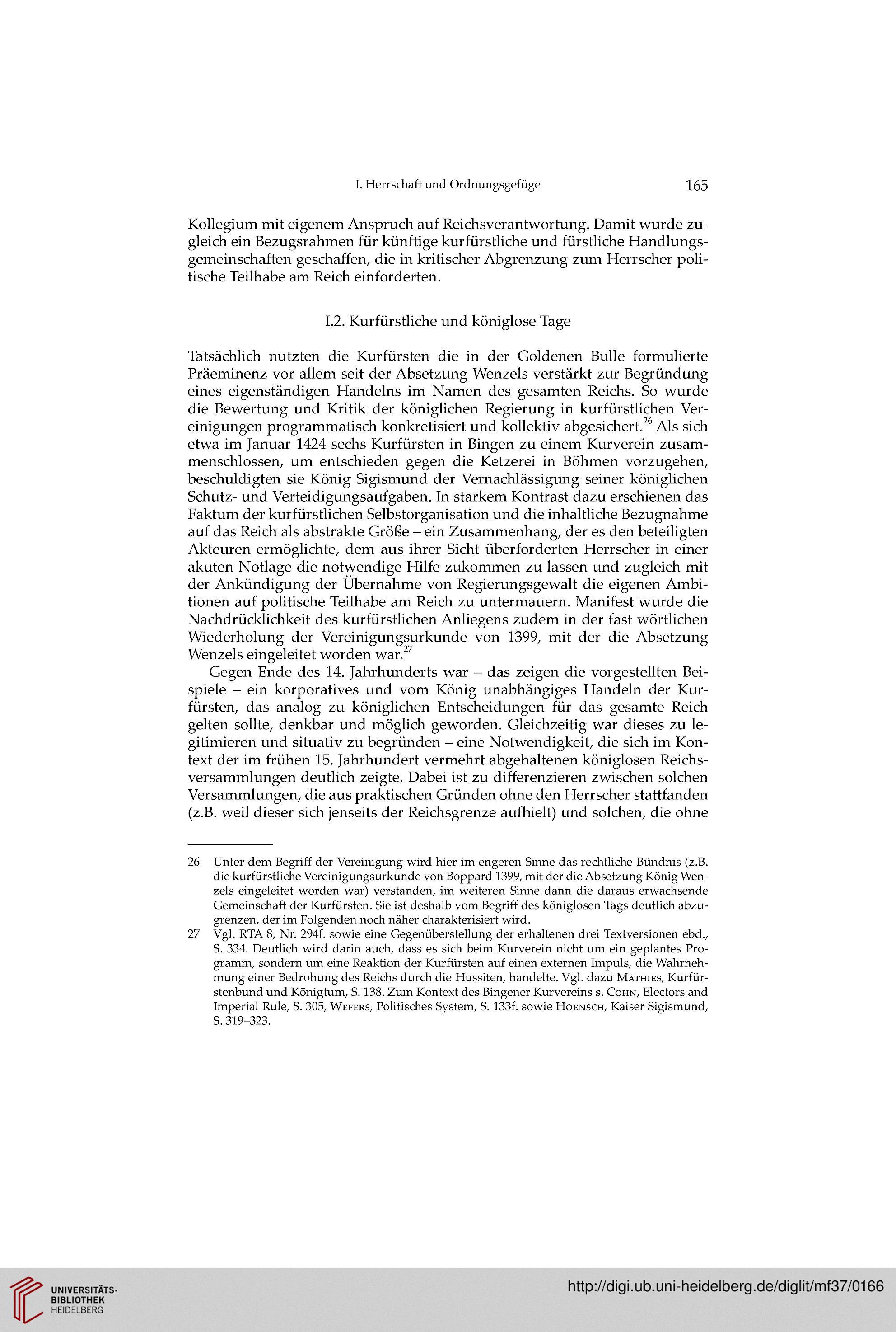I. Herrschaft und Ordnungsgefüge
165
Kollegium mit eigenem Anspruch auf Reichsverantwortung. Damit wurde zu-
gleich ein Bezugsrahmen für künftige kurfürstliche und fürstliche Handlungs-
gemeinschaften geschaffen, die in kritischer Abgrenzung zum Herrscher poli-
tische Teilhabe am Reich einforderten.
1.2. Kurfürstliche und königlose Tage
Tatsächlich nutzten die Kurfürsten die in der Goldenen Bulle formulierte
Präeminenz vor allem seit der Absetzung Wenzels verstärkt zur Begründung
eines eigenständigen Handelns im Namen des gesamten Reichs. So wurde
die Bewertung und Kritik der königlichen Regierung in kurfürstlichen Ver-
einigungen programmatisch konkretisiert und kollektiv abgesichert.Als sich
etwa im Januar 1424 sechs Kurfürsten in Bingen zu einem Kurverein zusam-
menschlossen, um entschieden gegen die Ketzerei in Böhmen vorzugehen,
beschuldigten sie König Sigismund der Vernachlässigung seiner königlichen
Schutz- und Verteidigungsaufgaben. In starkem Kontrast dazu erschienen das
Faktum der kurfürstlichen Selbstorganisation und die inhaltliche Bezugnahme
auf das Reich als abstrakte Größe - ein Zusammenhang, der es den beteiligten
Akteuren ermöglichte, dem aus ihrer Sicht überforderten Herrscher in einer
akuten Notlage die notwendige Hilfe zukommen zu lassen und zugleich mit
der Ankündigung der Übernahme von Regierungsgewalt die eigenen Ambi-
tionen auf politische Teilhabe am Reich zu untermauern. Manifest wurde die
Nachdrücklichkeit des kurfürstlichen Anliegens zudem in der fast wörtlichen
Wiederholung der Vereinigungsurkunde von 1399, mit der die Absetzung
Wenzels eingeleitet worden warü
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts war - das zeigen die vorgestellten Bei-
spiele - ein korporatives und vom König unabhängiges Handeln der Kur-
fürsten, das analog zu königlichen Entscheidungen für das gesamte Reich
gelten sollte, denkbar und möglich geworden. Gleichzeitig war dieses zu le-
gitimieren und situativ zu begründen - eine Notwendigkeit, die sich im Kon-
text der im frühen 15. Jahrhundert vermehrt abgehaltenen königlosen Reichs-
versammlungen deutlich zeigte. Dabei ist zu differenzieren zwischen solchen
Versammlungen, die aus praktischen Gründen ohne den Herrscher stattfanden
(z.B. weil dieser sich jenseits der Reichsgrenze aufhielt) und solchen, die ohne
26 Unter dem Begriff der Vereinigung wird hier im engeren Sinne das rechtliche Bündnis (z.B.
die kurfürstliche Vereinigungsurkunde von Boppard 1399, mit der die Absetzung König Wen-
zels eingeleitet worden war) verstanden, im weiteren Sinne dann die daraus erwachsende
Gemeinschaft der Kurfürsten. Sie ist deshalb vom Begriff des königlosen Tags deutlich abzu-
grenzen, der im Folgenden noch näher charakterisiert wird.
27 Vgl. RTA 8, Nr. 294f. sowie eine Gegenüberstellung der erhaltenen drei Textversionen ebd.,
S. 334. Deutlich wird darin auch, dass es sich beim Kurverein nicht um ein geplantes Pro-
gramm, sondern um eine Reaktion der Kurfürsten auf einen externen Impuls, die Wahrneh-
mung einer Bedrohung des Reichs durch die Hussiten, handelte. Vgl. dazu MATHiES, Kurfür-
stenbund und Königtum, S. 138. Zum Kontext des Bingener Kurvereins s. CoHN, Electors and
Imperial Rule, S. 305, WEFERS, Politisches System, S. 133f. sowie HoENSCH, Kaiser Sigismund,
S.319-323.
165
Kollegium mit eigenem Anspruch auf Reichsverantwortung. Damit wurde zu-
gleich ein Bezugsrahmen für künftige kurfürstliche und fürstliche Handlungs-
gemeinschaften geschaffen, die in kritischer Abgrenzung zum Herrscher poli-
tische Teilhabe am Reich einforderten.
1.2. Kurfürstliche und königlose Tage
Tatsächlich nutzten die Kurfürsten die in der Goldenen Bulle formulierte
Präeminenz vor allem seit der Absetzung Wenzels verstärkt zur Begründung
eines eigenständigen Handelns im Namen des gesamten Reichs. So wurde
die Bewertung und Kritik der königlichen Regierung in kurfürstlichen Ver-
einigungen programmatisch konkretisiert und kollektiv abgesichert.Als sich
etwa im Januar 1424 sechs Kurfürsten in Bingen zu einem Kurverein zusam-
menschlossen, um entschieden gegen die Ketzerei in Böhmen vorzugehen,
beschuldigten sie König Sigismund der Vernachlässigung seiner königlichen
Schutz- und Verteidigungsaufgaben. In starkem Kontrast dazu erschienen das
Faktum der kurfürstlichen Selbstorganisation und die inhaltliche Bezugnahme
auf das Reich als abstrakte Größe - ein Zusammenhang, der es den beteiligten
Akteuren ermöglichte, dem aus ihrer Sicht überforderten Herrscher in einer
akuten Notlage die notwendige Hilfe zukommen zu lassen und zugleich mit
der Ankündigung der Übernahme von Regierungsgewalt die eigenen Ambi-
tionen auf politische Teilhabe am Reich zu untermauern. Manifest wurde die
Nachdrücklichkeit des kurfürstlichen Anliegens zudem in der fast wörtlichen
Wiederholung der Vereinigungsurkunde von 1399, mit der die Absetzung
Wenzels eingeleitet worden warü
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts war - das zeigen die vorgestellten Bei-
spiele - ein korporatives und vom König unabhängiges Handeln der Kur-
fürsten, das analog zu königlichen Entscheidungen für das gesamte Reich
gelten sollte, denkbar und möglich geworden. Gleichzeitig war dieses zu le-
gitimieren und situativ zu begründen - eine Notwendigkeit, die sich im Kon-
text der im frühen 15. Jahrhundert vermehrt abgehaltenen königlosen Reichs-
versammlungen deutlich zeigte. Dabei ist zu differenzieren zwischen solchen
Versammlungen, die aus praktischen Gründen ohne den Herrscher stattfanden
(z.B. weil dieser sich jenseits der Reichsgrenze aufhielt) und solchen, die ohne
26 Unter dem Begriff der Vereinigung wird hier im engeren Sinne das rechtliche Bündnis (z.B.
die kurfürstliche Vereinigungsurkunde von Boppard 1399, mit der die Absetzung König Wen-
zels eingeleitet worden war) verstanden, im weiteren Sinne dann die daraus erwachsende
Gemeinschaft der Kurfürsten. Sie ist deshalb vom Begriff des königlosen Tags deutlich abzu-
grenzen, der im Folgenden noch näher charakterisiert wird.
27 Vgl. RTA 8, Nr. 294f. sowie eine Gegenüberstellung der erhaltenen drei Textversionen ebd.,
S. 334. Deutlich wird darin auch, dass es sich beim Kurverein nicht um ein geplantes Pro-
gramm, sondern um eine Reaktion der Kurfürsten auf einen externen Impuls, die Wahrneh-
mung einer Bedrohung des Reichs durch die Hussiten, handelte. Vgl. dazu MATHiES, Kurfür-
stenbund und Königtum, S. 138. Zum Kontext des Bingener Kurvereins s. CoHN, Electors and
Imperial Rule, S. 305, WEFERS, Politisches System, S. 133f. sowie HoENSCH, Kaiser Sigismund,
S.319-323.