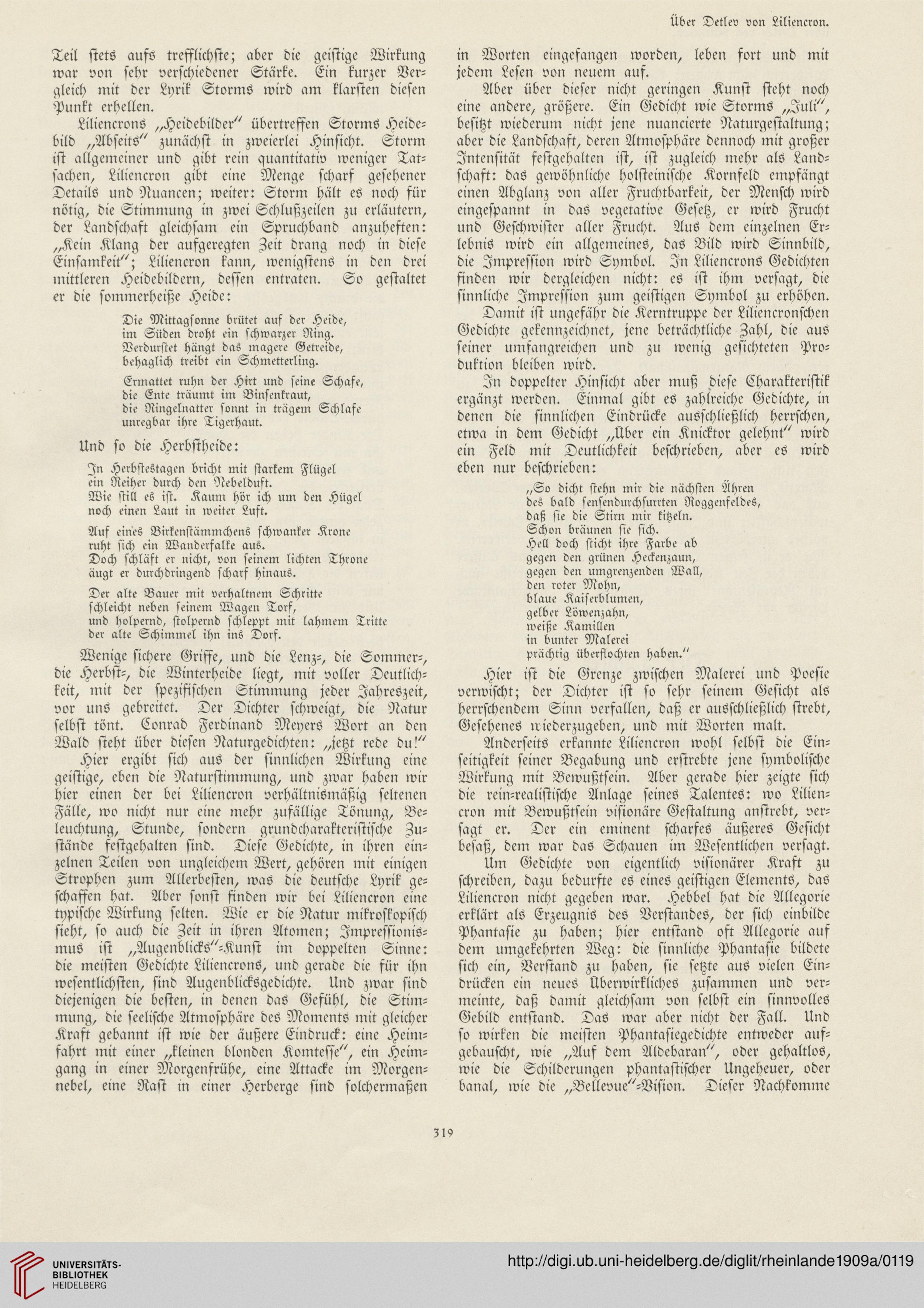Übcr Detlev von Liliencron.
Teil ftets aufs trefflichfte; aber die geistige Wirkung
war von sehr verschiedener Stärke. Ein kürzer Ver-
gleich mit der Lyrik Storms wird am klarstcn dicsen
Punkt erhellen.
Liliencrons „Heidebilder" übertreffen Storms Heide-
bild „Abseits" zunächft in zweierlei Hinsicht. Storm
ist allgemcincr und gibt rein quantitativ weniger Tat-
sachen, Liliencron gibt cine Menge schars gesehener
Details und Nuancen; weiter: Storm hält eS noch für
nötig, die Stimmung in zwei Schlußzeilen zu erläutern,
der Landschaft gleichsam ein Spruchband anzuhesten:
„Kein Klang der ausgercgten Zeit drang noch in diese
Einsamkeil"; Liliencron kann, wenigftens in den drei
mittleren Heidebildern, dessen entratcn. So gestaltet
er die sommerhciße Heide:
Die Mittagsonne brütct auf der Heide,
im Siiden droht ein schwarzer Ring.
Verdurstet hängt das magcre Getrcide,
behaglich treibt ein Schmetterling.
Crmattct ruhn dcr Hirt und seine Schafc,
die Ente träumt im Binsenkraut,
die Ringclnatter sonnt in trägem Schlafe
unregbar ihre Tigerhaut.
Und so die Herbstheide:
Jn Herbstestagcn bricht mit starkem Flügel
ein Reiher durch dcn Nebelduft.
Wie still es ist. Kaum hör ich um den Hügcl
noch einen Laut in weiter Luft.
A»f eines Birkcnstämmchens schwanker Kronc
ruht sich ein Wanderfalke aus.
Doch schläft er nicht, von seinem lichten Throne
äugt er durchdringend scharf hinaus.
Der alte Bauer mit verhaltnem Schritte
schleicht neben seinem Wagen Torf,
und holpcrnd, stolpcrnd schleppt mit lahmem Trittc
der alte Schimmel ihn ins Dorf.
Wenige sichere Griffe, und die Lenz-, die Sommer-,
die Herbft-, die Winterheide liegt, mit voller Deutlich-
keit, mit der spezifischen Stimmung jeder Jahreszeit,
vor uns gebreitet. Der Dichter schweigt, die Natur
selbst tönt. Conrad Ferdinand Meyers Wort an den
Wald stebt über diesen Naturgedichten: „jetzt rede du!"
Hier ergibt sich aus der sinnlichen Wirküng eine
geistige, eben die Naturstimmung, und zwar haben wir
hier einen dcr bei Liliencron verhältnismäßig seltenen
Fälle, wo nicht nur cine mehr zusällige Tönung, Be-
leuchtung, Stunde, sondern grundcharakteriftische Zu-
stände sestgehalten sind. Diese Gedichte, in ihren ein-
zelnen Teilen von ungleichem Wert, gehören mit einigen
Strophen zum Allerbesten, was die deutsche Lyrik ge-
schaffen hat. Aber sonst finden wir bei Liliencron eine
typische Wirküng selten. Wie er die Natur mikroskopisch
sieht, so auch die Ieit in ihren Atomen; Jmpressionis-
muö ift „Augenblicks"-Kunft im doppelten Sinne:
die meisten Gedichte Liliencrons, und gerade die sür ihn
wesentlichsten, sind Augenblicksgedichte. Und zwar sind
dicjenigen die besten, in denen das Gefühl, die Stim-
mung, die seelische Atmosphäre des Moments mit gleicher
Kraft gebannt ist wie der äußere Eindruck: eine Heini-
sahrt mit einer „kleinen blonden Komtesse", ein Heim-
gang in einer Morgenfrühe, eine Attacke im Morgen-
nebel, eine Rast in einer Herberge sind solchermaßen
in Worten eingcfangen worden, leben sort und mit
jedem Lesen von neucm auf.
Aber über dieser nicht gcringen Kunst steht noch
eine andere, größere. Ein Gedicht wie Storms „Juli",
besitzt wiederum nicht jene nuancierte Naturgeftaltung;
aber die Landschast, deren Atmosphäre dennoch mit großer
Jntensität sestgehalten ist, ist zugleich mehr als Land-
schast: das gewöhnliche holsteinische Kornseld empsängt
eincn Abglanz von aller Fruchtbarkcit, der Mensch wird
eingespannt in das vcgetative Gesetz, er wird Frucht
und Geschwister aller Frucht. Auö dcm cinzelnen Er-
lebnis wird ein allgemeines, das Bild wird Sinnbild,
die Jmpression wird Symbol. Jn LiliencronS Gedichten
finden wir dergleichen nicht: es ist ihm versagt, die
sinnliche Jmpression zum geistigen Symbol zu erhöhen.
Damit ist ungefahr die Kerntruppe der Lilicncronschen
Gedichte gekennzeichnct, jene beträchtliche Zahl, die aus
seiner umfangreichen und zu wcnig gesichteten Pro-
duktion bleiben wird.
Jn doppelter Hinsicht aber muß diese Charaktcriftik
ergänzt werden. Einmal gibt eö zahlreiche Gedichte, in
dencn die sinnlichen Eindrücke ausschließlich herrschen,
etwa in dem Gedicht „llber ein Knicktor gelehnt" wird
ein Feld mit Deutlichkeit beschrieben, aber es wird
eben nur bcschricben:
„So dicht stehn mir die nächsten Ähren
dcs bald sensendurchsurrten Roggenfeldes,
daß sie die Stirn mir kitzeln.
Schon bräunen sie sich.
Hell doch sticht ihre Farbc ab
gegen den grüncn Heckenzaun,
gegen den umgrenzenden Wall,
den roter Mohn,
blaue Kaiserblumen,
gelber Löwenzahn,
weiße Kamillen
in bunter Malerei
prächtig überflochten haben."
Hier ift die Grcnze zwischen Malerei und Poesie
vcrwischt; der Dichter ist so sehr seincm Gesicht als
herrschendcm Sinn verfatlen, daß er auöschließlich strebt,
Gesehenes iriederzugeben, und mit Worten malt.
Anderseits erkannte Liliencron wohl selbst die Ein-
seitigkeit seincr Begabung und erstrebte jene symbolische
Wirküng mit Bcwußtscin. Aber gerade hier zeigte sich
die rein-realistische Anlage seines Talcnteö: wo Lilien-
cron mit Bewußtsein visionäre Gestaltung anstrebt, ver-
sagt er. Der ein eminent scharfeö äußeres Gesicht
besaß, dem war daS Schauen im Wesentlichen versagt.
Um Gedichte von eigentlich visionärer Kraft zu
schreibcn, dazu bedurfte eö eines geistigcn Elemcnts, daS
Liliencron nicht gcgeben war. Hebbcl hat die Allcgorie
erklärt alö Erzeugnis des Verstandcs, der sich einbilde
Phantasie zu haben; hicr entftand oft Allegorie aus
dem umgekehrten Weg: die sinnliche Phantasie bildcte
sich ein, Vcrstand zu habcn, sie setzte auö vielen Ein-
drücken ein neues Überwirk'liches zusammen und ver-
meinte, daß damit gleichsam von selbst ein sinnvolleö
Gebild entstand. Das war aber nicht der Fall. Und
so wirken die meisten Phantasiegedichte entweder aus-
gebauscht, wie „Aus dem Aldebaran", oder gehaltlos,
wie die Schildcrungen phantastischer Ungeheuer, oder
banal, wie die „Bellevue"-Vision. Dieser Nachkomme
Teil ftets aufs trefflichfte; aber die geistige Wirkung
war von sehr verschiedener Stärke. Ein kürzer Ver-
gleich mit der Lyrik Storms wird am klarstcn dicsen
Punkt erhellen.
Liliencrons „Heidebilder" übertreffen Storms Heide-
bild „Abseits" zunächft in zweierlei Hinsicht. Storm
ist allgemcincr und gibt rein quantitativ weniger Tat-
sachen, Liliencron gibt cine Menge schars gesehener
Details und Nuancen; weiter: Storm hält eS noch für
nötig, die Stimmung in zwei Schlußzeilen zu erläutern,
der Landschaft gleichsam ein Spruchband anzuhesten:
„Kein Klang der ausgercgten Zeit drang noch in diese
Einsamkeil"; Liliencron kann, wenigftens in den drei
mittleren Heidebildern, dessen entratcn. So gestaltet
er die sommerhciße Heide:
Die Mittagsonne brütct auf der Heide,
im Siiden droht ein schwarzer Ring.
Verdurstet hängt das magcre Getrcide,
behaglich treibt ein Schmetterling.
Crmattct ruhn dcr Hirt und seine Schafc,
die Ente träumt im Binsenkraut,
die Ringclnatter sonnt in trägem Schlafe
unregbar ihre Tigerhaut.
Und so die Herbstheide:
Jn Herbstestagcn bricht mit starkem Flügel
ein Reiher durch dcn Nebelduft.
Wie still es ist. Kaum hör ich um den Hügcl
noch einen Laut in weiter Luft.
A»f eines Birkcnstämmchens schwanker Kronc
ruht sich ein Wanderfalke aus.
Doch schläft er nicht, von seinem lichten Throne
äugt er durchdringend scharf hinaus.
Der alte Bauer mit verhaltnem Schritte
schleicht neben seinem Wagen Torf,
und holpcrnd, stolpcrnd schleppt mit lahmem Trittc
der alte Schimmel ihn ins Dorf.
Wenige sichere Griffe, und die Lenz-, die Sommer-,
die Herbft-, die Winterheide liegt, mit voller Deutlich-
keit, mit der spezifischen Stimmung jeder Jahreszeit,
vor uns gebreitet. Der Dichter schweigt, die Natur
selbst tönt. Conrad Ferdinand Meyers Wort an den
Wald stebt über diesen Naturgedichten: „jetzt rede du!"
Hier ergibt sich aus der sinnlichen Wirküng eine
geistige, eben die Naturstimmung, und zwar haben wir
hier einen dcr bei Liliencron verhältnismäßig seltenen
Fälle, wo nicht nur cine mehr zusällige Tönung, Be-
leuchtung, Stunde, sondern grundcharakteriftische Zu-
stände sestgehalten sind. Diese Gedichte, in ihren ein-
zelnen Teilen von ungleichem Wert, gehören mit einigen
Strophen zum Allerbesten, was die deutsche Lyrik ge-
schaffen hat. Aber sonst finden wir bei Liliencron eine
typische Wirküng selten. Wie er die Natur mikroskopisch
sieht, so auch die Ieit in ihren Atomen; Jmpressionis-
muö ift „Augenblicks"-Kunft im doppelten Sinne:
die meisten Gedichte Liliencrons, und gerade die sür ihn
wesentlichsten, sind Augenblicksgedichte. Und zwar sind
dicjenigen die besten, in denen das Gefühl, die Stim-
mung, die seelische Atmosphäre des Moments mit gleicher
Kraft gebannt ist wie der äußere Eindruck: eine Heini-
sahrt mit einer „kleinen blonden Komtesse", ein Heim-
gang in einer Morgenfrühe, eine Attacke im Morgen-
nebel, eine Rast in einer Herberge sind solchermaßen
in Worten eingcfangen worden, leben sort und mit
jedem Lesen von neucm auf.
Aber über dieser nicht gcringen Kunst steht noch
eine andere, größere. Ein Gedicht wie Storms „Juli",
besitzt wiederum nicht jene nuancierte Naturgeftaltung;
aber die Landschast, deren Atmosphäre dennoch mit großer
Jntensität sestgehalten ist, ist zugleich mehr als Land-
schast: das gewöhnliche holsteinische Kornseld empsängt
eincn Abglanz von aller Fruchtbarkcit, der Mensch wird
eingespannt in das vcgetative Gesetz, er wird Frucht
und Geschwister aller Frucht. Auö dcm cinzelnen Er-
lebnis wird ein allgemeines, das Bild wird Sinnbild,
die Jmpression wird Symbol. Jn LiliencronS Gedichten
finden wir dergleichen nicht: es ist ihm versagt, die
sinnliche Jmpression zum geistigen Symbol zu erhöhen.
Damit ist ungefahr die Kerntruppe der Lilicncronschen
Gedichte gekennzeichnct, jene beträchtliche Zahl, die aus
seiner umfangreichen und zu wcnig gesichteten Pro-
duktion bleiben wird.
Jn doppelter Hinsicht aber muß diese Charaktcriftik
ergänzt werden. Einmal gibt eö zahlreiche Gedichte, in
dencn die sinnlichen Eindrücke ausschließlich herrschen,
etwa in dem Gedicht „llber ein Knicktor gelehnt" wird
ein Feld mit Deutlichkeit beschrieben, aber es wird
eben nur bcschricben:
„So dicht stehn mir die nächsten Ähren
dcs bald sensendurchsurrten Roggenfeldes,
daß sie die Stirn mir kitzeln.
Schon bräunen sie sich.
Hell doch sticht ihre Farbc ab
gegen den grüncn Heckenzaun,
gegen den umgrenzenden Wall,
den roter Mohn,
blaue Kaiserblumen,
gelber Löwenzahn,
weiße Kamillen
in bunter Malerei
prächtig überflochten haben."
Hier ift die Grcnze zwischen Malerei und Poesie
vcrwischt; der Dichter ist so sehr seincm Gesicht als
herrschendcm Sinn verfatlen, daß er auöschließlich strebt,
Gesehenes iriederzugeben, und mit Worten malt.
Anderseits erkannte Liliencron wohl selbst die Ein-
seitigkeit seincr Begabung und erstrebte jene symbolische
Wirküng mit Bcwußtscin. Aber gerade hier zeigte sich
die rein-realistische Anlage seines Talcnteö: wo Lilien-
cron mit Bewußtsein visionäre Gestaltung anstrebt, ver-
sagt er. Der ein eminent scharfeö äußeres Gesicht
besaß, dem war daS Schauen im Wesentlichen versagt.
Um Gedichte von eigentlich visionärer Kraft zu
schreibcn, dazu bedurfte eö eines geistigcn Elemcnts, daS
Liliencron nicht gcgeben war. Hebbcl hat die Allcgorie
erklärt alö Erzeugnis des Verstandcs, der sich einbilde
Phantasie zu haben; hicr entftand oft Allegorie aus
dem umgekehrten Weg: die sinnliche Phantasie bildcte
sich ein, Vcrstand zu habcn, sie setzte auö vielen Ein-
drücken ein neues Überwirk'liches zusammen und ver-
meinte, daß damit gleichsam von selbst ein sinnvolleö
Gebild entstand. Das war aber nicht der Fall. Und
so wirken die meisten Phantasiegedichte entweder aus-
gebauscht, wie „Aus dem Aldebaran", oder gehaltlos,
wie die Schildcrungen phantastischer Ungeheuer, oder
banal, wie die „Bellevue"-Vision. Dieser Nachkomme