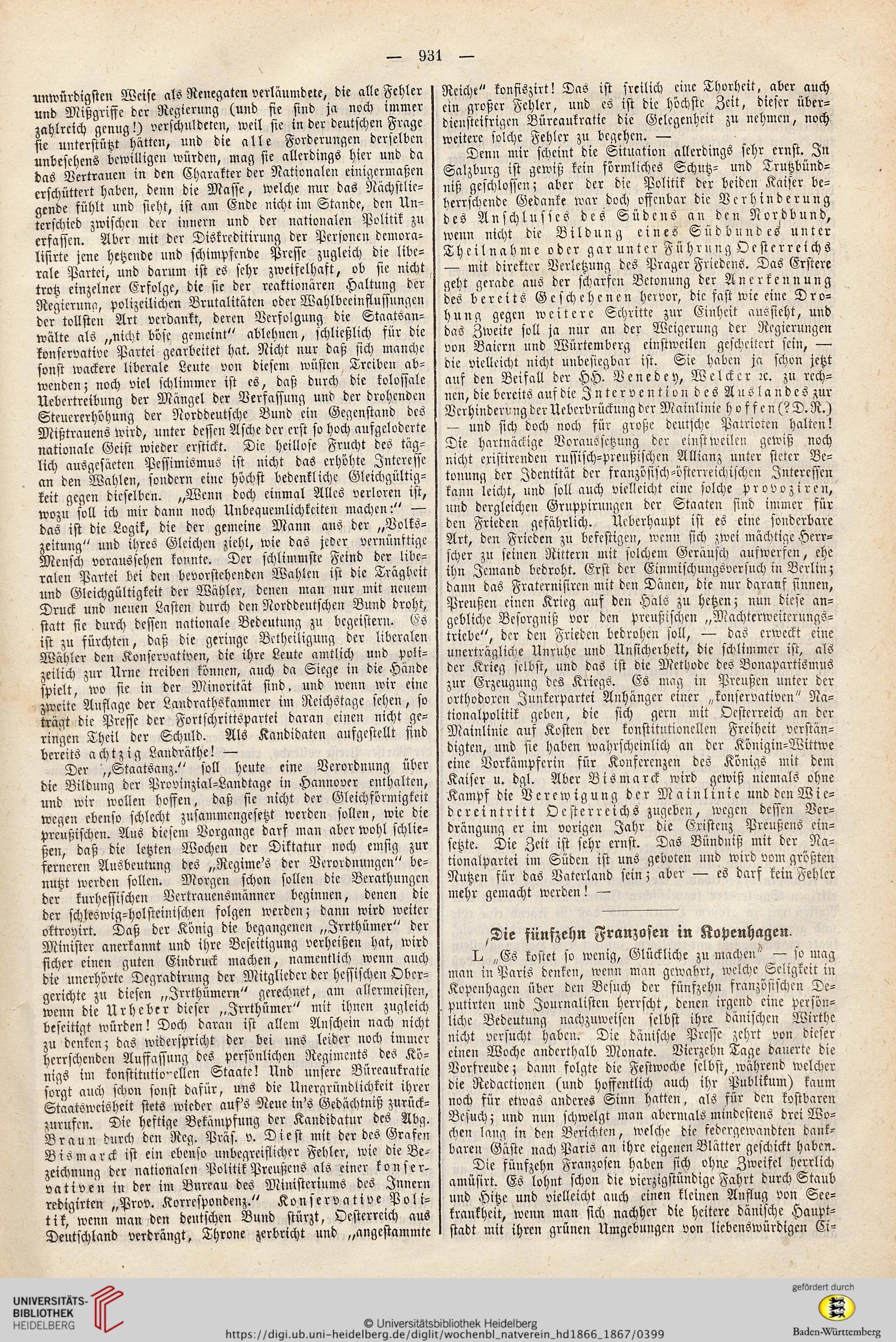931
unwürdigsten Weise als Renegaten verleumdete, die alle Fehler
und Mißgriffe der Regierung (und sie sind ja nvch immer
zahlreich genug!) verschuldeten, weil sic in der deutschen Frage
sie unterstützt ^hätten, und die alle Forderungen derselben
unbeschens bewilligen würden, mag sic allerdings hier und da
das Vertrauen in den Charakter der Nationalen einigermaßen
erschüttert haben, denn die Masse, welche nur das Nächstlie-
gende fühlt und sieht, ist am Ende nicht im Stande, den Un-
terschied zwischen der innern und der nationalen Politik zu
erfassen. Aber mit der Diskreditirung der Personen dcmora-
lisirte jene hetzende und schimpfende Presse zugleich die libe-
rale Partei, und darum ist es sehr zweifelhaft, ob sie nicht
trotz einzelner Erfolge, die sic der reaktionären Haltung der
Negierung, polizeilichen Brutalitäten oder Wahlbecinflussungcn
der tollsten Art verdankt, deren Verfolgung die Staatsan-
wälte als „nicht böse gemeint" ablchncn, schließlich für die
konservative Partei gearbeitet hat. Nicht nur daß sich manche
sonst wackere liberale Leute von diesem wüsten Treiben ab-
wenden; noch viel schlimmer ist es, daß durch die kolossale
Uebertrcibung der Mängel der Verfassung und der drohenden
Steucrerhohung der Norddeutsche Bund ein Gegenstand des
Mißtrauens wird, unter dessen Asche der erst so hoch aufgcloderte
nationale Geist wieder erstickt. Die heillose Frucht des täg-
lich ausgesäetcn Pessimismus ist nicht das erhöhte Interesse
an den Wahlen, sondern eine höchst bedenkliche Gleichgültig-
keit gegen dieselben. „Wenn doch einmal Alles verloren ist,
wozu soll ich mir dann nvch Unbequemlichkeiten machen:" —
das ist die Logik, die der gemeine Mann ans der „Volks-
zeitung" und ihres Gleichen zieht, wie das jeder vernünftige
Mensch voraussehcn konnte. Der schlimmste Feind der libe-
ralen Partei bei den bevorstehenden Wahlen ist die Trägheit
und Gleichgültigkeit der Wähler, denen man nur mit neuem
Druck und neuen Lasten durch den Norddeutschen Bund droht,
statt sie durch dessen nationale Bedeutung zu begeistern. Es
ist zu fürchten, daß die geringe Betheiligung der liberalen
Wähler den Konservativen, die ihre Leute amtlich und poli-
zeilich zur Urne treiben können, auch da Siege in die Hände
spielt, wo sie in der Minorität sind, und wenn wir eine
zweite Auflage der Landrathskammer im Reichstage sehen, so
trägt die Presse der Fortschrittspartei daran einen nicht ge-
ringen Theil der Schuld. Als Kandidaten ausgestellt sind
bereits achtzig Landräthe! —
Der „Staatsanz." soll heute eine Verordnung über
die Bildung der Provinzial-Landtage in Hannover enthalten,
und wir wollen hoffen, daß sie nicht der Gleichförmigkeit
wegen ebenso schlecht zusammengesetzt werden sollen, wie die
preußischen. Aus diesem Vorgänge darf man aber wohl schlie-
ßen, daß die letzten Wochen der Diktatur noch emsig zur
ferneren Ausbeutung des „Regime's der Verordnungen" be-
nutzt werden sollen. Morgen schon sollen die Berathungcn
der kurhessischen Vertrauensmänner beginnen, denen die
der schleswig-holsteinischen folgen werden; dann wird weiter
oktroyirt. Daß der König die begangenen „Jrrthümer" der
Minister anerkannt und ihre Beseitigung verheißen hat, wird
sicher einen guten Eindruck machen, namentlich wenn auch
die unerhörte Degradtrung der Mitglieder der hessischen Ober-
gerichte zu diesen „Jrrthümern" gerechnet, am allermeisten,
wenn die Urheber dieser „Jrrthümer" mit ihnen zugleich
beseitigt würden! Doch daran ist allem Anschein nach nicht
zu denken; das widerspricht der bei uns leider noch immer
herrschenden Auffassung des persönlichen Regiments des Kö-
nigs im konstitutio-cllcn Staate! Und unsere Büreaukratie
sorgt auch schon sonst dafür, uns die Unergründlichkeit ihrer
Staatswcisheit stets wieder auf's Neue in's Gedächtniß zurück-
zurufen. Die heftige Bekämpfung der Kandidatur des Abg.
Braun durch den Reg. Präs. v. Diest mit derbes Grafen
Bismarck ist ein ebenso unbegreiflicher Fehler, wie die Be-
zeichnung der nationalen Politik Preußens als einer konser-
vativen in der im Bureau des Ministeriums des Innern
redigirten „Prov. Korrespondenz." Konservative Poli-
tik, wenn man den deutschen Bund stürzt, Oesterreich aus
Deutschland verdrängt, Throne zerbricht und „angestammte
Reiche" konfiszirt! Das ist freilich eine Thorhcit, aber auch
ein großer Fehler, und es ist die höchste Zeit, dieser über-
diensteifrigen Büreaukratie die Gelegenheit zu nehmen, noch
weitere solche Fehler zu begehen. —
Denn mir scheint die Situation allerdings sehr ernst. In
Salzburg ist gewiß kein förmliches Schutz- und Trutzbünd-
niß geschlossen; aber der die Politik der beiden Kaiser be-
herrschende Gedanke war doch offenbar die Verhinderung
des Anschlusses des Südens an den Nordbund,
wenn nicht die Bildung eines Südbundcs unter
Theilnahme oder gar unter Führung Oesterreichs
— mit direkter Verletzung des Prager Friedens. Das Erstere
geht gerade aus der scharfen Betonung der Anerkennung
des bereits Geschehenen hervor, die fast wie eine Dro-
hung gegen weitere Schritte zur Einheit aussicht, und
das Zweite soll ja nur an der Weigerung der Regierungen
von Baiern und Würtcmberg einstweilen gescheitert sein, —
die vielleicht nicht unbesiegbar ist. Sie haben ja schon jetzt
auf den Beifall der HH. Venedey, Welcher re. zu rech-
nen, die bereits auf die Intervention des A u s l a n d e s zur
Verhinderung derUeberbrückung der Maiulinic h o ffen(?D.R.)
— und sich doch noch für große deutsche Patrioten halten!
Die hartnäckige Voraussetzung der einstweilen gewiß noch
nicht cxistirenden russisch-preußischen Allianz unter steter Be-
tonung der Identität der französisch-österreichischen Interessen
kann leicht, und soll auch vielleicht eine solche provoziren,
und dergleichen Gruppirungcn der Staaten sind immer für
den Frieden gefährlich. Ueberhaupt ist es eine sonderbare
Art, den Frieden zu befestigen, wenn sich zwei mächtige Herr-
scher zu seinen Rittern mit solchem Geräusch aufwerfcn, ehe
ihn Jemand bedroht. Erst der Einmischungsversuch in Berlin;
dann das Fraternisircn mit den Dänen, die nur darauf sinnen,
Preußen einen Krieg auf den Hals zu Hetzen; nun diese an-
gebliche Besorgniß vor den preußischen „Machtcrweiterungs-
tricbe", der den Frieden bedrohen soll, — das erweckt eine
unerträgliche Unruhe und Unsicherheit, die schlimmer ist, als
der Krieg selbst, nnd daö ist die Methode des Bonapartismus
zur Erzeugung des Kriegs. Es mag in Preußen unter der
orthodoxen Junkerpartei Anhänger einer „konservativen" Na-
tionalpolitik geben, die sich gern mit Oesterreich an der
Mainlinie auf Kosten der konstitutionellen Freiheit verstän-
digten, und sie haben wahrscheinlich an der Königin-Wittwe
eine Vorkämpferin für Konferenzen des Königs mit dem
Kaiser u. dgl. Aber Bismarck wird gewiß niemals ohne
Kampf die Verewigung der Mainlinie und den Wie-
derei »tritt Oesterreichs zugeben, wegen dessen Ver-
drängung er im vorigen Jahr die Existenz Preußens ein-
setzte. Die Zett ist sehr ernst. Das Bündniß mit der Na-
tionalpartei im Süden ist uns geboten und wird vom größten
Nutzen für das Vaterland sein; aber — es darf kein Fehler
mehr gemacht werden! —
.Die fünfzehn Franzosen in Kopenhagen
I- „Es kostet so wenig, Glückliche zu machen" — so mag
man in Paris denken, wenn man gewahrt, welche Seligkeit in
Kopenhagen über den Besuch der fünfzehn französischen De-
putaten und Journalisten herrscht, denen irgend eine persön-
liche Bedeutung nachzuweiscn selbst ihre dänischen Wirthe
nicht versucht haben. Die dänische Presse zehrt von dieser
einen Woche anderthalb Monate. Vierzehn Tage dauerte die
Vorfreude; dann folgte die Festwoche selbst, während welcher
die Redactionen (und hoffentlich auch ihr Publikum) kaum
noch für etwas anderes Sinn hatten, als für den kostbaren
Besuch; und nun schwelgt man abermals mindestens drei Wo-
chen lang in den Berichten, welche die federgewandten dank-
baren Gäste nach Paris an ihre eigenen Blätter geschickt haben.
Die fünfzehn Franzosen haben sich ohne Zweifel herrlich
amüsirt. Es lohnt schon die vicrzigstündige Fahrt durch Staub
und Hitze und vielleicht auch einen kleinen Anflug von See-
krankheit, wenn man sich nachher die heitere dänische Haupt-
stadt mit ihren grünen Umgebungen von liebenswürdigen Ci-
unwürdigsten Weise als Renegaten verleumdete, die alle Fehler
und Mißgriffe der Regierung (und sie sind ja nvch immer
zahlreich genug!) verschuldeten, weil sic in der deutschen Frage
sie unterstützt ^hätten, und die alle Forderungen derselben
unbeschens bewilligen würden, mag sic allerdings hier und da
das Vertrauen in den Charakter der Nationalen einigermaßen
erschüttert haben, denn die Masse, welche nur das Nächstlie-
gende fühlt und sieht, ist am Ende nicht im Stande, den Un-
terschied zwischen der innern und der nationalen Politik zu
erfassen. Aber mit der Diskreditirung der Personen dcmora-
lisirte jene hetzende und schimpfende Presse zugleich die libe-
rale Partei, und darum ist es sehr zweifelhaft, ob sie nicht
trotz einzelner Erfolge, die sic der reaktionären Haltung der
Negierung, polizeilichen Brutalitäten oder Wahlbecinflussungcn
der tollsten Art verdankt, deren Verfolgung die Staatsan-
wälte als „nicht böse gemeint" ablchncn, schließlich für die
konservative Partei gearbeitet hat. Nicht nur daß sich manche
sonst wackere liberale Leute von diesem wüsten Treiben ab-
wenden; noch viel schlimmer ist es, daß durch die kolossale
Uebertrcibung der Mängel der Verfassung und der drohenden
Steucrerhohung der Norddeutsche Bund ein Gegenstand des
Mißtrauens wird, unter dessen Asche der erst so hoch aufgcloderte
nationale Geist wieder erstickt. Die heillose Frucht des täg-
lich ausgesäetcn Pessimismus ist nicht das erhöhte Interesse
an den Wahlen, sondern eine höchst bedenkliche Gleichgültig-
keit gegen dieselben. „Wenn doch einmal Alles verloren ist,
wozu soll ich mir dann nvch Unbequemlichkeiten machen:" —
das ist die Logik, die der gemeine Mann ans der „Volks-
zeitung" und ihres Gleichen zieht, wie das jeder vernünftige
Mensch voraussehcn konnte. Der schlimmste Feind der libe-
ralen Partei bei den bevorstehenden Wahlen ist die Trägheit
und Gleichgültigkeit der Wähler, denen man nur mit neuem
Druck und neuen Lasten durch den Norddeutschen Bund droht,
statt sie durch dessen nationale Bedeutung zu begeistern. Es
ist zu fürchten, daß die geringe Betheiligung der liberalen
Wähler den Konservativen, die ihre Leute amtlich und poli-
zeilich zur Urne treiben können, auch da Siege in die Hände
spielt, wo sie in der Minorität sind, und wenn wir eine
zweite Auflage der Landrathskammer im Reichstage sehen, so
trägt die Presse der Fortschrittspartei daran einen nicht ge-
ringen Theil der Schuld. Als Kandidaten ausgestellt sind
bereits achtzig Landräthe! —
Der „Staatsanz." soll heute eine Verordnung über
die Bildung der Provinzial-Landtage in Hannover enthalten,
und wir wollen hoffen, daß sie nicht der Gleichförmigkeit
wegen ebenso schlecht zusammengesetzt werden sollen, wie die
preußischen. Aus diesem Vorgänge darf man aber wohl schlie-
ßen, daß die letzten Wochen der Diktatur noch emsig zur
ferneren Ausbeutung des „Regime's der Verordnungen" be-
nutzt werden sollen. Morgen schon sollen die Berathungcn
der kurhessischen Vertrauensmänner beginnen, denen die
der schleswig-holsteinischen folgen werden; dann wird weiter
oktroyirt. Daß der König die begangenen „Jrrthümer" der
Minister anerkannt und ihre Beseitigung verheißen hat, wird
sicher einen guten Eindruck machen, namentlich wenn auch
die unerhörte Degradtrung der Mitglieder der hessischen Ober-
gerichte zu diesen „Jrrthümern" gerechnet, am allermeisten,
wenn die Urheber dieser „Jrrthümer" mit ihnen zugleich
beseitigt würden! Doch daran ist allem Anschein nach nicht
zu denken; das widerspricht der bei uns leider noch immer
herrschenden Auffassung des persönlichen Regiments des Kö-
nigs im konstitutio-cllcn Staate! Und unsere Büreaukratie
sorgt auch schon sonst dafür, uns die Unergründlichkeit ihrer
Staatswcisheit stets wieder auf's Neue in's Gedächtniß zurück-
zurufen. Die heftige Bekämpfung der Kandidatur des Abg.
Braun durch den Reg. Präs. v. Diest mit derbes Grafen
Bismarck ist ein ebenso unbegreiflicher Fehler, wie die Be-
zeichnung der nationalen Politik Preußens als einer konser-
vativen in der im Bureau des Ministeriums des Innern
redigirten „Prov. Korrespondenz." Konservative Poli-
tik, wenn man den deutschen Bund stürzt, Oesterreich aus
Deutschland verdrängt, Throne zerbricht und „angestammte
Reiche" konfiszirt! Das ist freilich eine Thorhcit, aber auch
ein großer Fehler, und es ist die höchste Zeit, dieser über-
diensteifrigen Büreaukratie die Gelegenheit zu nehmen, noch
weitere solche Fehler zu begehen. —
Denn mir scheint die Situation allerdings sehr ernst. In
Salzburg ist gewiß kein förmliches Schutz- und Trutzbünd-
niß geschlossen; aber der die Politik der beiden Kaiser be-
herrschende Gedanke war doch offenbar die Verhinderung
des Anschlusses des Südens an den Nordbund,
wenn nicht die Bildung eines Südbundcs unter
Theilnahme oder gar unter Führung Oesterreichs
— mit direkter Verletzung des Prager Friedens. Das Erstere
geht gerade aus der scharfen Betonung der Anerkennung
des bereits Geschehenen hervor, die fast wie eine Dro-
hung gegen weitere Schritte zur Einheit aussicht, und
das Zweite soll ja nur an der Weigerung der Regierungen
von Baiern und Würtcmberg einstweilen gescheitert sein, —
die vielleicht nicht unbesiegbar ist. Sie haben ja schon jetzt
auf den Beifall der HH. Venedey, Welcher re. zu rech-
nen, die bereits auf die Intervention des A u s l a n d e s zur
Verhinderung derUeberbrückung der Maiulinic h o ffen(?D.R.)
— und sich doch noch für große deutsche Patrioten halten!
Die hartnäckige Voraussetzung der einstweilen gewiß noch
nicht cxistirenden russisch-preußischen Allianz unter steter Be-
tonung der Identität der französisch-österreichischen Interessen
kann leicht, und soll auch vielleicht eine solche provoziren,
und dergleichen Gruppirungcn der Staaten sind immer für
den Frieden gefährlich. Ueberhaupt ist es eine sonderbare
Art, den Frieden zu befestigen, wenn sich zwei mächtige Herr-
scher zu seinen Rittern mit solchem Geräusch aufwerfcn, ehe
ihn Jemand bedroht. Erst der Einmischungsversuch in Berlin;
dann das Fraternisircn mit den Dänen, die nur darauf sinnen,
Preußen einen Krieg auf den Hals zu Hetzen; nun diese an-
gebliche Besorgniß vor den preußischen „Machtcrweiterungs-
tricbe", der den Frieden bedrohen soll, — das erweckt eine
unerträgliche Unruhe und Unsicherheit, die schlimmer ist, als
der Krieg selbst, nnd daö ist die Methode des Bonapartismus
zur Erzeugung des Kriegs. Es mag in Preußen unter der
orthodoxen Junkerpartei Anhänger einer „konservativen" Na-
tionalpolitik geben, die sich gern mit Oesterreich an der
Mainlinie auf Kosten der konstitutionellen Freiheit verstän-
digten, und sie haben wahrscheinlich an der Königin-Wittwe
eine Vorkämpferin für Konferenzen des Königs mit dem
Kaiser u. dgl. Aber Bismarck wird gewiß niemals ohne
Kampf die Verewigung der Mainlinie und den Wie-
derei »tritt Oesterreichs zugeben, wegen dessen Ver-
drängung er im vorigen Jahr die Existenz Preußens ein-
setzte. Die Zett ist sehr ernst. Das Bündniß mit der Na-
tionalpartei im Süden ist uns geboten und wird vom größten
Nutzen für das Vaterland sein; aber — es darf kein Fehler
mehr gemacht werden! —
.Die fünfzehn Franzosen in Kopenhagen
I- „Es kostet so wenig, Glückliche zu machen" — so mag
man in Paris denken, wenn man gewahrt, welche Seligkeit in
Kopenhagen über den Besuch der fünfzehn französischen De-
putaten und Journalisten herrscht, denen irgend eine persön-
liche Bedeutung nachzuweiscn selbst ihre dänischen Wirthe
nicht versucht haben. Die dänische Presse zehrt von dieser
einen Woche anderthalb Monate. Vierzehn Tage dauerte die
Vorfreude; dann folgte die Festwoche selbst, während welcher
die Redactionen (und hoffentlich auch ihr Publikum) kaum
noch für etwas anderes Sinn hatten, als für den kostbaren
Besuch; und nun schwelgt man abermals mindestens drei Wo-
chen lang in den Berichten, welche die federgewandten dank-
baren Gäste nach Paris an ihre eigenen Blätter geschickt haben.
Die fünfzehn Franzosen haben sich ohne Zweifel herrlich
amüsirt. Es lohnt schon die vicrzigstündige Fahrt durch Staub
und Hitze und vielleicht auch einen kleinen Anflug von See-
krankheit, wenn man sich nachher die heitere dänische Haupt-
stadt mit ihren grünen Umgebungen von liebenswürdigen Ci-