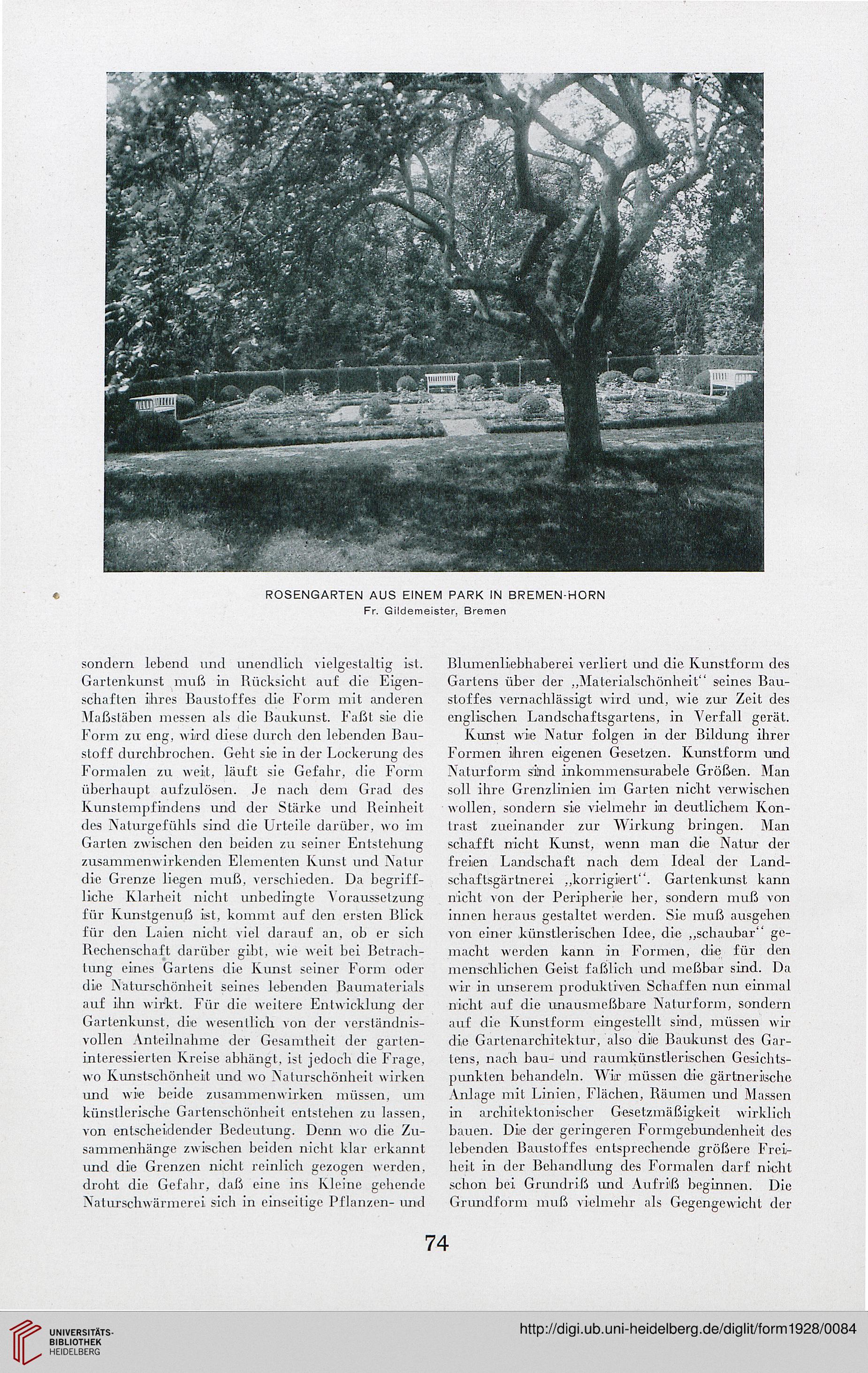ROSENGARTEN AUS EINEM PARK IN BREMEN-HORN
Fr. Gildemeister. Bremen
sondern lebend und unendlich vielgestaltig ist.
Gartenkunst muß in Rücksicht auf die Eigen-
schaften ihres Baustoffes die Form mit anderen
Maßstäben messen als die Baukunst. Faßt sie die
Form zu eng, wird diese durch den lebenden Bau-
stoff durchbrochen. Geht sie in der Lockerung des
Formalen zu weit, läuft sie Gefahr, die Form
überhaupt aufzulösen. Je nach dem Grad des
Kunstempfindens und der Stärke und Reinheit
des Naturgefühls sind die Urteile darüber, wo im
Garten zwischen den beiden zu seiner Entstehung
zusammenwirkenden Elementen Kunst und Natur
die Grenze liegen muß, verschieden. Da begriff-
liche Klarheit nicht unbedingte Voraussetzung
für Kunstgenuß ist, kommt auf den ersten Blick
für den Laien nicht viel darauf an, ob er sich
Bechenschaft darüber gibt, wie weit bei Betrach-
tung eines Gartens die Kunst seiner Form oder
die Naturschönheit seines lebenden Baumaterials
auf ihn wirkt. Für die weitere Entwicklung der
Gartenkunst, die wesentlich von der verständnis-
vollen Anteilnahme der Gesamtheit der garten-
interessierten Kreise abhängt, ist jedoch die Frage,
wo Kunstschönheit und wo Naturschönheit wirken
und wie beide zusammenwirken müssen, um
künstlerische Gartenschönheil entstehen zu lassen,
von entscheidender Bedeutung. Denn wo die Zu-
sammenhänge zwischen beiden nicht klar erkannt
und die Grenzen nicht reinlich gezogen werden,
droht die Gefahr, daß eine ins Kleine gehende
Naturschwärmerei sich in einseitige Pflanzen- und
Blumenliebhaberei verliert und die Kunstform des
Gartens über der ,,Materialschönheit'' seines Bau-
stoffes vernachlässigt wird und, wie zur Zeit des
englischen Landschaftsgartens, in Verfall gerät.
Kunst wiie Natur folgen in der Bildung ihrer
Formen ihren eigenen Gesetzen. Kunstform und
Natuxform sind inkommensurabele Größen. Man
soll ihre Grenzlinien im Garten nicht verwischen
wollen, sondern sie vielmehr in deutlichem Kon-
trast zueinander zur Wirkung bringen. Man
schafft nicht Kunst, wenn man die Natur der
freien Landschaft nach dem Ideal der Land-
schaf tsgärtnerei „korrigiert". Gartenkunst kann
nicht von der Peripherie her, sondern muß von
innen heraus gestaltet werden. Sie muß ausgehen
von einer künstlerischen Idee, die „schauhar" ge-
macht werden kann in Formen, die für den
menschlichen Geist faßlich und meßbar sind. Da
w ir in unserem produktiven Schaffen nun einmal
nicht auf die unausmeßbare Nalurform, sondern
auf die Kunstform eingestellt sind, müssen wir
die Gartenarchitektur, also die Baukunst des Gar-
tens, nach bau- und raumkünstlerischen Gesichts-
punkten behandeln. Wir müssen die gärtnerische
Anlage mit Linien, Flächen, Bäumen und Massen
in architektonischer Gesetzmäßigkeit wirklich
bauen. Die der geringeren Formgebundenheit des
lebenden Baustoffes entsprechende größere Frei-
heit in der Behandlung des Formalen darf nicht
schon bei Grundriß und Aufriß beginnen. Die
Grundform muß vielmehr als Gegengewicht der
74
Fr. Gildemeister. Bremen
sondern lebend und unendlich vielgestaltig ist.
Gartenkunst muß in Rücksicht auf die Eigen-
schaften ihres Baustoffes die Form mit anderen
Maßstäben messen als die Baukunst. Faßt sie die
Form zu eng, wird diese durch den lebenden Bau-
stoff durchbrochen. Geht sie in der Lockerung des
Formalen zu weit, läuft sie Gefahr, die Form
überhaupt aufzulösen. Je nach dem Grad des
Kunstempfindens und der Stärke und Reinheit
des Naturgefühls sind die Urteile darüber, wo im
Garten zwischen den beiden zu seiner Entstehung
zusammenwirkenden Elementen Kunst und Natur
die Grenze liegen muß, verschieden. Da begriff-
liche Klarheit nicht unbedingte Voraussetzung
für Kunstgenuß ist, kommt auf den ersten Blick
für den Laien nicht viel darauf an, ob er sich
Bechenschaft darüber gibt, wie weit bei Betrach-
tung eines Gartens die Kunst seiner Form oder
die Naturschönheit seines lebenden Baumaterials
auf ihn wirkt. Für die weitere Entwicklung der
Gartenkunst, die wesentlich von der verständnis-
vollen Anteilnahme der Gesamtheit der garten-
interessierten Kreise abhängt, ist jedoch die Frage,
wo Kunstschönheit und wo Naturschönheit wirken
und wie beide zusammenwirken müssen, um
künstlerische Gartenschönheil entstehen zu lassen,
von entscheidender Bedeutung. Denn wo die Zu-
sammenhänge zwischen beiden nicht klar erkannt
und die Grenzen nicht reinlich gezogen werden,
droht die Gefahr, daß eine ins Kleine gehende
Naturschwärmerei sich in einseitige Pflanzen- und
Blumenliebhaberei verliert und die Kunstform des
Gartens über der ,,Materialschönheit'' seines Bau-
stoffes vernachlässigt wird und, wie zur Zeit des
englischen Landschaftsgartens, in Verfall gerät.
Kunst wiie Natur folgen in der Bildung ihrer
Formen ihren eigenen Gesetzen. Kunstform und
Natuxform sind inkommensurabele Größen. Man
soll ihre Grenzlinien im Garten nicht verwischen
wollen, sondern sie vielmehr in deutlichem Kon-
trast zueinander zur Wirkung bringen. Man
schafft nicht Kunst, wenn man die Natur der
freien Landschaft nach dem Ideal der Land-
schaf tsgärtnerei „korrigiert". Gartenkunst kann
nicht von der Peripherie her, sondern muß von
innen heraus gestaltet werden. Sie muß ausgehen
von einer künstlerischen Idee, die „schauhar" ge-
macht werden kann in Formen, die für den
menschlichen Geist faßlich und meßbar sind. Da
w ir in unserem produktiven Schaffen nun einmal
nicht auf die unausmeßbare Nalurform, sondern
auf die Kunstform eingestellt sind, müssen wir
die Gartenarchitektur, also die Baukunst des Gar-
tens, nach bau- und raumkünstlerischen Gesichts-
punkten behandeln. Wir müssen die gärtnerische
Anlage mit Linien, Flächen, Bäumen und Massen
in architektonischer Gesetzmäßigkeit wirklich
bauen. Die der geringeren Formgebundenheit des
lebenden Baustoffes entsprechende größere Frei-
heit in der Behandlung des Formalen darf nicht
schon bei Grundriß und Aufriß beginnen. Die
Grundform muß vielmehr als Gegengewicht der
74