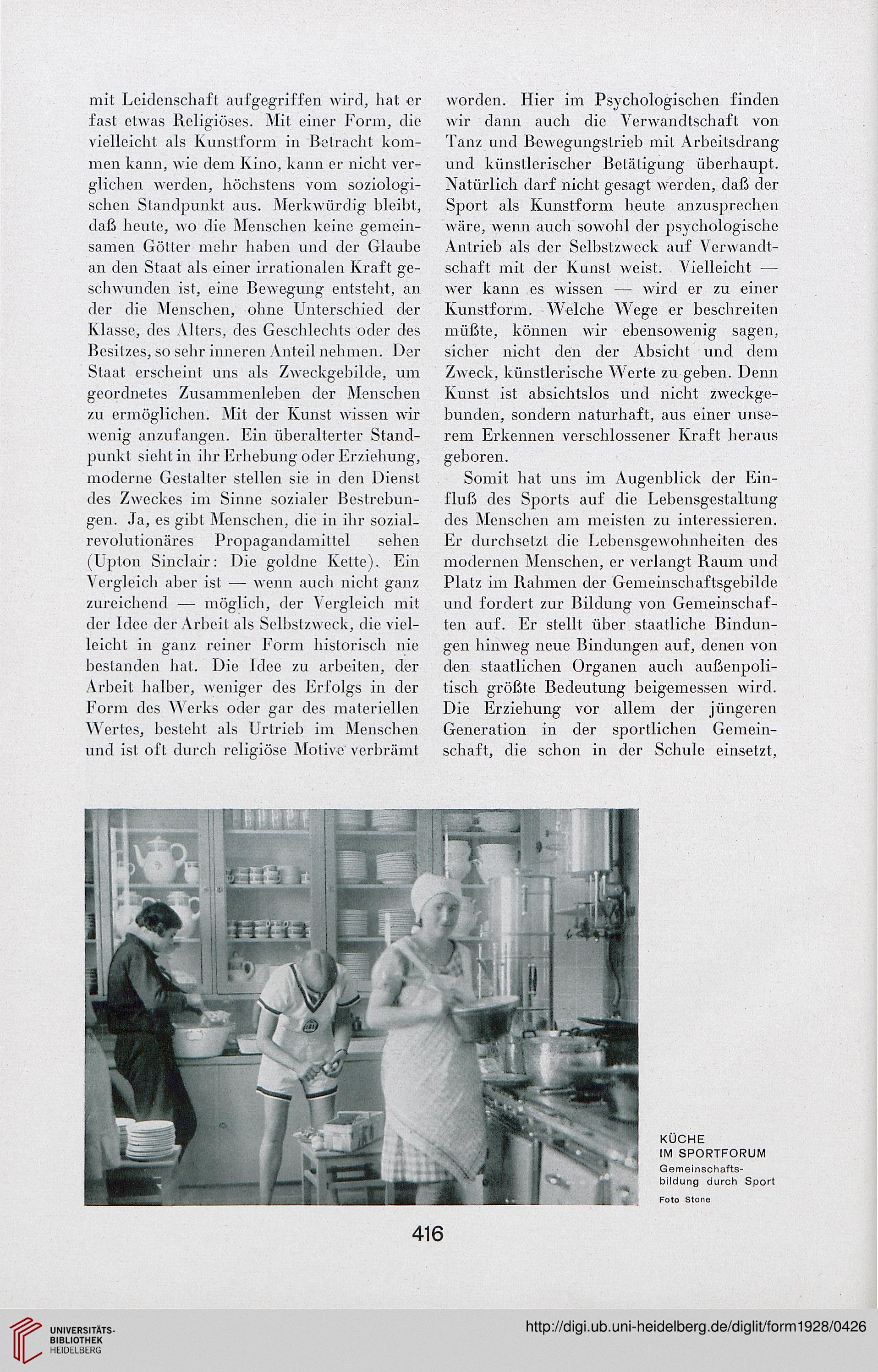mit Leidenschaft aufgegriffen wird, hat er
fast etwas Religiöses. Mit einer Form, die
vielleicht als Kunstform in Betracht kom-
men kann, wie dem Kino, kann er nicht ver-
glichen werden, höchstens vom soziologi-
schen Standpunkt aus. Merkwürdig bleibt,
daß heute, wo die Menschen keine gemein-
samen Götter mehr haben und der Glaube
an den Staat als einer irrationalen Kraft ge-
schwunden ist, eine Bewegung entsteht, an
der die Menschen, ohne Unterschied der
Klasse, des Alters, des Geschlechts oder des
Besitzes, so sehr inneren Anteil nehmen. Der
Staat erscheint uns als Zweckgebilde, um
geordnetes Zusammenleben der Menseben
zu ermöglichen. Mit der Kunst wissen wir
wenig anzufangen. Ein überalterter Stand-
punkt sieht in ihr Erhebung oder Erziehung,
moderne Gestalter stellen sie in den Dienst
des Zweckes im Sinne sozialer Bestrebun-
gen. Ja, es gibt Menschen, die in ihr sozial-
revolutionäres Propagandamitlel sehen
(Upton Sinclair: Die goldne Kette). Ein
Vergleich aber ist — wenn auch nicht ganz
zureichend — möglich, der Vergleich mit
der Idee der Arbeit als Selbstzweck, die viel-
leicht in ganz reiner Form historisch nie
bestanden hat. Die Idee zu arbeiten, der
Arbeit halber, weniger des Erfolgs in der
Form des Werks oder gar des materiellen
Wertes, besteht als Urtrieb im Menschen
und ist oft durch religiöse Motive verbrämt
worden. Hier im Psychologischen finden
wir dann auch die Verwandtschaft von
Tanz und Bewegungstrieb mit Arbeitsdrang
und künstlerischer Betätigung überhaupt.
Natürlich darf nicht gesagt werden, daß der
Sport als Kunstform heute anzusprechen
wäre, wenn auch sowohl der psychologische
Antrieb als der Selbstzweck auf Verwandt-
schaft mit der Kunst weist. Vielleicht —
wer kann es wissen — wird er zu einer
Kunslform. Welche Wege er beschreiten
müßte, können wir ebensowenig sagen,
sicher nicht den der Absicht und dem
Zweck, künstlerische Werte zu geben. Denn
Kunst ist absichtslos und nicht zweckge-
bunden, sondern naturhaft, aus einer unse-
rem Erkennen verschlossener Kraft heraus
geboren.
Somit hat uns im Augenblick der Ein-
fluß des Sports auf die Lebensgestallung
des Menschen am meisten zu interessieren.
Er durchsetzt die Lebensgewohnheiten des
modernen Menschen, er verlangt Raum und
Platz im Rahmen der Gemeinschaftsgebilde
und fordert zur Bildung von Gemeinschaf-
ten auf. Er stellt über staatliche Bindun-
gen hinweg neue Bindungen auf, denen von
den staatlichen Organen auch außenpoli-
tisch größte Bedeutung beigemessen wird.
Die Erziehung vor allem der jüngeren
Generation in der sportlichen Gemein-
schaft, die schon in der Schule einsetzt,
416
fast etwas Religiöses. Mit einer Form, die
vielleicht als Kunstform in Betracht kom-
men kann, wie dem Kino, kann er nicht ver-
glichen werden, höchstens vom soziologi-
schen Standpunkt aus. Merkwürdig bleibt,
daß heute, wo die Menschen keine gemein-
samen Götter mehr haben und der Glaube
an den Staat als einer irrationalen Kraft ge-
schwunden ist, eine Bewegung entsteht, an
der die Menschen, ohne Unterschied der
Klasse, des Alters, des Geschlechts oder des
Besitzes, so sehr inneren Anteil nehmen. Der
Staat erscheint uns als Zweckgebilde, um
geordnetes Zusammenleben der Menseben
zu ermöglichen. Mit der Kunst wissen wir
wenig anzufangen. Ein überalterter Stand-
punkt sieht in ihr Erhebung oder Erziehung,
moderne Gestalter stellen sie in den Dienst
des Zweckes im Sinne sozialer Bestrebun-
gen. Ja, es gibt Menschen, die in ihr sozial-
revolutionäres Propagandamitlel sehen
(Upton Sinclair: Die goldne Kette). Ein
Vergleich aber ist — wenn auch nicht ganz
zureichend — möglich, der Vergleich mit
der Idee der Arbeit als Selbstzweck, die viel-
leicht in ganz reiner Form historisch nie
bestanden hat. Die Idee zu arbeiten, der
Arbeit halber, weniger des Erfolgs in der
Form des Werks oder gar des materiellen
Wertes, besteht als Urtrieb im Menschen
und ist oft durch religiöse Motive verbrämt
worden. Hier im Psychologischen finden
wir dann auch die Verwandtschaft von
Tanz und Bewegungstrieb mit Arbeitsdrang
und künstlerischer Betätigung überhaupt.
Natürlich darf nicht gesagt werden, daß der
Sport als Kunstform heute anzusprechen
wäre, wenn auch sowohl der psychologische
Antrieb als der Selbstzweck auf Verwandt-
schaft mit der Kunst weist. Vielleicht —
wer kann es wissen — wird er zu einer
Kunslform. Welche Wege er beschreiten
müßte, können wir ebensowenig sagen,
sicher nicht den der Absicht und dem
Zweck, künstlerische Werte zu geben. Denn
Kunst ist absichtslos und nicht zweckge-
bunden, sondern naturhaft, aus einer unse-
rem Erkennen verschlossener Kraft heraus
geboren.
Somit hat uns im Augenblick der Ein-
fluß des Sports auf die Lebensgestallung
des Menschen am meisten zu interessieren.
Er durchsetzt die Lebensgewohnheiten des
modernen Menschen, er verlangt Raum und
Platz im Rahmen der Gemeinschaftsgebilde
und fordert zur Bildung von Gemeinschaf-
ten auf. Er stellt über staatliche Bindun-
gen hinweg neue Bindungen auf, denen von
den staatlichen Organen auch außenpoli-
tisch größte Bedeutung beigemessen wird.
Die Erziehung vor allem der jüngeren
Generation in der sportlichen Gemein-
schaft, die schon in der Schule einsetzt,
416