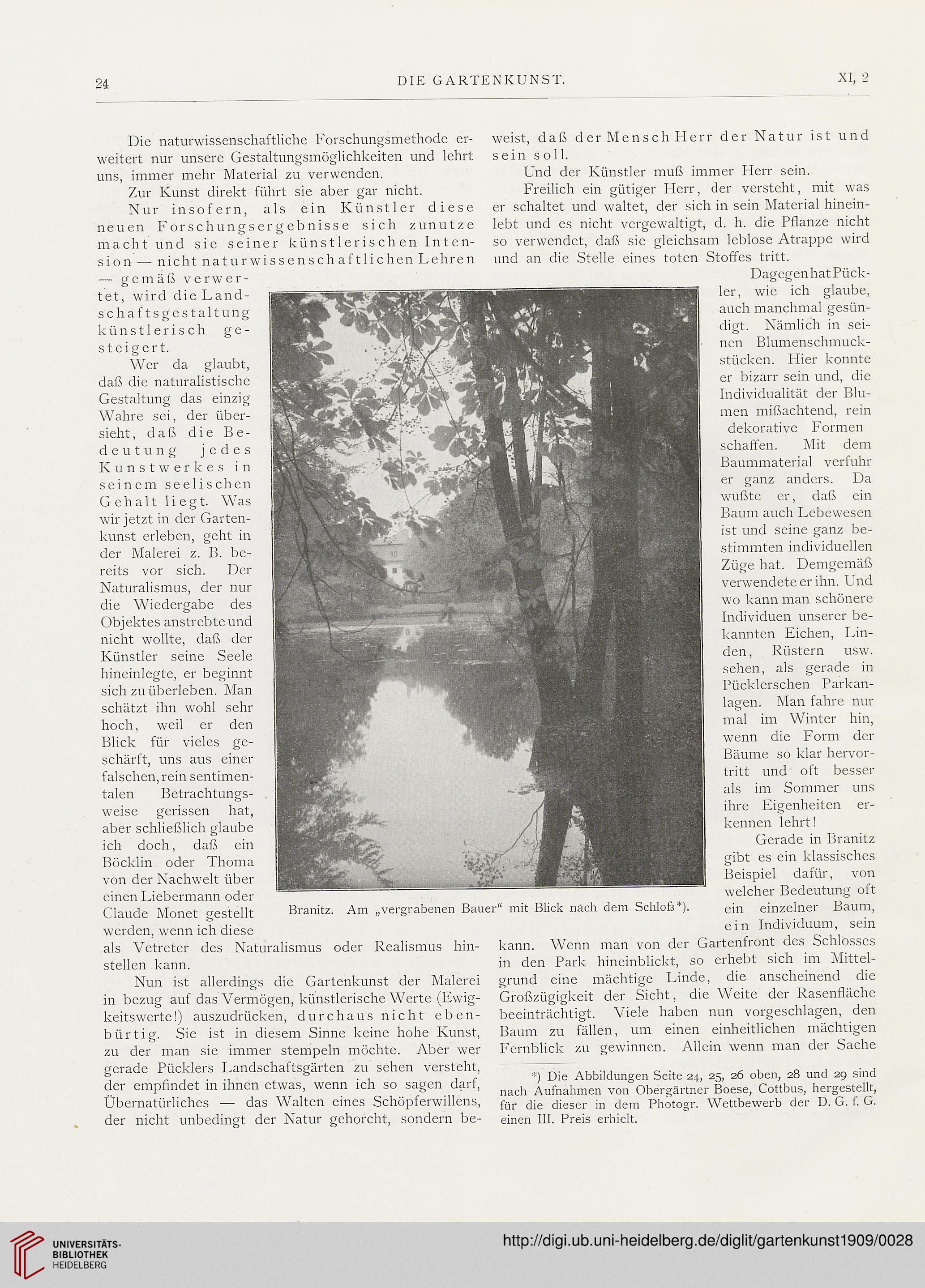24
DIE GARTENKUNST.
XI, 2
Die naturwissenschaftliche Forschungsmethode er-
weitert nur unsere Gestaltungsmöglichkeiten und lehrt
uns, immer mehr Material zu verwenden.
Zur Kunst direkt führt sie aber gar nicht.
Nur insofern, als ein Künstler diese
neuen Forschungsergebnisse sich zunutze
macht und sie seiner künstlerischen Inten-
sion — nicht naturwissenschaftlichen Lehren
— gemäß verwer-
tet, wird die Land-
schaftsgestaltung
künstlerisch ge-
steigert.
W er da glaubt,
daß die naturalistische
Gestaltung das einzig
Wahre sei, der über-
sieht , daß die Be-
deutung jedes
Kunstwerkes in
seinem seelischen
Gehalt liegt. Was
wir jetzt in der Garten-
kunst erleben, geht in
der Malerei z. B. be-
reits vor sich. Der
Naturalismus, der nur
die Wiedergabe des
Objektes anstrebte und
nicht wollte, daß der
Künstler seine Seele
hineinlegte, er beginnt
sich zu überleben. Man
schätzt ihn wohl sehr
hoch, weil er den
Blick für vieles ge-
schärft, uns aus einer
falschen, rein sentimen-
talen Betrachtungs-
weise gerissen hat,
aber schließlich glaube
ich doch, daß ein
Böcklin oder Thoma
von der Nachwelt über
einen Liebermann oder
Claude Monet gestellt
werden, wenn ich diese
als Vetreter des Naturalismus oder Realismus hin-
stellen kann.
Nun ist allerdings die Gartenkunst der Malerei
in bezug auf das Vermögen, künstlerische Werte (Ewig-
keitswerte!) auszudrücken, durchaus nicht eben-
bürtig. Sie ist in diesem Sinne keine hohe Kunst,
zu der man sie immer stempeln möchte. Aber wer
gerade Pücklers Landschaftsgärten zu sehen versteht,
der empfindet in ihnen etwas, wenn ich so sagen darf,
Übernatürliches — das Walten eines Schöpferwillens,
der nicht unbedingt der Natur gehorcht, sondern be-
weist, daß der Mensch Herr der Natur ist und
sein soll.
Und der Künstler muß immer Herr sein.
Freilich ein gütiger Herr, der versteht, mit was
er schaltet und waltet, der sich in sein Material hinein-
lebt und es nicht vergewaltigt, d. h. die Pflanze nicht
so verwendet, daß sie gleichsam leblose Atrappe wird
und an die Stelle eines toten Stoffes tritt.
DagegenhatPück-
ler, wie ich glaube,
auch manchmal gesün-
digt. Nämlich in sei-
nen Blumenschmuck-
stücken. Hier konnte
er bizarr sein und, die
Individualität der Blu-
men mißachtend, rein
dekorative Formen
schaffen. Mit dem
Baummaterial verfuhr
er ganz anders. Da
wußte er, daß ein
Baum auch Lebewesen
ist und seine ganz be-
stimmten individuellen
Züge hat. Demgemäß
verwendete er ihn. Und
wo kann man schönere
Individuen unserer be-
kannten Eichen, Lin-
den , Rüstern usw.
sehen, als gerade in
Pücklerschen Parkan-
lagen. Man fahre nur
mal im Winter hin,
wenn die Form der
Bäume so klar hervor-
tritt und oft besser
als im Sommer uns
ihre Eigenheiten er-
kennen lehrt!
Gerade in Branitz
gibt es ein klassisches
Beispiel dafür, von
welcher Bedeutung oft
ein einzelner Baum,
ein Individuum, sein
kann. Wenn man von der Gartenfront des Schlosses
in den Park hineinblickt, so erhebt sich im Mittel-
grund eine mächtige Linde, die anscheinend die
Großzügigkeit der Sicht, die Weite der Rasenfläche
beeinträchtigt. Viele haben nun vorgeschlagen, den
Baum zu fällen, um einen einheitlichen mächtigen
Fernblick zu gewinnen. Allein wenn man der Sache
*) Die Abbildungen Seite 24, 25, 26 oben, 28 und 29 sind
nach Aufnahmen von Obergärtner Boese, Cottbus, hergestellt,
für die dieser in dem Photogr. Wettbewerb der D. G. f. G.
einen III. Preis erhielt.
Branitz. Am „vergrabenen Bauer“ mit Blick nach dem Schloß*).
DIE GARTENKUNST.
XI, 2
Die naturwissenschaftliche Forschungsmethode er-
weitert nur unsere Gestaltungsmöglichkeiten und lehrt
uns, immer mehr Material zu verwenden.
Zur Kunst direkt führt sie aber gar nicht.
Nur insofern, als ein Künstler diese
neuen Forschungsergebnisse sich zunutze
macht und sie seiner künstlerischen Inten-
sion — nicht naturwissenschaftlichen Lehren
— gemäß verwer-
tet, wird die Land-
schaftsgestaltung
künstlerisch ge-
steigert.
W er da glaubt,
daß die naturalistische
Gestaltung das einzig
Wahre sei, der über-
sieht , daß die Be-
deutung jedes
Kunstwerkes in
seinem seelischen
Gehalt liegt. Was
wir jetzt in der Garten-
kunst erleben, geht in
der Malerei z. B. be-
reits vor sich. Der
Naturalismus, der nur
die Wiedergabe des
Objektes anstrebte und
nicht wollte, daß der
Künstler seine Seele
hineinlegte, er beginnt
sich zu überleben. Man
schätzt ihn wohl sehr
hoch, weil er den
Blick für vieles ge-
schärft, uns aus einer
falschen, rein sentimen-
talen Betrachtungs-
weise gerissen hat,
aber schließlich glaube
ich doch, daß ein
Böcklin oder Thoma
von der Nachwelt über
einen Liebermann oder
Claude Monet gestellt
werden, wenn ich diese
als Vetreter des Naturalismus oder Realismus hin-
stellen kann.
Nun ist allerdings die Gartenkunst der Malerei
in bezug auf das Vermögen, künstlerische Werte (Ewig-
keitswerte!) auszudrücken, durchaus nicht eben-
bürtig. Sie ist in diesem Sinne keine hohe Kunst,
zu der man sie immer stempeln möchte. Aber wer
gerade Pücklers Landschaftsgärten zu sehen versteht,
der empfindet in ihnen etwas, wenn ich so sagen darf,
Übernatürliches — das Walten eines Schöpferwillens,
der nicht unbedingt der Natur gehorcht, sondern be-
weist, daß der Mensch Herr der Natur ist und
sein soll.
Und der Künstler muß immer Herr sein.
Freilich ein gütiger Herr, der versteht, mit was
er schaltet und waltet, der sich in sein Material hinein-
lebt und es nicht vergewaltigt, d. h. die Pflanze nicht
so verwendet, daß sie gleichsam leblose Atrappe wird
und an die Stelle eines toten Stoffes tritt.
DagegenhatPück-
ler, wie ich glaube,
auch manchmal gesün-
digt. Nämlich in sei-
nen Blumenschmuck-
stücken. Hier konnte
er bizarr sein und, die
Individualität der Blu-
men mißachtend, rein
dekorative Formen
schaffen. Mit dem
Baummaterial verfuhr
er ganz anders. Da
wußte er, daß ein
Baum auch Lebewesen
ist und seine ganz be-
stimmten individuellen
Züge hat. Demgemäß
verwendete er ihn. Und
wo kann man schönere
Individuen unserer be-
kannten Eichen, Lin-
den , Rüstern usw.
sehen, als gerade in
Pücklerschen Parkan-
lagen. Man fahre nur
mal im Winter hin,
wenn die Form der
Bäume so klar hervor-
tritt und oft besser
als im Sommer uns
ihre Eigenheiten er-
kennen lehrt!
Gerade in Branitz
gibt es ein klassisches
Beispiel dafür, von
welcher Bedeutung oft
ein einzelner Baum,
ein Individuum, sein
kann. Wenn man von der Gartenfront des Schlosses
in den Park hineinblickt, so erhebt sich im Mittel-
grund eine mächtige Linde, die anscheinend die
Großzügigkeit der Sicht, die Weite der Rasenfläche
beeinträchtigt. Viele haben nun vorgeschlagen, den
Baum zu fällen, um einen einheitlichen mächtigen
Fernblick zu gewinnen. Allein wenn man der Sache
*) Die Abbildungen Seite 24, 25, 26 oben, 28 und 29 sind
nach Aufnahmen von Obergärtner Boese, Cottbus, hergestellt,
für die dieser in dem Photogr. Wettbewerb der D. G. f. G.
einen III. Preis erhielt.
Branitz. Am „vergrabenen Bauer“ mit Blick nach dem Schloß*).