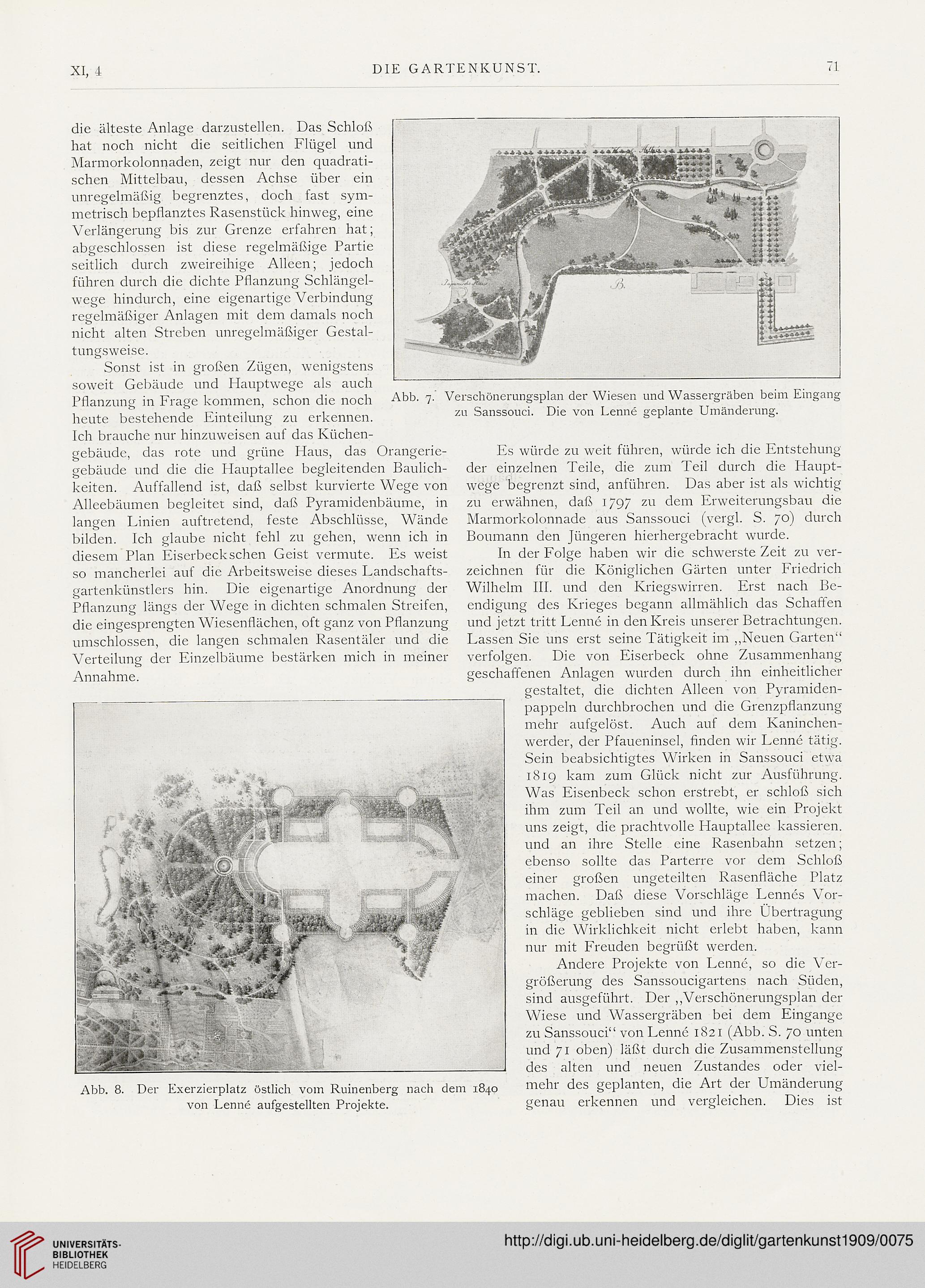XI, 4
DIE GARTENKUNST.
71
Abb. 7. Verschönerungsplan der Wiesen und Wassergräben beim Eingang
zu Sanssouci. Die von Lenne geplante Umänderung.
die älteste Anlage darzustellen. Das Schloß
hat noch nicht die seitlichen Flügel und
Marmorkolonnaden, zeigt nur den quadrati-
schen Mittelbau, dessen Achse über ein
unregelmäßig, begrenztes, doch fast sym-
metrisch bepflanztes Rasenstück hinweg, eine
Verlängerung bis zur Grenze erfahren hat;
abgeschlossen ist diese regelmäßige Partie
seitlich durch zweireihige Alleen; jedoch
führen durch die dichte Pflanzung Schlängel-
wege hindurch, eine eigenartige Verbindung
regelmäßiger Anlagen mit dem damals noch
nicht alten Streben unregelmäßiger Gestal-
tungsweise.
Sonst ist in großen Zügen, wenigstens
soweit Gebäude und Hauptwege als auch
Pflanzung in Frage kommen, schon die noch
heute bestehende Einteilung zu erkennen.
Ich brauche nur hinzuweisen auf das Küchen-
gebäude, das rote und grüne Haus, das Orangerie-
gebäude und die die Hauptallee begleitenden Baulich-
keiten. Auffallend ist, daß selbst kurvierte Wege von
Alleebäumen begleitet sind, daß Pyramidenbäume, in
langen Linien auftretend, feste Abschlüsse, Wände
bilden. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in
diesem Plan Eiserbeck sehen Geist vermute. Es weist
so mancherlei auf die Arbeitsweise dieses Landschafts-
gartenkünstlers hin. Die eigenartige Anordnung der
Pflanzung längs der Wege in dichten schmalen Streifen,
die eingesprengten Wiesenflächen, oft ganz von Pflanzung
umschlossen, die langen schmalen Rasentäler und die
Verteilung der Einzelbäume bestärken mich in meiner
Annahme.
Es würde zu weit führen, würde ich die Entstehung
der einzelnen Teile, die zum Teil durch die Haupt-
wege begrenzt sind, anführen. Das aber ist als wichtig
zu erwähnen, daß 1797 zu dem Erweiterungsbau die
Marmorkolonnade aus Sanssouci (vergl. S. 7°) durch
Boumann den Jüngeren hierhergebracht wurde.
In der Folge haben wir die schwerste Zeit zu ver-
zeichnen für die Königlichen Gärten unter Friedrich
Wilhelm III. und den Kriegswirren. Erst nach Be-
endigung des Krieges begann allmählich das Schaffen
und jetzt tritt Lenne in den Kreis unserer Betrachtungen.
Lassen Sie uns erst seine Tätigkeit im „Neuen Garten“
verfolgen. Die von Eiserbeck ohne Zusammenhang
geschaffenen Anlagen wurden durch ihn einheitlicher
gestaltet, die dichten Alleen von Pyramiden-
pappeln durchbrochen und die Grenzpflanzung
mehr aufgelöst. Auch auf dem Kaninchen-
werder, der Pfaueninsel, finden wir Lenne tätig.
Sein beabsichtigtes Wirken in Sanssouci etwa
1819 kam zum Glück nicht zur Ausführung.
Was Eisenbeck schon erstrebt, er schloß sich
ihm zum Teil an und wollte, wie ein Projekt
uns zeigt, die prachtvolle Hauptallee kassieren,
und an ihre Stelle eine Rasenbahn setzen;
ebenso sollte das Parterre vor dem Schloß
einer großen ungeteilten Rasenfläche Platz
machen. Daß diese Vorschläge Lennes Vor-
schläge geblieben sind und ihre Übertragung
in die Wirklichkeit nicht erlebt haben, kann
nur mit Freuden begrüßt werden.
Andere Projekte von Lenne, so die Ver-
größerung des Sanssoucigartens nach Süden,
sind ausgeführt. Der „Verschönerungsplan der
Wiese und Wassergräben bei dem Eingänge
zu Sanssouci“ von Lenne 1821 (Abb. S. 70 unten
und 71 oben) läßt durch die Zusammenstellung
des alten und neuen Zustandes oder viel-
mehr des geplanten, die Art der Umänderung
genau erkennen und vergleichen. Dies ist
Abb. 8. Der Exerzierplatz östlich vom Ruinenberg nach dem 1840
von Lenne aufgestellten Projekte.
DIE GARTENKUNST.
71
Abb. 7. Verschönerungsplan der Wiesen und Wassergräben beim Eingang
zu Sanssouci. Die von Lenne geplante Umänderung.
die älteste Anlage darzustellen. Das Schloß
hat noch nicht die seitlichen Flügel und
Marmorkolonnaden, zeigt nur den quadrati-
schen Mittelbau, dessen Achse über ein
unregelmäßig, begrenztes, doch fast sym-
metrisch bepflanztes Rasenstück hinweg, eine
Verlängerung bis zur Grenze erfahren hat;
abgeschlossen ist diese regelmäßige Partie
seitlich durch zweireihige Alleen; jedoch
führen durch die dichte Pflanzung Schlängel-
wege hindurch, eine eigenartige Verbindung
regelmäßiger Anlagen mit dem damals noch
nicht alten Streben unregelmäßiger Gestal-
tungsweise.
Sonst ist in großen Zügen, wenigstens
soweit Gebäude und Hauptwege als auch
Pflanzung in Frage kommen, schon die noch
heute bestehende Einteilung zu erkennen.
Ich brauche nur hinzuweisen auf das Küchen-
gebäude, das rote und grüne Haus, das Orangerie-
gebäude und die die Hauptallee begleitenden Baulich-
keiten. Auffallend ist, daß selbst kurvierte Wege von
Alleebäumen begleitet sind, daß Pyramidenbäume, in
langen Linien auftretend, feste Abschlüsse, Wände
bilden. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich in
diesem Plan Eiserbeck sehen Geist vermute. Es weist
so mancherlei auf die Arbeitsweise dieses Landschafts-
gartenkünstlers hin. Die eigenartige Anordnung der
Pflanzung längs der Wege in dichten schmalen Streifen,
die eingesprengten Wiesenflächen, oft ganz von Pflanzung
umschlossen, die langen schmalen Rasentäler und die
Verteilung der Einzelbäume bestärken mich in meiner
Annahme.
Es würde zu weit führen, würde ich die Entstehung
der einzelnen Teile, die zum Teil durch die Haupt-
wege begrenzt sind, anführen. Das aber ist als wichtig
zu erwähnen, daß 1797 zu dem Erweiterungsbau die
Marmorkolonnade aus Sanssouci (vergl. S. 7°) durch
Boumann den Jüngeren hierhergebracht wurde.
In der Folge haben wir die schwerste Zeit zu ver-
zeichnen für die Königlichen Gärten unter Friedrich
Wilhelm III. und den Kriegswirren. Erst nach Be-
endigung des Krieges begann allmählich das Schaffen
und jetzt tritt Lenne in den Kreis unserer Betrachtungen.
Lassen Sie uns erst seine Tätigkeit im „Neuen Garten“
verfolgen. Die von Eiserbeck ohne Zusammenhang
geschaffenen Anlagen wurden durch ihn einheitlicher
gestaltet, die dichten Alleen von Pyramiden-
pappeln durchbrochen und die Grenzpflanzung
mehr aufgelöst. Auch auf dem Kaninchen-
werder, der Pfaueninsel, finden wir Lenne tätig.
Sein beabsichtigtes Wirken in Sanssouci etwa
1819 kam zum Glück nicht zur Ausführung.
Was Eisenbeck schon erstrebt, er schloß sich
ihm zum Teil an und wollte, wie ein Projekt
uns zeigt, die prachtvolle Hauptallee kassieren,
und an ihre Stelle eine Rasenbahn setzen;
ebenso sollte das Parterre vor dem Schloß
einer großen ungeteilten Rasenfläche Platz
machen. Daß diese Vorschläge Lennes Vor-
schläge geblieben sind und ihre Übertragung
in die Wirklichkeit nicht erlebt haben, kann
nur mit Freuden begrüßt werden.
Andere Projekte von Lenne, so die Ver-
größerung des Sanssoucigartens nach Süden,
sind ausgeführt. Der „Verschönerungsplan der
Wiese und Wassergräben bei dem Eingänge
zu Sanssouci“ von Lenne 1821 (Abb. S. 70 unten
und 71 oben) läßt durch die Zusammenstellung
des alten und neuen Zustandes oder viel-
mehr des geplanten, die Art der Umänderung
genau erkennen und vergleichen. Dies ist
Abb. 8. Der Exerzierplatz östlich vom Ruinenberg nach dem 1840
von Lenne aufgestellten Projekte.