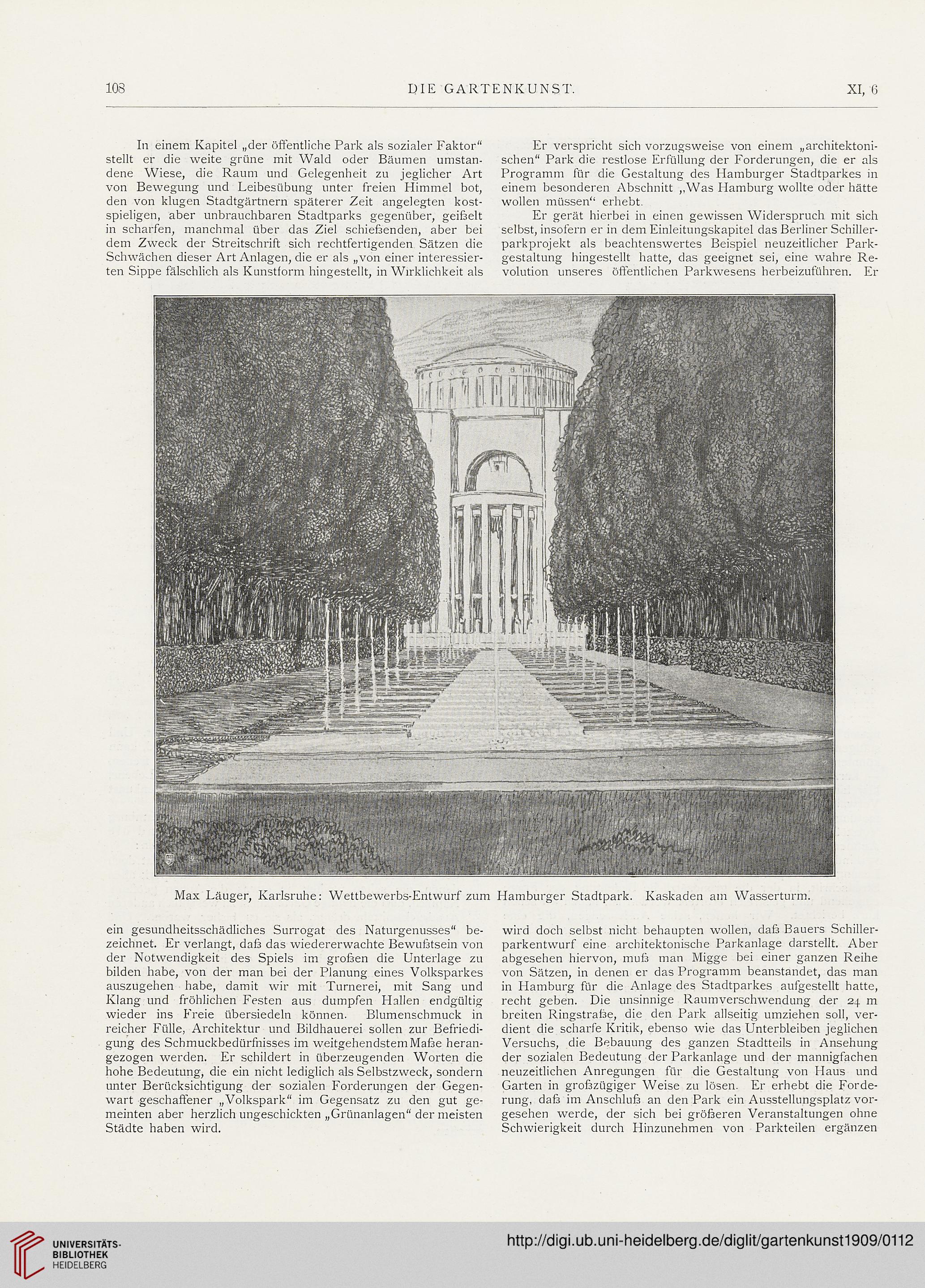108
DIE GARTENKUNST.
XI, 6
In einem Kapitel „der öffentliche Park als sozialer Faktor“
stellt er die weite grüne mit Wald oder Bäumen umstan-
dene Wiese, die Raum und Gelegenheit zu jeglicher Art
von Bewegung und Leibesübung unter freien Himmel bot,
den von klugen Stadtgärtnern späterer Zeit angelegten kost-
spieligen, aber unbrauchbaren Stadtparks gegenüber, geißelt
in scharfen, manchmal über das Ziel schießenden, aber bei
dem Zweck der Streitschrift sich rechtfertigenden Sätzen die
Schwächen dieser Art Anlagen, die er als „von einer interessier-
ten Sippe fälschlich als Kunstform hingestellt, in Wirklichkeit als
Er verspricht sich vorzugsweise von einem „architektoni-
schen“ Park die restlose Erfüllung der Forderungen, die er als
Programm für die Gestaltung des Hamburger Stadtparkes in
einem besonderen Abschnitt „Was Hamburg wollte oder hätte
wollen müssen“ erhebt.
Er gerät hierbei in einen gewissen Widerspruch mit sich
selbst, insofern er in dem Einleitungskapitel das Berliner Schiller-
parkprojekt als beachtenswertes Beispiel neuzeitlicher Park-
gestaltung hingestellt hatte, das geeignet sei, eine wahre Re-
volution unseres öffentlichen Parkwesens herbeizuführen. Er
Max Läuger, Karlsruhe: Wettbewerbs-Entwurf zum Hamburger Stadtpark. Kaskaden am Wasserturm.
ein gesundheitsschädliches Surrogat des Naturgenusses“ be-
zeichnet. Er verlangt, daß das wiedererwachte Bewußtsein von
der Notwendigkeit des Spiels im großen die Unterlage zu
bilden habe, von der man bei der Planung eines Volksparkes
auszugehen habe, damit wir mit Turnerei, mit Sang und
Klang und fröhlichen Festen aus dumpfen Hallen endgültig
wieder ins Freie übersiedeln können. Blumenschmuck in
reicher Fülle, Architektur und Bildhauerei sollen zur Befriedi-
gung des Schmuckbedürfnisses im weitgehendstem Maße heran-
gezogen werden. Er schildert in überzeugenden Worten die
hohe Bedeutung, die ein nicht lediglich als Selbstzweck, sondern
unter Berücksichtigung der sozialen Forderungen der Gegen-
wart geschaffener „Volkspark“ im Gegensatz zu den gut ge-
meinten aber herzlich ungeschickten „Grünanlagen“ der meisten
Städte haben wird.
wird doch selbst nicht behaupten wollen, daß Bauers Schiller-
parkentwurf eine architektonische Parkanlage darstellt. Aber
abgesehen hiervon, muß man Migge bei einer ganzen Reihe
von Sätzen, in denen er das Programm beanstandet, das man
in Hamburg für die Anlage des Stadtparkes aufgestellt hatte,
recht geben. Die unsinnige Raumverschwendung der 24 m
breiten Ringstraße, die den Park allseitig umziehen soll, ver-
dient die scharfe Kritik, ebenso wie das Unterbleiben jeglichen
Versuchs, die Bebauung des ganzen Stadtteils in Ansehung
der sozialen Bedeutung der Parkanlage und der mannigfachen
neuzeitlichen Anregungen für die Gestaltung von Haus und
Garten in großzügiger Weise zu lösen. Er erhebt die Forde-
rung, daß im Anschluß an den Park ein Ausstellungsplatz vor-
gesehen werde, der sich bei größeren Veranstaltungen ohne
Schwierigkeit durch Hinzunehmen von Parkteilen ergänzen
DIE GARTENKUNST.
XI, 6
In einem Kapitel „der öffentliche Park als sozialer Faktor“
stellt er die weite grüne mit Wald oder Bäumen umstan-
dene Wiese, die Raum und Gelegenheit zu jeglicher Art
von Bewegung und Leibesübung unter freien Himmel bot,
den von klugen Stadtgärtnern späterer Zeit angelegten kost-
spieligen, aber unbrauchbaren Stadtparks gegenüber, geißelt
in scharfen, manchmal über das Ziel schießenden, aber bei
dem Zweck der Streitschrift sich rechtfertigenden Sätzen die
Schwächen dieser Art Anlagen, die er als „von einer interessier-
ten Sippe fälschlich als Kunstform hingestellt, in Wirklichkeit als
Er verspricht sich vorzugsweise von einem „architektoni-
schen“ Park die restlose Erfüllung der Forderungen, die er als
Programm für die Gestaltung des Hamburger Stadtparkes in
einem besonderen Abschnitt „Was Hamburg wollte oder hätte
wollen müssen“ erhebt.
Er gerät hierbei in einen gewissen Widerspruch mit sich
selbst, insofern er in dem Einleitungskapitel das Berliner Schiller-
parkprojekt als beachtenswertes Beispiel neuzeitlicher Park-
gestaltung hingestellt hatte, das geeignet sei, eine wahre Re-
volution unseres öffentlichen Parkwesens herbeizuführen. Er
Max Läuger, Karlsruhe: Wettbewerbs-Entwurf zum Hamburger Stadtpark. Kaskaden am Wasserturm.
ein gesundheitsschädliches Surrogat des Naturgenusses“ be-
zeichnet. Er verlangt, daß das wiedererwachte Bewußtsein von
der Notwendigkeit des Spiels im großen die Unterlage zu
bilden habe, von der man bei der Planung eines Volksparkes
auszugehen habe, damit wir mit Turnerei, mit Sang und
Klang und fröhlichen Festen aus dumpfen Hallen endgültig
wieder ins Freie übersiedeln können. Blumenschmuck in
reicher Fülle, Architektur und Bildhauerei sollen zur Befriedi-
gung des Schmuckbedürfnisses im weitgehendstem Maße heran-
gezogen werden. Er schildert in überzeugenden Worten die
hohe Bedeutung, die ein nicht lediglich als Selbstzweck, sondern
unter Berücksichtigung der sozialen Forderungen der Gegen-
wart geschaffener „Volkspark“ im Gegensatz zu den gut ge-
meinten aber herzlich ungeschickten „Grünanlagen“ der meisten
Städte haben wird.
wird doch selbst nicht behaupten wollen, daß Bauers Schiller-
parkentwurf eine architektonische Parkanlage darstellt. Aber
abgesehen hiervon, muß man Migge bei einer ganzen Reihe
von Sätzen, in denen er das Programm beanstandet, das man
in Hamburg für die Anlage des Stadtparkes aufgestellt hatte,
recht geben. Die unsinnige Raumverschwendung der 24 m
breiten Ringstraße, die den Park allseitig umziehen soll, ver-
dient die scharfe Kritik, ebenso wie das Unterbleiben jeglichen
Versuchs, die Bebauung des ganzen Stadtteils in Ansehung
der sozialen Bedeutung der Parkanlage und der mannigfachen
neuzeitlichen Anregungen für die Gestaltung von Haus und
Garten in großzügiger Weise zu lösen. Er erhebt die Forde-
rung, daß im Anschluß an den Park ein Ausstellungsplatz vor-
gesehen werde, der sich bei größeren Veranstaltungen ohne
Schwierigkeit durch Hinzunehmen von Parkteilen ergänzen