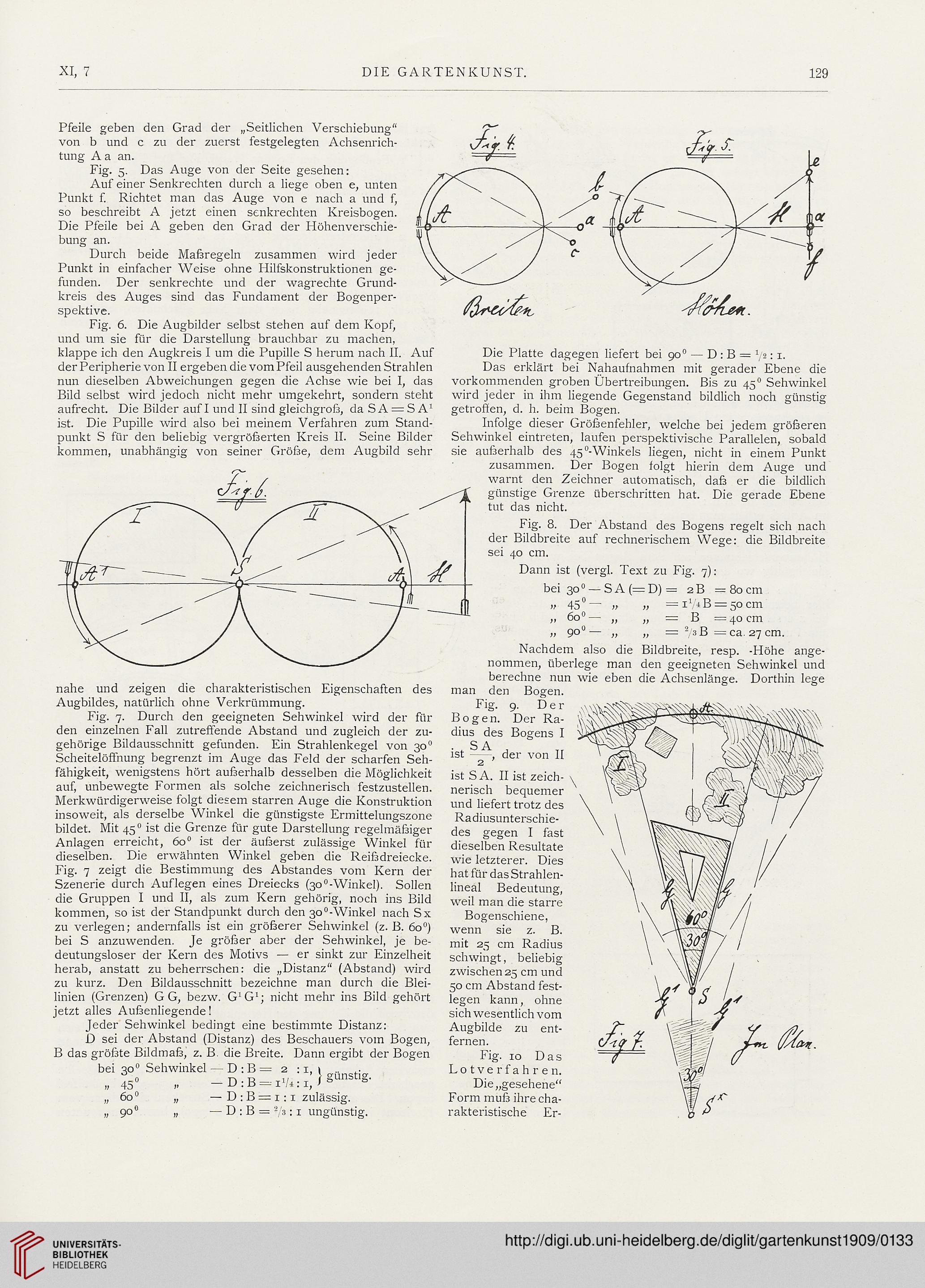XI, 7
DIE GARTENKUNST.
129
Pfeile geben den Grad der „Seitlichen Verschiebung“
von b und c zu der zuerst festgelegten Achsenrich-
tung A a an.
Fig. 5, Das Auge von der Seite gesehen:
Auf einer Senkrechten durch a liege oben e, unten
Punkt f. Richtet man das Auge von e nach a und f,
so beschreibt A jetzt einen senkrechten Kreisbogen.
Die Pfeile bei A geben den Grad der Höhenverschie-
bung an.
Durch beide Maßregeln zusammen wird jeder
Punkt in einfacher Weise ohne Hilfskonstruktionen ge-
funden. Der senkrechte und der wagrechte Grund-
kreis des Auges sind das Fundament der Bogenper-
spektive.
Fig. 6. Die Augbilder selbst stehen auf dem Kopf,
Auf
die
wie eben
des
man
für
zu-
300
bei 30°
„ 45°
„ 60»
,, 9°°
und um sie für die Darstellung brauchbar zu machen,
klappe ich den Augkreis I um die Pupille S herum nach II.
der Peripherie von II ergeben die vom Pfeil ausgehenden Strahlen
nun dieselben Abweichungen gegen die Achse wie bei I, das
Bild selbst wird jedoch nicht mehr umgekehrt, sondern steht
aufrecht. Die Bilder auf I und II sind gleichgroß, da S A = S A1
ist. Die Pupille wird also bei meinem Verfahren zum Stand-
punkt S für den beliebig vergrößerten Kreis II. Seine Bilder
kommen, unabhängig von seiner Größe, dem Augbild sehr
„ = i1/! B — 50 cm
„ — B =40 cm
„ = 2/s B = ca. 27 cm.
Bildbreite, resp. -Höhe ange-
den geeigneten Sehwinkel und
die Achsenlänge. Dorthin lege
30° — SA(=D)= 2B =80 cm
.-0
4t> —
6o° —
90° —
Nachdem also
notnmen, überlege man
berechne nun
den Bogen.
Fig. 9. Der
Bogen. Der Ra-
dius des Bogens I
S A
ist der von II
2
ist SA. II ist zeich-
nerisch bequemer
und liefert trotz des
Radiusunterschie-
des gegen I fast
dieselben Resultate
wie letzterer. Dies
hat für das Strahlen-
lineal Bedeutung,
weil man die starre
Bogenschiene,
wenn sie z. B.
mit 25 cm Radius
schwingt, beliebig
zwischen 25 cm und
50 cm Abstand fest-
legen kann, ohne
sich wesentlich vom
Augbilde zu ent-
fernen.
Fig. 10 Das
Lotverfahren.
Die „gesehene“
Form muß ihre cha-
rakteristische Er-
Die Platte dagegen liefert bei 90° — D : B = x/a: 1.
Das erklärt bei Nahaufnahmen mit gerader Ebene die
vorkommenden groben Übertreibungen. Bis zu 45° Sehwinkel
wird jeder in ihm liegende Gegenstand bildlich noch günstig
getroffen, d. h. beim Bogen.
Infolge dieser Größenfehler, welche bei jedem größeren
Sehwinkel eintreten, laufen perspektivische Parallelen, sobald
sie außerhalb des 45 “-Winkels liegen, nicht in einem Punkt
zusammen. Der Bogen folgt hierin dem Auge und
warnt den Zeichner automatisch, daß er die bildlich
günstige Grenze überschritten hat. Die gerade Ebene
tut das nicht.
Fig. 8. Der Abstand des Bogens regelt sich nach
der Bildbreite auf rechnerischem Wege: die Bildbreite
sei 40 cm.
Dann ist (vergl. Text zu Fig. 7):
bei
nahe und zeigen die charakteristischen Eigenschaften
Augbildes, natürlich ohne Verkrümmung.
Fig. 7. Durch den geeigneten Sehwinkel wird der
den einzelnen Fall zutreffende Abstand und zugleich der
gehörige Bildausschnitt gefunden. Ein Strahlenkegel von
Scheitelöffnung begrenzt im Auge das Feld der scharfen Seh-
fähigkeit, wenigstens hört außerhalb desselben die Möglichkeit
auf, unbewegte Formen als solche zeichnerisch festzustellen.
Merkwürdigerweise folgt diesem starren Auge die Konstruktion
insoweit, als derselbe Winkel die günstigste Ermittelungszone
bildet. Mit 45° ist die Grenze für gute Darstellung regelmäßiger
Anlagen erreicht, 60“ ist der äußerst zulässige Winkel für
dieselben. Die erwähnten Winkel geben die Reifidreiecke.
Fig. 7 zeigt die Bestimmung des Abstandes vom Kern der
Szenerie durch Auf legen eines Dreiecks (30 “-Winkel). Sollen
die Gruppen I und II, als zum Kern gehörig, noch ins Bild
kommen, so ist der Standpunkt durch den 3o°-Winkel nach Sx
zu verlegen; andernfalls ist ein größerer Sehwinkel (z. B. 60°)
bei S anzuwenden. Je größer aber der Sehwinkel, je be-
deutungsloser der Kern des Motivs — er sinkt zur Einzelheit
herab, anstatt zu beherrschen: die „Distanz“ (Abstand) wird
zu kurz. Den Bildausschnitt bezeichne man durch die Blei-
linien (Grenzen) G G, bezw. G'G1; nicht mehr ins Bild gehört
jetzt alles Außenliegende!
Jeder Seh winkel bedingt eine bestimmte Distanz:
D sei der Abstand (Distanz) des Beschauers vom Bogen,
B das größte Bildmaß, z. B. die Breite. Dann ergibt der Bogen
„ -D:B = iVi:i,}gUnSt,g-
„ — D : B = 1 :1 zulässig.
„ — D : B = ?/s : 1 ungünstig.
DIE GARTENKUNST.
129
Pfeile geben den Grad der „Seitlichen Verschiebung“
von b und c zu der zuerst festgelegten Achsenrich-
tung A a an.
Fig. 5, Das Auge von der Seite gesehen:
Auf einer Senkrechten durch a liege oben e, unten
Punkt f. Richtet man das Auge von e nach a und f,
so beschreibt A jetzt einen senkrechten Kreisbogen.
Die Pfeile bei A geben den Grad der Höhenverschie-
bung an.
Durch beide Maßregeln zusammen wird jeder
Punkt in einfacher Weise ohne Hilfskonstruktionen ge-
funden. Der senkrechte und der wagrechte Grund-
kreis des Auges sind das Fundament der Bogenper-
spektive.
Fig. 6. Die Augbilder selbst stehen auf dem Kopf,
Auf
die
wie eben
des
man
für
zu-
300
bei 30°
„ 45°
„ 60»
,, 9°°
und um sie für die Darstellung brauchbar zu machen,
klappe ich den Augkreis I um die Pupille S herum nach II.
der Peripherie von II ergeben die vom Pfeil ausgehenden Strahlen
nun dieselben Abweichungen gegen die Achse wie bei I, das
Bild selbst wird jedoch nicht mehr umgekehrt, sondern steht
aufrecht. Die Bilder auf I und II sind gleichgroß, da S A = S A1
ist. Die Pupille wird also bei meinem Verfahren zum Stand-
punkt S für den beliebig vergrößerten Kreis II. Seine Bilder
kommen, unabhängig von seiner Größe, dem Augbild sehr
„ = i1/! B — 50 cm
„ — B =40 cm
„ = 2/s B = ca. 27 cm.
Bildbreite, resp. -Höhe ange-
den geeigneten Sehwinkel und
die Achsenlänge. Dorthin lege
30° — SA(=D)= 2B =80 cm
.-0
4t> —
6o° —
90° —
Nachdem also
notnmen, überlege man
berechne nun
den Bogen.
Fig. 9. Der
Bogen. Der Ra-
dius des Bogens I
S A
ist der von II
2
ist SA. II ist zeich-
nerisch bequemer
und liefert trotz des
Radiusunterschie-
des gegen I fast
dieselben Resultate
wie letzterer. Dies
hat für das Strahlen-
lineal Bedeutung,
weil man die starre
Bogenschiene,
wenn sie z. B.
mit 25 cm Radius
schwingt, beliebig
zwischen 25 cm und
50 cm Abstand fest-
legen kann, ohne
sich wesentlich vom
Augbilde zu ent-
fernen.
Fig. 10 Das
Lotverfahren.
Die „gesehene“
Form muß ihre cha-
rakteristische Er-
Die Platte dagegen liefert bei 90° — D : B = x/a: 1.
Das erklärt bei Nahaufnahmen mit gerader Ebene die
vorkommenden groben Übertreibungen. Bis zu 45° Sehwinkel
wird jeder in ihm liegende Gegenstand bildlich noch günstig
getroffen, d. h. beim Bogen.
Infolge dieser Größenfehler, welche bei jedem größeren
Sehwinkel eintreten, laufen perspektivische Parallelen, sobald
sie außerhalb des 45 “-Winkels liegen, nicht in einem Punkt
zusammen. Der Bogen folgt hierin dem Auge und
warnt den Zeichner automatisch, daß er die bildlich
günstige Grenze überschritten hat. Die gerade Ebene
tut das nicht.
Fig. 8. Der Abstand des Bogens regelt sich nach
der Bildbreite auf rechnerischem Wege: die Bildbreite
sei 40 cm.
Dann ist (vergl. Text zu Fig. 7):
bei
nahe und zeigen die charakteristischen Eigenschaften
Augbildes, natürlich ohne Verkrümmung.
Fig. 7. Durch den geeigneten Sehwinkel wird der
den einzelnen Fall zutreffende Abstand und zugleich der
gehörige Bildausschnitt gefunden. Ein Strahlenkegel von
Scheitelöffnung begrenzt im Auge das Feld der scharfen Seh-
fähigkeit, wenigstens hört außerhalb desselben die Möglichkeit
auf, unbewegte Formen als solche zeichnerisch festzustellen.
Merkwürdigerweise folgt diesem starren Auge die Konstruktion
insoweit, als derselbe Winkel die günstigste Ermittelungszone
bildet. Mit 45° ist die Grenze für gute Darstellung regelmäßiger
Anlagen erreicht, 60“ ist der äußerst zulässige Winkel für
dieselben. Die erwähnten Winkel geben die Reifidreiecke.
Fig. 7 zeigt die Bestimmung des Abstandes vom Kern der
Szenerie durch Auf legen eines Dreiecks (30 “-Winkel). Sollen
die Gruppen I und II, als zum Kern gehörig, noch ins Bild
kommen, so ist der Standpunkt durch den 3o°-Winkel nach Sx
zu verlegen; andernfalls ist ein größerer Sehwinkel (z. B. 60°)
bei S anzuwenden. Je größer aber der Sehwinkel, je be-
deutungsloser der Kern des Motivs — er sinkt zur Einzelheit
herab, anstatt zu beherrschen: die „Distanz“ (Abstand) wird
zu kurz. Den Bildausschnitt bezeichne man durch die Blei-
linien (Grenzen) G G, bezw. G'G1; nicht mehr ins Bild gehört
jetzt alles Außenliegende!
Jeder Seh winkel bedingt eine bestimmte Distanz:
D sei der Abstand (Distanz) des Beschauers vom Bogen,
B das größte Bildmaß, z. B. die Breite. Dann ergibt der Bogen
„ -D:B = iVi:i,}gUnSt,g-
„ — D : B = 1 :1 zulässig.
„ — D : B = ?/s : 1 ungünstig.