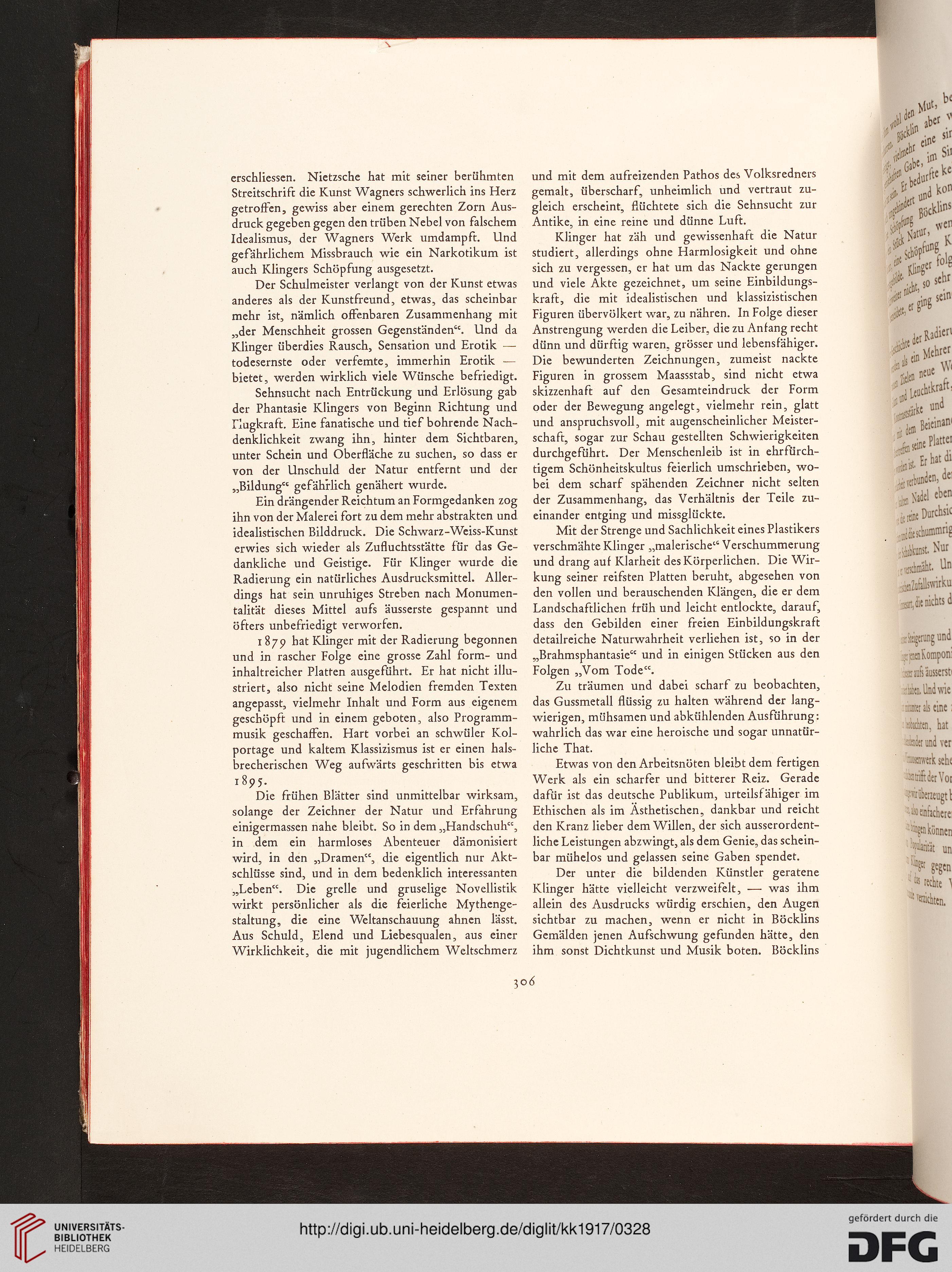10
>lut,
erschliesscn. Nietzsche hat mit seiner berühmten
Streitschrift die Kunst Wagners schwerlich ins Herz
getroffen, gewiss aber einem gerechten Zorn Aus-
druck gegeben gegen den trüben Nebel von falschem
Idealismus, der Wagners Werk umdampft. Und
gefährlichem Missbrauch wie ein Narkotikum ist
auch Klingers Schöpfung ausgesetzt.
Der Schulmeister verlangt von der Kunst etwas
anderes als der Kunstfreund, etwas, das scheinbar
mehr ist, nämlich offenbaren Zusammenhang mit
„der Menschheit grossen Gegenständen". Und da
Klinger überdies Rausch, Sensation und Erotik —
todesernste oder verfemte, immerhin Erotik —
bietet, werden wirklich viele Wünsche befriedigt.
Sehnsucht nach Entrückung und Erlösung gab
der Phantasie Klingers von Beginn Richtung und
rlugkraft. Eine fanatische und tief bohrende Nach-
denklichkeit zwang ihn, hinter dem Sichtbaren,
unter Schein und Oberfläche zu suchen, so dass er
von der Unschuld der Natur entfernt und der
„Bildung" gefährlich genähert wurde.
Ein drängender Reichtum an Formgedanken zog
ihn von der Malerei fort zu dem mehr abstrakten und
idealistischen Bilddruck. Die Schwarz-Weiss-Kunst
erwies sich wieder als Zufluchtsstätte für das Ge-
dankliche und Geistige. Für Klinger wurde die
Radierung ein natürliches Ausdrucksmittel. Aller-
dings hat sein unruhiges Streben nach Monumen-
talität dieses Mittel aufs äusserste gespannt und
öfters unbefriedigt verworfen.
1879 hat Klinger mit der Radierung begonnen
und in rascher Folge eine grosse Zahl form- und
inhaltreicher Platten ausgeführt. Er hat nicht illu-
striert, also nicht seine Melodien fremden Texten
angepasst, vielmehr Inhalt und Form aus eigenem
geschöpft und in einem geboten, also Programm-
musik geschaffen. Hart vorbei an schwüler Kol-
portage und kaltem Klassizismus ist er einen hals-
brecherischen Weg aufwärts geschritten bis etwa
1895.
Die frühen Blätter sind unmittelbar wirksam,
solange der Zeichner der Natur und Erfahrung
einigermassen nahe bleibt. So in dem „Handschuh",
in dem ein harmloses Abenteuer dämonisiert
wird, in den „Dramen", die eigentlich nur Akt-
schlüsse sind, und in dem bedenklich interessanten
„Leben". Die grelle und gruselige Novellistik
wirkt persönlicher als die feierliche Mythenge-
staltung, die eine Weltanschauung ahnen lässt.
Aus Schuld, Elend und Liebesqualen, aus einer
Wirklichkeit, die mit jugendlichem Weltschmerz
und mit dem aufreizenden Pathos des Volksredners
gemalt, überscharf, unheimlich und vertraut zu-
gleich erscheint, flüchtete sich die Sehnsucht zur
Antike, in eine reine und dünne Luft.
Klinger hat zäh und gewissenhaft die Natur
studiert, allerdings ohne Harmlosigkeit und ohne
sich zu vergessen, er hat um das Nackte gerungen
und viele Akte gezeichnet, um seine Einbildungs-
kraft, die mit idealistischen und klassizistischen
Figuren übervölkert war, zu nähren. In Folge dieser
Anstrengung werden die Leiber, die zu Anfang recht
dünn und dürftig waren, grösser und lebensfähiger.
Die bewunderten Zeichnungen, zumeist nackte
Figuren in grossem Maassstab, sind nicht etwa
skizzenhaft auf den Gesamteindruck der Form
oder der Bewegung angelegt, vielmehr rein, glatt
und anspruchsvoll, mit augenscheinlicher Meister-
schaft, sogar zur Schau gestellten Schwierigkeiten
durchgeführt. Der Menschenleib ist in ehrfürch-
tigem Schönheitskultus feierlich umschrieben, wo-
bei dem scharf spähenden Zeichner nicht selten
der Zusammenhang, das Verhältnis der Teile zu-
einander entging und missglückte.
Mit der Strenge und Sachlichkeit eines Plastikers
verschmähte Klinger „malerische" Verschummerung
und drang auf Klarheit des Körperlichen. Die Wir-
kung seiner reifsten Platten beruht, abgesehen von
den vollen und berauschenden Klängen, die er dem
Landschaftlichen früh und leicht entlockte, darauf,
dass den Gebilden einer freien Einbildungskraft
detailreiche Naturwahrheit verliehen ist, so in der
„Brahmsphantasie" und in einigen Stücken aus den
Folgen „Vom Tode".
Zu träumen und dabei scharf zu beobachten,
das Gussmetall flüssig zu halten während der lang-
wierigen, mühsamen und abkühlenden Ausführung:
wahrlich das war eine heroische und sogar unnatür-
liche That.
Etwas von den Arbeitsnöten bleibt dem fertigen
Werk als ein scharfer und bitterer Reiz. Gerade
dafür ist das deutsche Publikum, urteilsfähiger im
Ethischen als im Ästhetischen, dankbar und reicht
den Kranz lieber dem Willen, der sich ausserordent-
liche Leistungen abzwingt, als dem Genie, das schein-
bar mühelos und gelassen seine Gaben spendet.
Der unter die bildenden Künstler geratene
Klinger hätte vielleicht verzweifelt, — was ihm
allein des Ausdrucks würdig erschien, den Augen
sichtbar zu machen, wenn er nicht in Böcklins
Gemälden jenen Aufschwung gefunden hätte, den
ihm sonst Dichtkunst und Musik boten. Böcklins
■ftö*
c*~
. Zkkn neue
\ ki Beieman«
306
>lut,
erschliesscn. Nietzsche hat mit seiner berühmten
Streitschrift die Kunst Wagners schwerlich ins Herz
getroffen, gewiss aber einem gerechten Zorn Aus-
druck gegeben gegen den trüben Nebel von falschem
Idealismus, der Wagners Werk umdampft. Und
gefährlichem Missbrauch wie ein Narkotikum ist
auch Klingers Schöpfung ausgesetzt.
Der Schulmeister verlangt von der Kunst etwas
anderes als der Kunstfreund, etwas, das scheinbar
mehr ist, nämlich offenbaren Zusammenhang mit
„der Menschheit grossen Gegenständen". Und da
Klinger überdies Rausch, Sensation und Erotik —
todesernste oder verfemte, immerhin Erotik —
bietet, werden wirklich viele Wünsche befriedigt.
Sehnsucht nach Entrückung und Erlösung gab
der Phantasie Klingers von Beginn Richtung und
rlugkraft. Eine fanatische und tief bohrende Nach-
denklichkeit zwang ihn, hinter dem Sichtbaren,
unter Schein und Oberfläche zu suchen, so dass er
von der Unschuld der Natur entfernt und der
„Bildung" gefährlich genähert wurde.
Ein drängender Reichtum an Formgedanken zog
ihn von der Malerei fort zu dem mehr abstrakten und
idealistischen Bilddruck. Die Schwarz-Weiss-Kunst
erwies sich wieder als Zufluchtsstätte für das Ge-
dankliche und Geistige. Für Klinger wurde die
Radierung ein natürliches Ausdrucksmittel. Aller-
dings hat sein unruhiges Streben nach Monumen-
talität dieses Mittel aufs äusserste gespannt und
öfters unbefriedigt verworfen.
1879 hat Klinger mit der Radierung begonnen
und in rascher Folge eine grosse Zahl form- und
inhaltreicher Platten ausgeführt. Er hat nicht illu-
striert, also nicht seine Melodien fremden Texten
angepasst, vielmehr Inhalt und Form aus eigenem
geschöpft und in einem geboten, also Programm-
musik geschaffen. Hart vorbei an schwüler Kol-
portage und kaltem Klassizismus ist er einen hals-
brecherischen Weg aufwärts geschritten bis etwa
1895.
Die frühen Blätter sind unmittelbar wirksam,
solange der Zeichner der Natur und Erfahrung
einigermassen nahe bleibt. So in dem „Handschuh",
in dem ein harmloses Abenteuer dämonisiert
wird, in den „Dramen", die eigentlich nur Akt-
schlüsse sind, und in dem bedenklich interessanten
„Leben". Die grelle und gruselige Novellistik
wirkt persönlicher als die feierliche Mythenge-
staltung, die eine Weltanschauung ahnen lässt.
Aus Schuld, Elend und Liebesqualen, aus einer
Wirklichkeit, die mit jugendlichem Weltschmerz
und mit dem aufreizenden Pathos des Volksredners
gemalt, überscharf, unheimlich und vertraut zu-
gleich erscheint, flüchtete sich die Sehnsucht zur
Antike, in eine reine und dünne Luft.
Klinger hat zäh und gewissenhaft die Natur
studiert, allerdings ohne Harmlosigkeit und ohne
sich zu vergessen, er hat um das Nackte gerungen
und viele Akte gezeichnet, um seine Einbildungs-
kraft, die mit idealistischen und klassizistischen
Figuren übervölkert war, zu nähren. In Folge dieser
Anstrengung werden die Leiber, die zu Anfang recht
dünn und dürftig waren, grösser und lebensfähiger.
Die bewunderten Zeichnungen, zumeist nackte
Figuren in grossem Maassstab, sind nicht etwa
skizzenhaft auf den Gesamteindruck der Form
oder der Bewegung angelegt, vielmehr rein, glatt
und anspruchsvoll, mit augenscheinlicher Meister-
schaft, sogar zur Schau gestellten Schwierigkeiten
durchgeführt. Der Menschenleib ist in ehrfürch-
tigem Schönheitskultus feierlich umschrieben, wo-
bei dem scharf spähenden Zeichner nicht selten
der Zusammenhang, das Verhältnis der Teile zu-
einander entging und missglückte.
Mit der Strenge und Sachlichkeit eines Plastikers
verschmähte Klinger „malerische" Verschummerung
und drang auf Klarheit des Körperlichen. Die Wir-
kung seiner reifsten Platten beruht, abgesehen von
den vollen und berauschenden Klängen, die er dem
Landschaftlichen früh und leicht entlockte, darauf,
dass den Gebilden einer freien Einbildungskraft
detailreiche Naturwahrheit verliehen ist, so in der
„Brahmsphantasie" und in einigen Stücken aus den
Folgen „Vom Tode".
Zu träumen und dabei scharf zu beobachten,
das Gussmetall flüssig zu halten während der lang-
wierigen, mühsamen und abkühlenden Ausführung:
wahrlich das war eine heroische und sogar unnatür-
liche That.
Etwas von den Arbeitsnöten bleibt dem fertigen
Werk als ein scharfer und bitterer Reiz. Gerade
dafür ist das deutsche Publikum, urteilsfähiger im
Ethischen als im Ästhetischen, dankbar und reicht
den Kranz lieber dem Willen, der sich ausserordent-
liche Leistungen abzwingt, als dem Genie, das schein-
bar mühelos und gelassen seine Gaben spendet.
Der unter die bildenden Künstler geratene
Klinger hätte vielleicht verzweifelt, — was ihm
allein des Ausdrucks würdig erschien, den Augen
sichtbar zu machen, wenn er nicht in Böcklins
Gemälden jenen Aufschwung gefunden hätte, den
ihm sonst Dichtkunst und Musik boten. Böcklins
■ftö*
c*~
. Zkkn neue
\ ki Beieman«
306