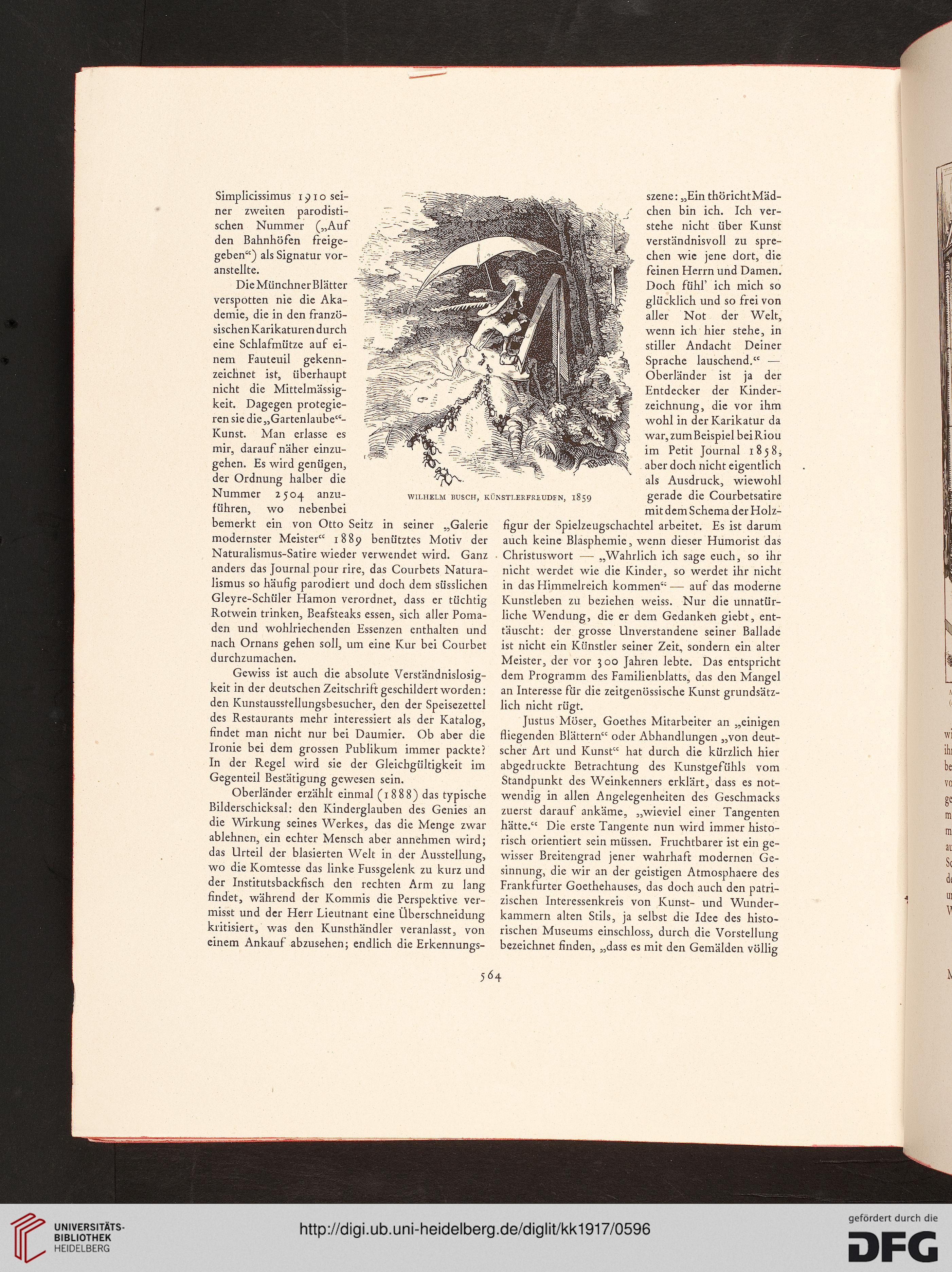WILHELM BUSCH, KUNSTLEKFREUMN
Simplicissimus i p i o sei-
ner zweiten parodisti-
schen Nummer („Auf
den Bahnhöfen freige-
geben") als Signatur vor-
anstellte.
Die MünchnerBlätter
verspotten nie die Aka-
demie, die in den franzö-
sischen Karikaturen durch
eine Schlafmütze auf ei-
nem Fauteuil gekenn-
zeichnet ist, überhaupt
nicht die Mittelmässig-
keit. Dagegen protegie-
ren sie die „Gartenlauben-
Kunst. Man erlasse es
mir, darauf näher einzu-
gehen. Es wird genügen,
der Ordnung halber die
Nummer 2504 anzu-
führen, wo nebenbei
bemerkt ein von Otto Seitz in seiner „Galerie
modernster Meister" 18 8p benutztes Motiv der
Naturalismus-Satire wieder verwendet wird. Ganz
anders das Journal pour rire, das Courbets Natura-
lismus so häufig parodiert und doch dem süsslichen
Gleyre-Schüler Hamon verordnet, dass er tüchtig
Rotwein trinken, Beafsteaks essen, sich aller Poma-
den und wohlriechenden Essenzen enthalten und
nach Omans gehen soll, um eine Kur bei Courbet
durchzumachen.
Gewiss ist auch die absolute Verständnislosig-
keit in der deutschen Zeitschrift geschildert worden:
den Kunstausstellungsbesucher, den der Speisezettel
des Restaurants mehr interessiert als der Katalog,
findet man nicht nur bei Daumier. Ob aber die
Ironie bei dem grossen Publikum immer packte?
In der Regel wird sie der Gleichgültigkeit im
Gegenteil Bestätigung gewesen sein.
Oberländer erzählt einmal (1888) das typische
Bilderschicksal: den Kinderglauben des Genies an
die Wirkung seines Werkes, das die Menge zwar
ablehnen, ein echter Mensch aber annehmen wird;
das Urteil der blasierten Welt in der Ausstellung,
szene: „Ein thörichtMäd-
chen bin ich. Ich ver-
stehe nicht über Kunst
verständnisvoll zu spre-
chen wie jene dort, die
feinen Herrn und Damen.
Doch fühl' ich mich so
glücklich und so frei von
aller Not der Welt,
wenn ich hier stehe, in
stiller Andacht Deiner
Sprache lauschend." —
Oberländer ist ja der
Entdecker der Kinder-
zeichnung, die vor ihm
wohl in der Karikatur da
war, zum Beispiel beiRiou
im Petit Journal 1858,
aber doch nicht eigentlich
als Ausdruck, wiewohl
gerade die Courbetsatire
mit dem Schema der Holz-
figur der Spielzeugschachtel arbeitet. Es ist darum
auch keine Blasphemie, wenn dieser Humorist das
Christuswort — „Wahrlich ich sage euch, so ihr
nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen" — auf das moderne
Kunstleben zu beziehen weiss. Nur die unnatür-
liche Wendung, die er dem Gedanken giebt, ent-
täuscht: der grosse Unverstandene seiner Ballade
ist nicht ein Künstler seiner Zeit, sondern ein alter
Meister, der vor 300 Jahren lebte. Das entspricht
dem Programm des Familienblatts, das den Mangel
an Interesse für die zeitgenössische Kunst grundsätz-
lich nicht rügt.
Justus Moser, Goethes Mitarbeiter an „einigen
fliegenden Blättern" oder Abhandlungen „von deut-
scher Art und Kunst" hat durch die kürzlich hier
abgedruckte Betrachtung des Kunstgefühls vom
Standpunkt des Weinkenners erklärt, dass es not-
wendig in allen Angelegenheiten des Geschmacks
zuerst darauf ankäme, „wieviel einer Tangenten
hätte." Die erste Tangente nun wird immer histo-
risch orientiert sein müssen. Fruchtbarer ist ein ge-
wisser Breitengrad jener wahrhaft modernen Ge-
wo die Komtesse das linke Fussgelenk zu kurz und sinnung, die wir an der geistigen Atmosphaere des
der Institutsbackfisch den rechten Arm zu lang
findet, während der Kommis die Perspektive ver-
misst und der Herr Lieutnant eine Überschneidung
kritisiert, was den Kunsthändler veranlasst, von
einem Ankauf abzusehen; endlich die Erkennungs-
Frankfurter Goethehauses, das doch auch den patri-
zischen Interessenkreis von Kunst- und Wunder-
kammern alten Stils, ja selbst die Idee des histo-
rischen Museums einschloss, durch die Vorstellung
bezeichnet finden, „dass es mit den Gemälden völlig
564
Simplicissimus i p i o sei-
ner zweiten parodisti-
schen Nummer („Auf
den Bahnhöfen freige-
geben") als Signatur vor-
anstellte.
Die MünchnerBlätter
verspotten nie die Aka-
demie, die in den franzö-
sischen Karikaturen durch
eine Schlafmütze auf ei-
nem Fauteuil gekenn-
zeichnet ist, überhaupt
nicht die Mittelmässig-
keit. Dagegen protegie-
ren sie die „Gartenlauben-
Kunst. Man erlasse es
mir, darauf näher einzu-
gehen. Es wird genügen,
der Ordnung halber die
Nummer 2504 anzu-
führen, wo nebenbei
bemerkt ein von Otto Seitz in seiner „Galerie
modernster Meister" 18 8p benutztes Motiv der
Naturalismus-Satire wieder verwendet wird. Ganz
anders das Journal pour rire, das Courbets Natura-
lismus so häufig parodiert und doch dem süsslichen
Gleyre-Schüler Hamon verordnet, dass er tüchtig
Rotwein trinken, Beafsteaks essen, sich aller Poma-
den und wohlriechenden Essenzen enthalten und
nach Omans gehen soll, um eine Kur bei Courbet
durchzumachen.
Gewiss ist auch die absolute Verständnislosig-
keit in der deutschen Zeitschrift geschildert worden:
den Kunstausstellungsbesucher, den der Speisezettel
des Restaurants mehr interessiert als der Katalog,
findet man nicht nur bei Daumier. Ob aber die
Ironie bei dem grossen Publikum immer packte?
In der Regel wird sie der Gleichgültigkeit im
Gegenteil Bestätigung gewesen sein.
Oberländer erzählt einmal (1888) das typische
Bilderschicksal: den Kinderglauben des Genies an
die Wirkung seines Werkes, das die Menge zwar
ablehnen, ein echter Mensch aber annehmen wird;
das Urteil der blasierten Welt in der Ausstellung,
szene: „Ein thörichtMäd-
chen bin ich. Ich ver-
stehe nicht über Kunst
verständnisvoll zu spre-
chen wie jene dort, die
feinen Herrn und Damen.
Doch fühl' ich mich so
glücklich und so frei von
aller Not der Welt,
wenn ich hier stehe, in
stiller Andacht Deiner
Sprache lauschend." —
Oberländer ist ja der
Entdecker der Kinder-
zeichnung, die vor ihm
wohl in der Karikatur da
war, zum Beispiel beiRiou
im Petit Journal 1858,
aber doch nicht eigentlich
als Ausdruck, wiewohl
gerade die Courbetsatire
mit dem Schema der Holz-
figur der Spielzeugschachtel arbeitet. Es ist darum
auch keine Blasphemie, wenn dieser Humorist das
Christuswort — „Wahrlich ich sage euch, so ihr
nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht
in das Himmelreich kommen" — auf das moderne
Kunstleben zu beziehen weiss. Nur die unnatür-
liche Wendung, die er dem Gedanken giebt, ent-
täuscht: der grosse Unverstandene seiner Ballade
ist nicht ein Künstler seiner Zeit, sondern ein alter
Meister, der vor 300 Jahren lebte. Das entspricht
dem Programm des Familienblatts, das den Mangel
an Interesse für die zeitgenössische Kunst grundsätz-
lich nicht rügt.
Justus Moser, Goethes Mitarbeiter an „einigen
fliegenden Blättern" oder Abhandlungen „von deut-
scher Art und Kunst" hat durch die kürzlich hier
abgedruckte Betrachtung des Kunstgefühls vom
Standpunkt des Weinkenners erklärt, dass es not-
wendig in allen Angelegenheiten des Geschmacks
zuerst darauf ankäme, „wieviel einer Tangenten
hätte." Die erste Tangente nun wird immer histo-
risch orientiert sein müssen. Fruchtbarer ist ein ge-
wisser Breitengrad jener wahrhaft modernen Ge-
wo die Komtesse das linke Fussgelenk zu kurz und sinnung, die wir an der geistigen Atmosphaere des
der Institutsbackfisch den rechten Arm zu lang
findet, während der Kommis die Perspektive ver-
misst und der Herr Lieutnant eine Überschneidung
kritisiert, was den Kunsthändler veranlasst, von
einem Ankauf abzusehen; endlich die Erkennungs-
Frankfurter Goethehauses, das doch auch den patri-
zischen Interessenkreis von Kunst- und Wunder-
kammern alten Stils, ja selbst die Idee des histo-
rischen Museums einschloss, durch die Vorstellung
bezeichnet finden, „dass es mit den Gemälden völlig
564