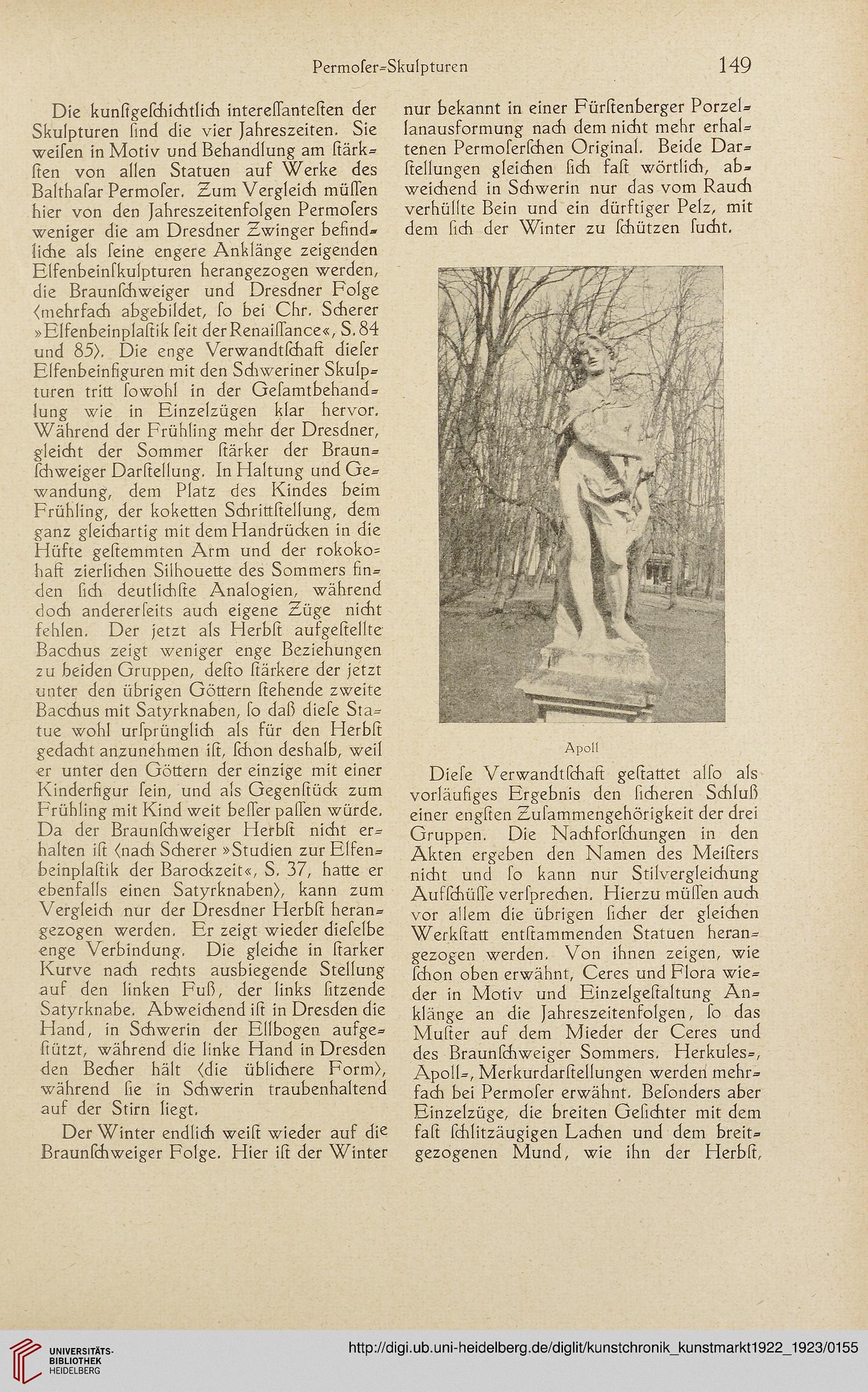Permofer-Skulpturen
149
Die kunfigefchicfitlich intereffanteften der
Skulpturen find die vier Jahreszeiten. Sie
weifen in Motiv und Behandlung am ftärk-
fien von allen Statuen auf Werke des
Balthafar Permofer. Zum Vergleich müffen
hier von den Jahreszeitenfolgen Permofers
weniger die am Dresdner Zwinger befind-
liche als feine engere Anklänge zeigenden
Elfenbeinfkulpturen herangezogen werden,
die Braunfchweiger und Dresdner Folge
•(mehrfach abgebildet, fo bei Chr. Scherer
»Elfenbeinplaftik feit der Renaiffance«, S. 84
und 85). Die enge Verwandtlchaft diefer
Elfenbeinfiguren mit den Sdrweriner Skulp-
turen tritt fowoh! in der Gefamtbehand-
lung wie in Einzelzügen klar hervor.
Während der Frühling mehr der Dresdner,
gleicht der Sommer fiärker der Braun-
fchweiger Darftellung. In Haltung und Ge-
wandung, dem Platz des Kindes beim
Frühling, der koketten Schrittftellung, dem
ganz gleichartig mit dem Handrücken in die
Hüfte gehemmten Arm und der rokoko-
haft zierlichen Silhouette des Sommers fin-
den fich deutlichfte Analogien, während
doch andererfeits auch eigene Züge nicht
fehlen. Der jetzt als Herbft aufgefiellte
Bacchus zeigt weniger enge Beziehungen
zu beiden Gruppen, delto fiärkere der jetzt
unter den übrigen Göttern flehende zweite
Bacchus mit Satyrknaben, fo daß diefe Sta-
tue wohl urfprünglich als für den Herbft
gedacht anzunehmen ift, fchon deshalb, weil
er unter den Göttern der einzige mit einer
Kinderfigur fein, und als Gegenftüdk zum
Frühling mit Kind weit belfer paffen würde.
Da der Braunfchweiger Herbft nicht er-
halten ift (nach Scherer »Studien zur Elfen-
beinplaftik der Barockzeit«, S. 37, hatte er
ebenfalls einen Satyrknaben), kann zum
Vergleich nur der Dresdner Herbft heran-
gezogen werden. Er zeigt wieder diefelbe
enge Verbindung, Die gleiche in ftarker
Kurve nach rechts ausbiegende Stellung
auf den linken Fuß, der links fitzende
Satyrknabe. Abweichend ift in Dresden die
Hand, in Schwerin der Ellbogen aufge-
ftützt, während die linke Hand in Dresden
den Becher hält (die üblichere Form),
während fie in Schwerin traubenhaltend
auf der Stirn liegt.
Der Winter endlich weift wieder auf die
Braunfchweiger Folge. Hier ift der Winter
nur bekannt in einer Fürftenberger Porzel-
lanausformung nach dem nicht mehr erhal-
tenen Permoferfchen Original. Beide Dar-
ftellungen gleichen fich faft wörtlich, ab-
weichend in Schwerin nur das vom Rauch
verhüllte Bein und ein dürftiger Pelz, mit
dem fich der Winter zu fchützen fucht.
Apoll
Diefe Verwandtfdhaft gefiattet alfo als
vorläufiges Ergebnis den fieberen Schluß
einer engfien Zufammengehörigkeit der drei
Gruppen. Die Nachforfdhungen in den
Akten ergeben den Namen des Meifters
nicht und fo kann nur Stilvergleichung
Auffchüffe verfprechen. Hierzu müffen auch
vor allem die übrigen fieber der gleichen
Werkfiatt entflammenden Statuen heran-
gezogen werden. Von ihnen zeigen, wie
fchon oben erwähnt, Ceres und Flora wie-
der in Motiv und Einzelgefialtung An-
klänge an die Jahreszeitenfolgen, fo das
Mufter auf dem Mieder der Ceres und
des Braunfchweiger Sommers. Herkules-,
Apoll-, Merkurdarftellungen werden mehr-
fach bei Permofer erwähnt. Befonders aber
Einzelzüge, die breiten Geflöhter mit dem
faft fchlitzäugigen Lachen und dem breit-
gezogenen Mund, wie ihn der Herbft,
149
Die kunfigefchicfitlich intereffanteften der
Skulpturen find die vier Jahreszeiten. Sie
weifen in Motiv und Behandlung am ftärk-
fien von allen Statuen auf Werke des
Balthafar Permofer. Zum Vergleich müffen
hier von den Jahreszeitenfolgen Permofers
weniger die am Dresdner Zwinger befind-
liche als feine engere Anklänge zeigenden
Elfenbeinfkulpturen herangezogen werden,
die Braunfchweiger und Dresdner Folge
•(mehrfach abgebildet, fo bei Chr. Scherer
»Elfenbeinplaftik feit der Renaiffance«, S. 84
und 85). Die enge Verwandtlchaft diefer
Elfenbeinfiguren mit den Sdrweriner Skulp-
turen tritt fowoh! in der Gefamtbehand-
lung wie in Einzelzügen klar hervor.
Während der Frühling mehr der Dresdner,
gleicht der Sommer fiärker der Braun-
fchweiger Darftellung. In Haltung und Ge-
wandung, dem Platz des Kindes beim
Frühling, der koketten Schrittftellung, dem
ganz gleichartig mit dem Handrücken in die
Hüfte gehemmten Arm und der rokoko-
haft zierlichen Silhouette des Sommers fin-
den fich deutlichfte Analogien, während
doch andererfeits auch eigene Züge nicht
fehlen. Der jetzt als Herbft aufgefiellte
Bacchus zeigt weniger enge Beziehungen
zu beiden Gruppen, delto fiärkere der jetzt
unter den übrigen Göttern flehende zweite
Bacchus mit Satyrknaben, fo daß diefe Sta-
tue wohl urfprünglich als für den Herbft
gedacht anzunehmen ift, fchon deshalb, weil
er unter den Göttern der einzige mit einer
Kinderfigur fein, und als Gegenftüdk zum
Frühling mit Kind weit belfer paffen würde.
Da der Braunfchweiger Herbft nicht er-
halten ift (nach Scherer »Studien zur Elfen-
beinplaftik der Barockzeit«, S. 37, hatte er
ebenfalls einen Satyrknaben), kann zum
Vergleich nur der Dresdner Herbft heran-
gezogen werden. Er zeigt wieder diefelbe
enge Verbindung, Die gleiche in ftarker
Kurve nach rechts ausbiegende Stellung
auf den linken Fuß, der links fitzende
Satyrknabe. Abweichend ift in Dresden die
Hand, in Schwerin der Ellbogen aufge-
ftützt, während die linke Hand in Dresden
den Becher hält (die üblichere Form),
während fie in Schwerin traubenhaltend
auf der Stirn liegt.
Der Winter endlich weift wieder auf die
Braunfchweiger Folge. Hier ift der Winter
nur bekannt in einer Fürftenberger Porzel-
lanausformung nach dem nicht mehr erhal-
tenen Permoferfchen Original. Beide Dar-
ftellungen gleichen fich faft wörtlich, ab-
weichend in Schwerin nur das vom Rauch
verhüllte Bein und ein dürftiger Pelz, mit
dem fich der Winter zu fchützen fucht.
Apoll
Diefe Verwandtfdhaft gefiattet alfo als
vorläufiges Ergebnis den fieberen Schluß
einer engfien Zufammengehörigkeit der drei
Gruppen. Die Nachforfdhungen in den
Akten ergeben den Namen des Meifters
nicht und fo kann nur Stilvergleichung
Auffchüffe verfprechen. Hierzu müffen auch
vor allem die übrigen fieber der gleichen
Werkfiatt entflammenden Statuen heran-
gezogen werden. Von ihnen zeigen, wie
fchon oben erwähnt, Ceres und Flora wie-
der in Motiv und Einzelgefialtung An-
klänge an die Jahreszeitenfolgen, fo das
Mufter auf dem Mieder der Ceres und
des Braunfchweiger Sommers. Herkules-,
Apoll-, Merkurdarftellungen werden mehr-
fach bei Permofer erwähnt. Befonders aber
Einzelzüge, die breiten Geflöhter mit dem
faft fchlitzäugigen Lachen und dem breit-
gezogenen Mund, wie ihn der Herbft,