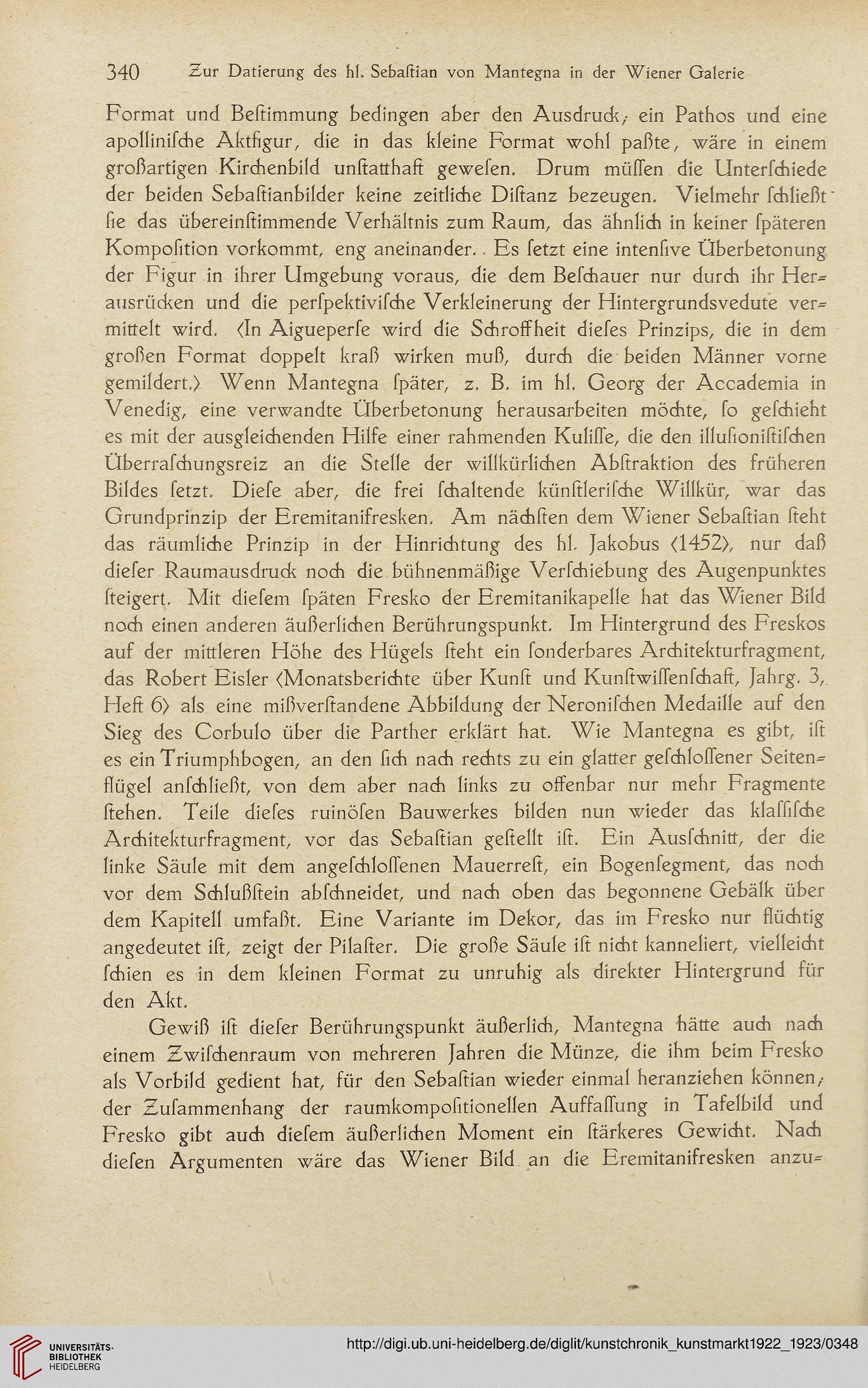340 Zur Datierung des hl. Sebaftian von Mantegna in der Wiener Galerie
Format und Beftimmung bedingen aber den Ausdruck,- ein Pathos und eine
apollinifche Aktfigur, die in das kleine Format wohl paßte, wäre in einem
großartigen Kirchenbild unftatthaft gewefen. Drum müßen die Unterfchiede
der beiden Sebaftianbilder keine zeitliche Diftanz bezeugen. Vielmehr fchließt
fie das übereinftimmende Verhältnis zum Raum, das ähnlich in keiner fpäteren
Kompofition vorkommt, eng aneinander.. Es fetzt eine intenfive Überbetonung
der Figur in ihrer Umgebung voraus, die dem Befchauer nur durch ihr Her-
ausrücken und die perfpektivifche Verkleinerung der Hintergrundsvedute ver-
mittelt wird. <In Aigueperfe wird die Schroffheit diefes Prinzips, die in dem
großen Format doppelt kraß wirken muß, durch die beiden Männer vorne
gemildert.) Wenn Mantegna fpäter, z. B. im hl. Georg der Accademia in
Venedig, eine verwandte Überbetonung herausarbeiten möchte, fo gefchieht
es mit der ausgleichenden Hilfe einer rahmenden Kuliffe, die den illufioniftifchen
Überrafchungsreiz an die Stelle der willkürlichen Abftraktion des früheren
Bildes fetzt. Diefe aber, die frei fchaltende künftlerifche Willkür, war das
Grundprinzip der Eremitanifresken. Am nächften dem Wiener Sebaftian fteht
das räumliche Prinzip in der Hinrichtung des hl. Jakobus <1452>, nur daß
diefer Raumausdruck noch die bühnenmäßige Verfchiebung des Augenpunktes
fteigert. Mit diefem fpäten Fresko der Eremitanikapelle hat das Wiener Bild
noch einen anderen äußerlichen Berührungspunkt. Im Hintergrund des Freskos
auf der mittleren Höhe des Hügels fteht ein fonderbares Architekturfragment,
das Robert Eisler Monatsberichte über Kunft und Kunftwiflenfchaft, Jahrg. 3,
Heft 6> als eine mißverftandene Abbildung der Neronifchen Medaille auf den
Sieg des Corbulo über die Parther erklärt hat. Wie Mantegna es gibt, ift
es ein Triumphbogen, an den fich nach rechts zu ein glatter gefchloffener Seiten-
flügel anfchließt, von dem aber nach links zu offenbar nur mehr Fragmente
liehen. Teile diefes ruinöfen Bauwerkes bilden nun wieder das klaffifche
Architekturfragment, vor das Sebaftian geftellt ift. Ein Ausfdhnitt, der die
linke Säule mit dem angefchloffenen Mauerreft, ein Bogenfegment, das noch
vor dem Schlußftein abfchneidet, und nach oben das begonnene Gebälk über
dem Kapitell umfaßt. Eine Variante im Dekor, das im Fresko nur flüchtig
angedeutet ift, zeigt der Pilafter. Die große Säule ift nicht kanneliert, vielleicht
fchien es in dem kleinen Format zu unruhig als direkter Hintergrund für
den Akt.
Gewiß ift diefer Berührungspunkt äußerlich, Mantegna hätte auch nach
einem Zwifchenraum von mehreren Jahren die Münze, die ihm beim Fresko
als Vorbild gedient hat, für den Sebaftian wieder einmal heranziehen können,-
der Zufammenhang der raumkompofitionellen Auffaflung in Tafelbild und
Fresko gibt auch diefem äußerlichen Moment ein ftärkeres Gewicht. Nach
diefen Argumenten wäre das Wiener Bild an die Eremitanifresken anzu-
Format und Beftimmung bedingen aber den Ausdruck,- ein Pathos und eine
apollinifche Aktfigur, die in das kleine Format wohl paßte, wäre in einem
großartigen Kirchenbild unftatthaft gewefen. Drum müßen die Unterfchiede
der beiden Sebaftianbilder keine zeitliche Diftanz bezeugen. Vielmehr fchließt
fie das übereinftimmende Verhältnis zum Raum, das ähnlich in keiner fpäteren
Kompofition vorkommt, eng aneinander.. Es fetzt eine intenfive Überbetonung
der Figur in ihrer Umgebung voraus, die dem Befchauer nur durch ihr Her-
ausrücken und die perfpektivifche Verkleinerung der Hintergrundsvedute ver-
mittelt wird. <In Aigueperfe wird die Schroffheit diefes Prinzips, die in dem
großen Format doppelt kraß wirken muß, durch die beiden Männer vorne
gemildert.) Wenn Mantegna fpäter, z. B. im hl. Georg der Accademia in
Venedig, eine verwandte Überbetonung herausarbeiten möchte, fo gefchieht
es mit der ausgleichenden Hilfe einer rahmenden Kuliffe, die den illufioniftifchen
Überrafchungsreiz an die Stelle der willkürlichen Abftraktion des früheren
Bildes fetzt. Diefe aber, die frei fchaltende künftlerifche Willkür, war das
Grundprinzip der Eremitanifresken. Am nächften dem Wiener Sebaftian fteht
das räumliche Prinzip in der Hinrichtung des hl. Jakobus <1452>, nur daß
diefer Raumausdruck noch die bühnenmäßige Verfchiebung des Augenpunktes
fteigert. Mit diefem fpäten Fresko der Eremitanikapelle hat das Wiener Bild
noch einen anderen äußerlichen Berührungspunkt. Im Hintergrund des Freskos
auf der mittleren Höhe des Hügels fteht ein fonderbares Architekturfragment,
das Robert Eisler Monatsberichte über Kunft und Kunftwiflenfchaft, Jahrg. 3,
Heft 6> als eine mißverftandene Abbildung der Neronifchen Medaille auf den
Sieg des Corbulo über die Parther erklärt hat. Wie Mantegna es gibt, ift
es ein Triumphbogen, an den fich nach rechts zu ein glatter gefchloffener Seiten-
flügel anfchließt, von dem aber nach links zu offenbar nur mehr Fragmente
liehen. Teile diefes ruinöfen Bauwerkes bilden nun wieder das klaffifche
Architekturfragment, vor das Sebaftian geftellt ift. Ein Ausfdhnitt, der die
linke Säule mit dem angefchloffenen Mauerreft, ein Bogenfegment, das noch
vor dem Schlußftein abfchneidet, und nach oben das begonnene Gebälk über
dem Kapitell umfaßt. Eine Variante im Dekor, das im Fresko nur flüchtig
angedeutet ift, zeigt der Pilafter. Die große Säule ift nicht kanneliert, vielleicht
fchien es in dem kleinen Format zu unruhig als direkter Hintergrund für
den Akt.
Gewiß ift diefer Berührungspunkt äußerlich, Mantegna hätte auch nach
einem Zwifchenraum von mehreren Jahren die Münze, die ihm beim Fresko
als Vorbild gedient hat, für den Sebaftian wieder einmal heranziehen können,-
der Zufammenhang der raumkompofitionellen Auffaflung in Tafelbild und
Fresko gibt auch diefem äußerlichen Moment ein ftärkeres Gewicht. Nach
diefen Argumenten wäre das Wiener Bild an die Eremitanifresken anzu-